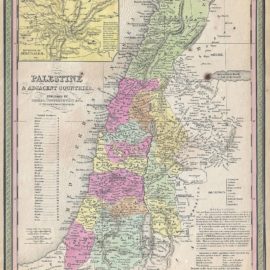Das Engelsche Gesetz und die grüne Blase
Warum Michael Moore nur unterdurchschnittlich viel für Lebensmittel ausgibt. Und was das alles mit dem Milieu der Besserverdienenden im Prenzlauer Berg zu tun hat.
Laut Wikipedia ist das Engelsche Gesetz „eines der am besten belegten empirischen Gesetze der Volkswirtschaftslehre“. Das 1857 vom deutschen Statistiker Ernst Engel aufgestellte Gesetz besagt, dass der Anteil des Einkommens, der für die Ernährung aufgewendet wird, mit steigendem Einkommen sinkt. Beim armen Schlucker gehen dreißig Prozent des Einkommens für Lebensmittel drauf, beim gut situierten Akademiker hingegen nur noch fünf Prozent.
Die Erklärung des Engelschen Gesetzes ist einfach. Die Menge an Lebensmitteln, die ein Mensch zu sich nehmen kann und muss, ist nach oben und unten begrenzt. Besserverdienende können sich zwar teurere Lebensmittel – Kopi Luwak statt Melitta-Kaffee, Foie gras statt Leberwurst, Bordeaux statt Dosenbier – leisten, sie futtern aber nicht größere Mengen als ein Normalverdiener. Und selbst bei den teureren Lebensmitteln tritt schnell ein abnehmender Grenznutzen auf; den Unterschied zwischen Kopi Luwak und Melitta-Kaffee kann man noch schmecken, bei Kartoffeln zu 5, 50, 500 oder 5.000 Euro der Sack wird es schwierig.
Da demnach ein Multimillionär wie Michael Moore trotz aller sichtlich vorhandenen Anstrengungen nicht in der Lage ist, einen höheren Einkommensanteil als ein rankenschlanker Walmart-Hilfsarbeiter zu verspeisen, eignet sich dieser Einkommensanteil wunderbar als Wohlstands- bzw. Armutsindikator. In den USA etwa wurde in den sechziger Jahren das Engelsche Gesetz von der Ökonomin und Statistikerin Mollie Orshansky herangezogen, als sie für die U. S. Social Security Administration die Armutsgrenze definierte. Eine idealtypische vierköpfige Familie galt damals als arm, wenn mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens für den Erwerb von Nahrungsmitteln ausgegeben werden musste.
Wenn es nur zum Unterhalt und zur Fortpflanzung reicht
Neben dem der Haushalte lässt sich aber auch der Wohlstand ganzer Nationen an diesem Einkommensanteil festmachen. Und damit auch die Wohlstandsentwicklung. 2015 lag dieser Einkommensanteil in Deutschland zum Beispiel bei durchschnittlich 13,6 Prozent (inkl. Tabak und Alkohol), 1960 – also zu Wirtschaftswunderzeiten, in denen „es uns“ nach Meinung vieler Nostalgiker vermeintlich „besser ging“ – bei 38 Prozent, 1850 bei 61 Prozent. 61 Prozent im Bevölkerungsdurchschnitt, wohlgemerkt, das Elend der beginnenden Industrialisierung traf die im Entstehen begriffene Arbeiterklasse am härtesten. „Die Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Race bedarf“, schrieben Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848.
In den bitterarmen Ländern – etwa Burkina Faso, Äthiopien und Mauretanien – belaufen sich die Nahrungsmittelausgaben mit rund 60 Prozent des Einkommens noch heute auf der Höhe des deutschen Industrialisierungswertes von 1850. Auf der anderen Seite gibt es extrem wohlhabende Länder wie Singapur, Amerika, Kanada und die Schweiz, die einen einstelligen Prozentwert erreichen und damit das heutige Deutschland unterbieten. Deutschlands Wirtschaftswunderwert von 38 Prozent erreichen jetzt Länder wie Bhutan, Bolivien und Weißrussland, allesamt Länder, die gemeinhin als arm klassifiziert werden.
Krieg den Hütten, Friede den Palästen
Als 2007 der nordamerikanische Maispreis aufgrund der Subventionen der US-Regierung für die Ethanolproduktion in die Höhe schoss, gab es massive soziale Proteste – jedoch nicht im Rust Belt oder in South Central, sondern auf der anderen Seite der US-Grenze, in Mexiko. In Amerika werden im Schnitt gerade einmal 6,7 Prozent des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben, in Mexiko sind es dagegen 24 Prozent, also mehr als das Dreifache. Da Mais (in Form von Tortillas) auch noch das Grundnahrungsmittel in Mexiko ist, schlug der Preisanstieg voll auf die Kaufkraft durch. „Wenn ich in meinen Geldbeutel schaue, weiß ich nicht, wie das bis nächste Woche reichen soll“, so eine betroffene Mexikanerin während der „Tortilla-Krise“.
Dass es in Mexiko – und eben nicht im Verursacher-Land Amerika – zu schweren Protesten kam, hängt mit den Implikationen des Engelschen Gesetzes zusammen. Der hohe Einkommensanteil, den Arme für Lebensmittel aufwenden müssen, wirkt bei steigenden Lebensmittelpreisen wie ein Hebel. Verdoppeln sich, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei den Amerikanern die Lebensmittelpreise, verlieren sie 6,7 Prozent ihres Einkommens. Mexikaner hingegen verlieren 24 Prozent ihres Einkommens, was durchaus brutal ist. Noch brutaler hingegen wird es, wenn man bedenkt, dass diese 24 Prozent nur einen Durchschnittswert darstellen, arme Mexikaner geben 50 und mehr Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus, wodurch sie durch die Verdoppelung der Lebensmittelpreise in akute Existenznot geraten. Eine denkbar einfache Formel steht daher hinter dem Engelschen Gesetz: Je ärmer Menschen sind, desto stärker werden sie von steigenden Lebensmittelpreisen getroffen. Umgekehrt sind es aber auch die Armen, die am stärksten von sinkenden Lebensmittelpreisen profitieren.
Als Linke noch für den Freihandel waren
Der direkte Zusammenhang von Lebensmittelpreisen und sozialer Frage hat dazu geführt, dass Linke – früher zumindest – für den Freihandel waren, von dem sie sich niedrigere Lebensmittelpreise erhofften, während die Rechten zugunsten der einheimischen Agrarwirtschaft auf Zölle setzten. Und das durchaus plakativ, laut Harold James ist die „Sozialdemokratie […] weitgehend auf der Gegnerschaft zu den Schutzzöllen aufgebaut worden. Es gibt Wahlplakate aus dem 19. Jahrhundert, die einen Laib Brot zeigen und grafisch verdeutlichen, wie groß die Scheibe ist, die von den Agrarzöllen abgeschnitten wird.“ In England gab es vorher schon die „Anti-Corn Law League“, in der Linke, (Manchester-)Liberale und andere Progressive für die Abschaffung der Getreidezölle stritten – und das ähnlich wie in Deutschland gegen eine Allianz aus Agrariern, Adel und anderen reaktionären Gruppen. Nach Auffassung der Manchester-Liberalen bestand der Hauptzweck der von ihnen bekämpften Zölle darin, die Privilegien der ländlichen Aristokratie zu schützen, die Kosten hierfür müssten jedoch die Arbeiter mit überteuerten Brotpreisen und einer Verschärfung des sozialen Elends tragen.
Eine andere Möglichkeit, die Schere zwischen Arm und Reich über die Hebelwirkung der Lebensmittelpreise zu schließen, besteht in direkten und indirekten Lebensmittelsubventionen. Indirekte Subventionen wie der reduzierte Mehrwertsteuersatz in Deutschland, von dem Geringverdiener überdurchschnittlich stark profitieren (auch wenn Foie gras ebenfalls nur mit sieben Prozent besteuert wird). Direkte Lebensmittelsubventionen wie in Ägypten, wo schon unter Mubarak und Mursi die „Lebensmittel- und Heizölsubventionen […] die nicht existierende Sozialpolitik“ ersetzten. Die Subventionen gehen dort zwar mit enormen Kosten und ökonomischen Fehlanreizen einher, trotzdem werden sie von keiner ägyptischen Regierung komplett geschliffen, da andernfalls massive Sozialunruhen drohen. Die Ärmsten trifft es halt immer am härtesten.
Fernsehköche und andere Zumutungen
Die Bedeutung und die politischen und sozialen Implikationen des Engelschen Gesetzes dürften den meisten deutschen Politikern bewusst sein – Promis wie der meinungsstarken TV-Köchin Sarah Wiener hingegen nicht. Zumindest ist davon auszugehen, wenn man ihr länger dabei zuhört, wie sie sich selbst dafür lobt, dass sie ja bereit ist, für gutes Essen mehr Geld auszugeben. Dass sie sich das ja wert ist, dass sie beim Essen auf Qualität achtet, dass ihr Gesundheit und Wohlbefinden wichtiger als der Geldbeutel sind. Und das Ganze mit einem moralischen Unterton, mit dem sie für sich wie selbstverständlich eine Vorbildfunktion reklamiert.
Natürlich gibt Sarah Wiener in Euros (also absolut) gerechnet mehr Geld für Essen aus als die allermeisten Bundesbürger – relativ betrachtet jedoch sicher nicht. Schließlich ist sie neben ihrem TV-Köchin-Dasein auch noch eine ziemlich umtriebige Unternehmerin, ihr Gesamteinkommen dürfte entsprechend hoch sein. So hoch, dass der Einkommensanteil, den sie für Lebensmittel verwendet, vergleichsweise gering ist. Vermutlich sogar sehr gering, vielleicht sind es 90 oder 95 Prozent aller Deutschen, die einen größeren Einkommensanteil für Lebensmittel ausgeben.
Das ist sicher nicht schön, wenn Underperformer sich als Overachiever darstellen, aber doch eher menschlich, schließlich machen wir alle uns bei der Selbstwahrnehmung gerne etwas vor. Obszön wird es jedoch, wenn die Heilige Sarah der Kochtöpfe wieder und wieder darauf hinweist, dass Lebensmittel in Deutschland ja „zu billig“ seien und dagegen etwas getan werden müsse. Denn die Rechnung für diese Forderung muss von denen bezahlt werden, die ein geringeres Einkommen als Wiener haben. Und das absteigend; je ärmer, desto mehr Kaufkraft geht den Leuten mit Wieners Forderung verloren. Man ist geneigt, sie mit Marie Antoinette in einen Topf zu werfen, aber Sarah Wiener hat tatsächlich die niedrigen Lebensmittelpreise moniert, während Marie Antoinette das „Sollen sie doch Kuchen essen“ nur zugeschrieben wurde, sie hat es nie gesagt.
Sanierter Altbau, Yoga und Bordeaux
Natürlich ist Sarah Wiener politisch betrachtet nur eine TV-Köchin mit überdurchschnittlicher Medienpräsenz, die den Verlauf der Weltgeschichte durch ihre unausgegorenen Ideen und ihrer bizarren „Eat the poor“-Attitüde mit Heiligenschein nicht groß verändern wird. Leider ist sie dabei aber auch gleichzeitig der Marker eines ganzen Milieus, bei dem, sobald es ums Essen geht, die moralische Überheblichkeit mit dem Einkommen wächst.
Marieluise Beck, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Bremer Viertel, hat das Milieu und die mit der Überheblichkeit des Milieus einhergehenden Vorwürfe und Vorurteile selbstkritisch mit den Worten „Viele unserer Grünen Vorhaben sind ein erstrebenswertes Modell für die obere Mittelschicht – bilden aber zu wenig von der realen Welt vieler Menschen ab. Du kaufst bei Aldi? Du liebst Dein Schnitzel? Du rauchst immer noch? Dein Auto ist Dein ganzer Stolz?“ beschrieben. Damit trifft sie nicht nur – wie von ihr geschrieben – ihre eigene Partei, sondern das typische Bremer Viertel-Milieu, also das, was in Berlin der Prenzlauer Berg und in Hamburg Eimsbüttel ist. Sanierter Altbau, Yoga, Bordeaux.

„Du kaufst bei Aldi? Du liebst dein Schnitzel?“ funktioniert als Vorwurf nur in einem Milieu, in dem es beim Essen nicht nur um Ernährung und Genuss, sondern um Identitätsfragen geht. Du bist, was du isst, statt der Mitgliedschaft im Rotary Club oder dem Stern auf der Motorhaube wird der Lebensmitteleinkauf auf dem Isemarkt oder auf dem Wochenmarkt am Kollwitzplatz zum Distinktionsmerkmal des innerstädtischen Bürgertums. Man dünkt sich linksalternativ, irgendwie voll unspießig, nimmt beim Essenseinkauf einen emotionalen und moralischen Mehrwert mit.
Wenn es schon kein richtiges Leben im falschen gibt, dann aber doch das richtige Essen. Und die Messlatte fürs richtige Essen wird immer höher gelegt, „Bio-“ allein tut es schon lange nicht mehr, es muss „handmade“ sein, aus „regionaler Wirtschaft“, „frei von XY“, wobei „XY“ je nach angesagter bzw. individueller Unverträglichkeit variiert. Unverträglichkeiten gibt es in dem Milieu, das Essen zur Identitätsfrage hochgejazzt hat, en masse, ein Must-have wie die Laktoseintoleranz wird hier nicht aufgrund von genetischen Dispositionen ausgelöst, sondern übertragen wie die Masern (die es hier leider auch sehr häufig gibt). Avocados aus der Mark Brandenburg, in einer kleinen Kreuzberger Hinterhof-Manufaktur mit Bio-Ethen behandelt, wären der Traum, ließen sich dafür doch Preise abrufen, bei denen jeder gestandene Apotheker rot anlaufen würde.
Der Prolet aus Hohenschönhausen
Apropos Preise, simple ökonomische Überlegungen wie die, dass sich im Preis auch der Ressourcenaufwand bei der Produktion widerspiegelt, gehen diesem Milieu komplett ab, denken sie doch, dass höhere Preise für einen geringen Ressourcenverbrauch stehen. Andernfalls würde sie womöglich auch der Zweifel beschleichen, ob die Billignudeln des verachteten Aldi-Käufers aus Hohenschönhausen aufgrund der Skaleneffekte womöglich mit einer geringeren Umweltbelastung als die aufwendig produzierten Nischenprodukte des Kollwitzplatzmarktes einhergehen. Und Zweifel kommt in diesem Milieu gar nicht gut, schließlich gehört man doch zu den Guten.
Natürlich greift in der „oberen Mittelschicht“, wie Marieluise Beck das Milieu klassifiziert hat, auch das Engelsche Gesetz. Der „Weil ich es mir wert bin“-Kollwitzplatz-Gänger kann sich die teureren Lebensmittel nicht nur leisten, er gibt gleichzeitig auch einen kleineren Einkommensanteil als der Prolet aus Hohenschönhausen fürs Essen aus. Dabei hält man sich – Sarah Wiener lässt schön grüßen – auch noch für ein Vorbild, „wenn nur alle sich so bewusst wie ich ernähren würden“, gäbe keinen Klimawandel mehr, auch würde die Ausbeutung des Menschen verschwinden und niemand mehr würde den Robbenbabys den Schädel einschlagen. Und, jetzt wird es richtig obszön, wie Sarah Wiener ist man sich in dem Milieu, in der Besserverdienenden-Blase vom Prenzlauer Berg, aus Hamburg-Eimsbüttel und dem Bremer Viertel einig darin, dass die Lebensmittel in Deutschland zu billig seien. Also nicht die, die man selbst isst, sondern die des Aldi-Gängers aus Hohenschönhausen, der zwar nur den Mindestlohn nach Hause bringt, aber doch gefälligst so leben und essen soll, als wäre er in der Besoldungsgruppe A13 angesiedelt. Und wenn dann bereits am Achten des Monats das Einkommen aufgebraucht ist, dann soll er doch Kuchen essen, aber bitte den vom Kollwitzplatz, also handgemachte Regionalware ohne künstliche Konservierungsstoffe. Weil er es sich doch wert ist.
Update 19. März 2017: Es gibt einen kleinen Nachtrag.