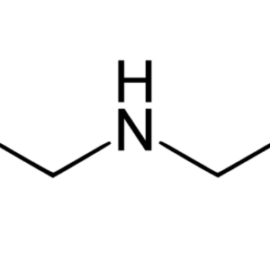Fauda – die Seriensensation des Jahres
Auf Netflix ist seit Dezember die israelische Erfolgsserie „Fauda“ (Arabisch für „Chaos“) zu sehen – und beweist, dass Israel auch nach „Hatufim“, dem Original von „Homeland“, TV-Unterhaltung auf Weltniveau bietet.
„Mista’aravim“ – „arabisierte“ Einheiten der israelischen Sicherheitsdienste erfüllen einige der gefährlichsten und interessantesten Aufgaben hinter feindlichen Linien. Israelische Soldaten, die perfekt Arabisch sprechen und sich im Koran wie in arabischer Kultur auskennen, verschmelzen mit ihrer Umgebung, um z.B. Informationen zu gewinnen oder feindliche Kämpfer zu fangen oder zu töten. Eine solche Einheit zeigt „Fauda“ in 12 Folgen à 40 Minuten bei ihrer Jagt auf den hochrangigen Hamas-Funktionär „Abu Achmad“.
Nicht nur der omnipräsente Gelbfilter und die schweren Beats in der Titelmelodie erinnern an die Ästhetik von „Breaking Bad“. Wir begleiten auch mit Doron, dem Leiter der Einheit, einen moralisch zunächst integren Helden, der seinen Gegnern ähnlicher wird, als er sich das selbst vorstellen konnte. Alle bedeutenden Konflikte dieses Jahrhunderts sind bisher „asymetrisch“, weshalb die in der Serie verhandelte Frage nicht aktueller sein könnte: Wie antwortet ein Rechtsstaat auf eine Bedrohung durch Feinde, die ihrerseits an keinerlei rechtliche oder auch nur moralische Standards gebunden sind? Und wie geht ein Rechtsstaat mit eigenen Soldaten um, die gegen eben jene Restriktionen verstoßen, die sich der Rechtsstaat selbst auferlegt? Zuletzt machte die Verurteilung Elor Azarias wegen Totschlags international Schlagzeilen und war Anlass für heftige Kontroversen in Israel.
Die Charaktere in Fauda sind glaubhaft gezeichnet und grandios gespielt, mein persönliches Highlight ist Walid Al Abed, gespielt von Shadi Mar’i, von dem noch viel zu hören sein wird. Walid ist die rechte Hand des Terrorfürsten Abu Achmad und eben auch ein schüchterner 20-Jähriger, der hoffnungslos in seine ältere Cousine verliebt ist. Einzig in einem Fall kippt die Story ins Unglaubwürdige: Die hinterbliebene Verlobte eines von der Einheit erschossenen Palästinensers beschließt, als Selbstmordattentäterin Rache zu nehmen. Das klingt zwar halbwegs nachvollziehbar, ist aber in der Realität praktisch nie der Fall, wie man dank der wissenschaftlichen Arbeit der großartigen Anat Berko weiß (die inzwischen für den Likud auch Knesset-Abgeordnete ist), und wie man in der sehr sehenswürdigen Doku „Shahida – Allahs Bräute“ mit eigenen Augen sehen kann. Selbstmordattentäterinnen sind praktisch ausnahmslos primär Selbstmörderinnen, also nicht durch ihren Hass auf Juden motiviert, sondern durch den Wunsch, einem elenden Leben zu entkommen. Und am Elend ist in aller Regel die archaische arabische Gesellschaft schuld, in der ein Vergewaltigungsopfer als beschädigte Ware gilt oder der Mann sich eine junge Zweitfrau nimmt, wenn er seiner Gattin überdrüssig ist. Unter anderem deshalb sind Frauen statistisch auch viel seltener „erfolgreich“ als männliche Shahids. Unmotiviert mit einem Messer herumzufuchteln reicht, um in einem israelischen Gefängnis zu landen, was allemal besser ist, als sich vom Ehemann verprügeln zu lassen.
Abgesehen von diesem verzeihlichen Fehler ist „Fauda“ ein sensationelles Action-Drama, spitzenmäßige Unterhaltung, von der Kritik zu recht gefeiert – und von Netflix belohnt durch die Bestellung einer zweiten Staffel. Hier vor der synchronisierten Version zu warnen, ist übrigens ausnahmsweise nicht hauptsächlich dem Standesdünkel geschuldet: Der Wechsel zwischen Arabisch und Hebräisch ist bei „Fauda“ tatsächlich relevant für die Geschichte.