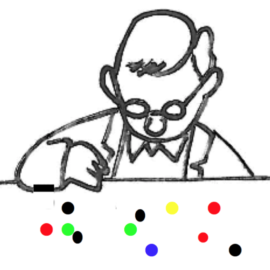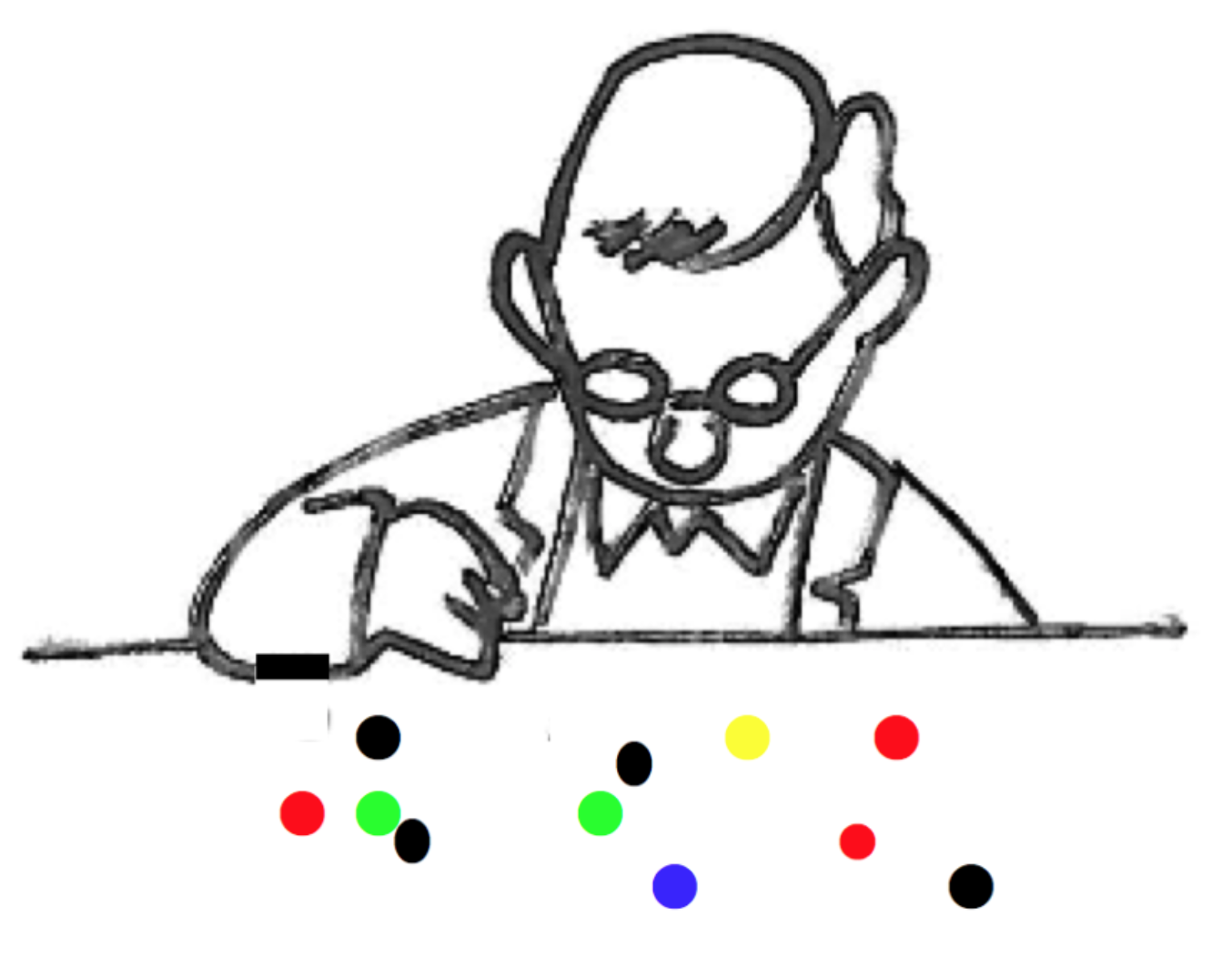Grüne Kernschmelze
Mit der Wahl Winfried Kretschmanns zum ersten grünen Ministerpräsidenten hatten die Grünen ihren Zenit erreicht. Seitdem geht es bergab. Nicht alle Gründe für den Abstieg der Grünen sind begrüßenswert.
24 Prozent in den Umfragen zur Bundestagswahl, die SPD mit 27 und die CDU mit 32 Prozent in Sichtweite. 2011 war das große Jahr der Grünen. Nach der Havarie des Kernreaktors im japanischen Fukushima schienen die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei. Mit Winfried Kretschmann stellte die Partei erstmals einen Ministerpräsidenten und in Berlin bewarb sich die grüne Spitzenkandidatin Renate Künast um das Amt des Regierenden Bürgermeisters und forderte Amtsinhaber Klaus Wowereit heraus.
32 Jahre nach ihrer Gründung schien der endgültige Durchbruch für die Grünen gekommen zu sein. Eine Volkspartei des 21. Jahrhunderts wollte man sein: Ökologisch, multikulturell, bereit das Land umzubauen. Modern war, was grün war: Die Industriegesellschaft erschien ein Auslaufmodell zu sein, in den hippen Quartieren der Großstädte lebte man grün, kaufte Bio, trennte seinen Müll und fuhr ab und an sogar Rad. Die Grünen waren die neue Partei des Bürgertums, eine Mischung aus Wertkonservatismus, ökologischem Aufbruch und gesellschaftlichem Modernisierungswillen verbunden mit einem Maß an Paternalismus, der in weiten Teilen der Gesellschaft anschlussfähig war. Die Grünen hatten eine Idee davon, wie Menschen zu leben haben und viele waren damals bereit, dieser Idee zu folgen.
Auch das Personal wirkte auf viele überzeugend. Die Bandbreite der grünen Spitzenpolitiker war beeindruckend. Sie reichte vom konservativen Winfried Kretschmann über den erfahrenen Jürgen Trittin und die betroffene Claudia Roth bis hin zur ernsten Renate Künast. Ob Ton-Steine-Scherben-Fan oder frommer Kirchgänger – die Grünen hatten für jeden ein authentisches Angebot. Und all diesen Personen kaufte man ab, dass ihnen ihre Politik ein ehrliches Anliegen war, ihre oft von Brüchen gekennzeichneten Biografien waren ein Ausweis ihrer Lebenserfahrung und ihrer Offenheit.
WIEDEREINZUG IN DEN NRW-LANDTAG IST UNSICHER
Heute, sechs Jahre später, liegt das alles weit zurück. Die Grünen haben in den vergangenen Monaten in den Umfragen fast die Hälfte ihrer Wähler verloren. Zwar regieren sie in elf von sechzehn Bundesländern in allen denkbaren Kombinationen, aber aus den Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, beides sicher keine Grünen-Hochburgen, sind sie rausgewählt worden. Schon 2013, als sie die Chance einer schwarz-grüne Koalition im Bund einzugehen ausschlugen, blieben sie mit 8,4 Prozent bei der Bundestagswahl hinter den Erwartungen und landeten hinter der Linkspartei. Mit dem Atomausstieg hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Grünen damals schon das wichtigste Thema genommen. In Nordrhein-Westfalen müssen sie bei Umfragewerten von sechs Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten. In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz steht die Partei zur Zeit zwischen fünf und sechs Prozent. Stark ist sie in Schleswig-Holstein, wo im Mai eine Woche vor NRW gewählt wird: 14 Prozent erreichen die Grünen dort. Robert Habeck, der stellvertretende grüne Ministerpräsident des Landes, scheiterte erst Anfang des Jahres knapp mit seinem Versuch, Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl zu werden. Statt Habeck wählten die Grünen als männlichen Spitzenkandidaten Cem Özdemir, den Frauenplatz erhielt Katrin Göring-Eckardt.
Vielleicht würden die Grünen heute bundesweit in den Umfragen besser aussehen, wenn sie Habeck und nicht Özdemir gewählt hätten, wissen kann das niemand. Aber Habeck wäre zumindest ein neues Gesicht gewesen. Und das hätten die Grünen gut gebrauchen können. Denn Özdemir und Göring-Eckardt sind ein Problem der Grünen. Sie sind ordentliche Kandidaten, aber mehr auch nicht. Kandidaten, mit denen man antreten kann, wenn alles läuft, keine, die ein Ruder herumreißen können, wenn es schwierig wird. Die beiden sind das personifizierte Mittelmaß: Berufspolitiker Zeit ihres Lebens, Eigengewächse ihrer Partei mit einem Leben ohne Brüche. Bei einer Bundestagswahl, die zwischen zwei starken Kandidaten von SPD und CDU entschieden wird, wird das nicht reichen. Mit Özdemir und Göring-Eckardt hätten sich die Grünen gegenüber Steinmeier oder Steinbrück behaupten können, gegen den Populisten Schulz wird das kaum gelingen.
Zumal die Themen der Grünen nicht mehr ziehen: Umweltpolitik ist nur noch acht Prozent der Wähler wichtig. Die Energiewende ist kein Gewinnerthema. Zuwanderung, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit werden die Bundestagswahl bestimmen. Im Bereich der Wirtschaftspolitik sind die Grünen mit ihrem Nein zu TTIP und CETA nah an die AfD und US-Präsident Trump gekommen. Was vor kurzem noch gegenüber einer naiven Klientel rebellisch wirkte, erscheint nun überdeutlich als das, was es immer schon war: reaktionär. Soziale Gerechtigkeit und Sicherheit sind keine Themen, bei denen den Grünen Kompetenz zugeschrieben wird. Und im Bereich der Zuwanderung, wo die Grünen ohne jeden Zweifel kompetent sind, bläst ihnen der Zeitgeist ins Gesicht.
UNBELIEBTE VOLKSERZIEHER
Auch wenn es schon längst nicht mehr zutrifft, konnten sich die Grünen lange das Image bewahren, unkonventionell zu sein. Das glauben aber nur noch ihre Anhänger: Nach einer aktuellen Allensbach-Umfrage sieht fast jeder Zweite die Partei als Volkserzieher, die auf jedes reale oder angebliche Problem nur eine Lösung kennen: Das Verbot. Ob Rauchen in Kneipen, Werbung, Autos, Süßigkeiten, Softdrinks – die Grünen sind schnell dabei, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Doch immer weniger Menschen wollen sich gefallen lassen, von den Grünen erzogen zu werden. Für die Grünen ist das mehr als ein Imageproblem: Ihr Menschen- und Politikbild ist immer weniger anschlussfähig.
Bei Fragen der Außenpolitik, wie der Auseinandersetzung mit dem Regime von Wladimir Putin, die im Laufe des Wahlkampfes eine immer größere Rolle spielen könnten, haben die Grünen wie im gesamten Bereich der Menschenrechtspolitik keine Stimme mehr: Während man an Özdemir und Göring-Eckardt festhielt, wurden ausgerechnet Volker Beck und Marieluise Beck nicht wieder für den Bundestag aufgestellt. Beim Thema Europa werden die Grünen dank Martin Schulz keine Akzente setzen können. Man mag von Schulz halten, was man will, aber kein deutscher Politiker ist ein glaubwürdigerer Europäer als der SPD-Spitzenkandidat.
Doch auch auf einer anderen Ebene ist Schulz für die Grünen eine Gefahr. Der neue Parteivorsitzende hat die Lehren aus der Niederlage von Hillary Clinton gezogen. Die trat mit einer postmodernen Regenbogenkoalition gegen Trump an. Umwelt- und Identitätspolitik waren ihre Schwerpunkte. Trump ging, wenn auch populistisch und wenig glaubwürdig, auf die Arbeiterklasse zu, die Clinton weitgehend ignoriert hatte. Er gewann die Wahl auch, weil er die Wahlmännerstimmen der Staaten des Rust-Belt holte, des amerikanischen Ruhrgebiets. Wenn Schulz die soziale Gerechtigkeit ins Zentrum rückt und von einfachen, fleißigen Menschen spricht, die sich an die Regeln halten und trotzdem jeden Monat Mühe haben, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen, greift er damit nicht nur ein Thema auf, das zur Zeit von den Wählern neben Flüchtlingspolitik als besonders wichtig angesehen wird. Er setzt ein klassisch linkes Thema, zu dem die Grünen als Partei einer postmodernen, identitären und bürgerlichen Linken nicht viel zu sagen haben. Indem Schulz auf soziale Gerechtigkeit setzt und Identitätspolitik und Umwelt nur, wenn überhaupt, als Randthemen anspricht, beeinflusst er die Debatte und drängt die Grünen weiter ins Aus. Er hat die Konsequenz daraus gezogen, dass Umwelt zur Zeit nicht als ein großes Problem wahrgenommen wird und Identitätspolitik in weiten Teilen als Thema außerhalb einer postmodern-orientierten Linken schlicht nicht anschlussfähig ist. Wer Gewerkschafter, Arbeitslose oder Ingenieure als Wähler erreichen will, tut gut daran, Gender-Politik nicht allzu sehr ins Zentrum zu rücken.
GRÜNE IM PERFEKTEN STURM
Die Grünen sind in einen perfekten Sturm geraten: Die Bundestagswahl wird wahrscheinlich vom Kampf ums Kanzleramt zwischen Schulz und Merkel bestimmt, der kleine Parteien zu Mehrheitsbeschaffern degradiert. Mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt hat die Partei zwei Spitzenkandidaten, die kaum mehr als Achselzucken hervorrufen. Umwelt- und Identitätspolitk sind keine Themen mehr, die interessieren, und zu sozialer Gerechtigkeit haben die Grünen wenig beizutragen. Allein im Bereich der Flüchtlingspolitik können sie durch eine eigene, von den anderen Parteien gut zu unterscheidende Haltung punkten.
Das alles wird natürlich nicht das Ende der Grünen bedeuten. Natürlich werden sie in den Bundestag einziehen. Sie stehen als Partei nicht vor dem Aus. Allerdings könnte die Zeit der grünen Hegemonie vorbei sein, die Partei wäre kein Role-Model mehr, sie würde nicht mehr bestimmen, was modern und fortschrittlich ist. Die Grünen wären ein politisches Angebot wie viele andere, das sich im Wettbewerb behaupten muss.