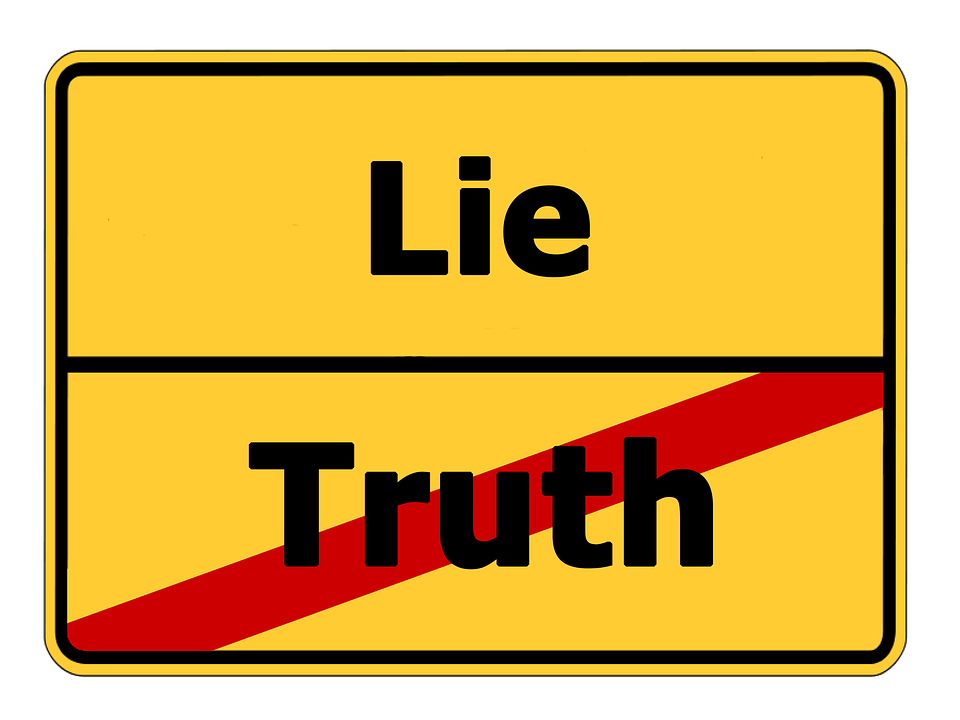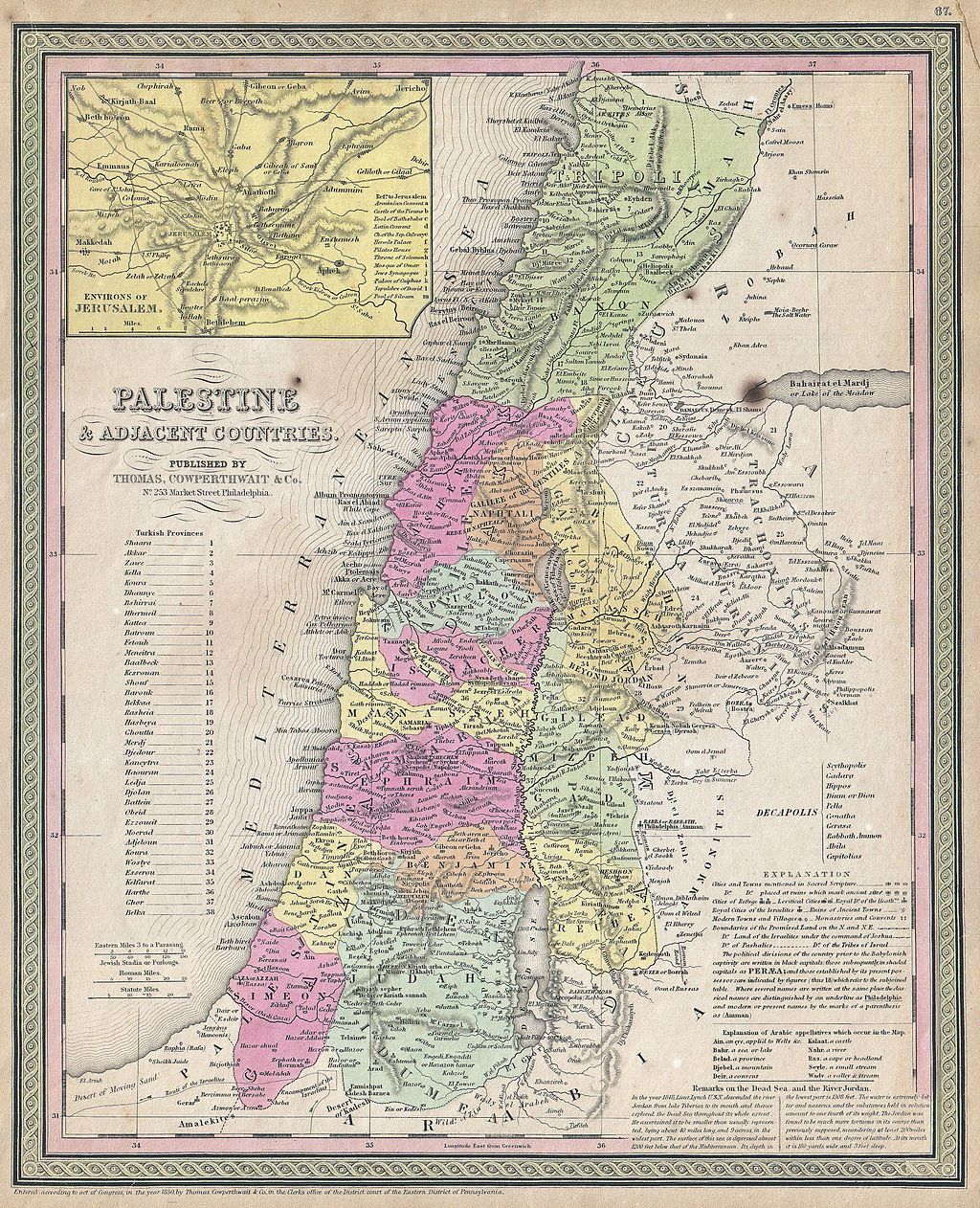Tod eines Unsterblichen
Alberto Barrera Tyszka hat einen Roman über das Leben im Venezuela des Hugo Chávez geschrieben. Ihm ist damit ein subversives Meisterstück gelungen, das aktueller nicht sein könnte.
Am Ende, das natürlich ein böses ist, wenn alle Lügen, paranoiden Anschuldigungen und großmäuligen Versprechungen in den Arenen, im Parlament, im Fernsehen und auf Twitter verstummt sind, steht ein gereiztes Schweigen, ein wirtschaftlich, politisch und vor allem moralisch verwüstetes Land. Bereits beim Lesen der ersten Zeilen von Alberto Barrera Tyszkas Roman „Die letzten Tage des Comandante“ weiß man, wie die Geschichte – zumindest deren pathetisch unters Volk gebrachter Teil – ausgehen wird: Venezuelas Staatschef Comandante Hugo Chávez, selbst ernannter Vater der Nation und des „bolivarischen Sozialismus des 21.Jahrhunderts“, stirbt Anfang März 2013 in einem Militärkrankenhaus der Hauptstadt Caracas, nachdem zuvor im rabiat abgeschirmten Havanna selbst kubanische Regierungsärzte die rapide Agonie nicht mehr hatten aufhalten können.
Was aber war zuvor mit dem erdölreichen Land im Norden Südamerikas geschehen, das sein populistischer Präsident zu einem „Haus“ erklärt hatte – mit der von den Armen nicht durchschauten Absicht, aus einer heterogenen Gesellschaft eine homogene Gemeinschaft zu zimmern und sich dabei als eine Art streng-fürsorglicher Herbergsvater zu inszenieren, der die Seinen mit Brot und Zoten bedient?
EIN LAND FLIEGT IN DIE LUFT
Alberto Barrera Tyszka, 1960 in Caracas geboren und dort bis heute als Hochschullehrer und Schriftsteller lebend, ist bereits mit dem gewählten Tatort seines Romans ein subversives Meisterstück gelungen. Denn anders als die Bücher des Genres „Diktatorenroman“, wie sie Miguel Asturias, Roa Bastos, Garcia Márquez oder Mario Vargas Llosa publiziert haben, spielt „Die letzten Tage des Comandante“ eben nicht in einem mystisch-dunklen Präsidentenpalast, sondern in einem Apartmenthaus der einheimischen Mittelschicht.
[carousel category=““ count=“6″ columns=“3″ title=“show or hide“]
Alle bürgerlichen Annehmlichkeiten scheinen vorhanden, doch nicht nur der in nahezu jeder Wohnung als Informationstravestie permanent laufende Fernseher mit Comandante Chávez’ blökendem Dauerpalaver signalisiert, dass irgendetwas Fundamentales nicht stimmt. „Eine prä-apokalyptische Gesellschaft. Das Land stand immer kurz davor, in die Luft zu fliegen, aber es flog nie in die Luft. Oder schlimmer noch: Es flog langsam in die Luft, nach und nach, ohne dass jemand sonderlich Notiz davon nahm.“
DIE REVOLUTION ALS DROGE
Dennoch ist das semidiktatorisch per Dekret regierte Venezuela weder ein Orwell- noch ein Castro-Staat, auch wird in diesem Roman die Vergangenheit keineswegs schöngeredet: Immerhin waren es ja vor allem das Elitenversagen und die skandalöse soziale Kluft, die den charismatischen Viel- und Schönredner Hugo Chávez zahlreiche Wahlen gewinnen ließen. Der pensionierte Onkologe Miguel Sanabria, einer der Bewohner des Hauses, misstraut deshalb der bourgeoisen Chávez-Verachtung seiner Frau ebenso wie den Regime-Elogen seines älteren Bruders Antonio, von dem er sich mehr und mehr entfremdet. „Die Regierung richtete für Antonios Generation eine Art Themenpark der siebziger Jahre ein.
Als Erstes holte Chávez die Sprache von damals aus der Mottenkiste. Er machte Stalin und die Sowjetunion wieder hoffähig, zitierte Mao, redete von Gramsci und den organischen Intellektuellen. In seinem dritten Lebensjahrzehnt fühlte sich Antonio Sanabria deshalb wieder jung. Die Revolution war eine harte Droge, ein ideologisches Aufputschmittel, eine Art Rückkehr zur Jugend.“
NEUES LAND MIT NEUEN MENSCHEN
Doch der Führer, Direktor und Dompteur dieses Zirkus ist inzwischen todkrank und verschwindet immer wieder aus der Öffentlichkeit, um sich im befreundeten Kuba Operationen zu unterziehen, deren Details streng geheim gehalten werden. Irgendwer aber hat ein Handyvideo vom hinfälligen Chávez gemacht, das den Mythos des dauervitalen Volkstribuns eventuell erschüttern könnte. Und gerade dieses Handy, sinnigerweise verborgen in einer kubanischen Zigarrenkiste, wird dem skrupulösen Onkologen zur Aufbewahrung gegeben – von seinem jungen Neffen, der im Beraterkreis um den cholerischen Comandante zu einer Art Dissident heranzureifen scheint.
Gleichzeitig bricht Sanabrias Wohnungsnachbar, der arbeitslose Journalist Fredy, nach Havanna auf, um im Auftrag eines Chávez-kritischen Verlages ein Buch über den wahren Gesundheitszustand des Präsidenten zu schreiben. Anstatt Informationen zu bekommen, landet er jedoch in einer Ehefalle: Eine des Castro-Regimes müde Kubanerin hat die Gelegenheit, die Insel per Ausländerheirat zu verlassen, sogleich am Schopf ergriffen und den Journalisten mit einem (falschen) Versprechen vor den Traualtar gedrängt – Eheschließung gegen delikate Chávez-Infos.
Was in der kursorischen Nacherzählung wie eine Telenovela voll karibischen Tohuwabohus klingen könnte, wird im Roman mit psychologischer Glaubwürdigkeit und Präzision erzählt, wobei durch alle Thrillerspannung hinweg die Traurigkeit übermächtig ist: Seht, scheint der Verfasser Barrera Tyszka seinen Lesern zu sagen, was mit Durchschnittsbürgern geschieht, wenn deren Führung von der Hybris besessen ist, „ein neues Land mit neuen Menschen“ zu schaffen.
DIE GRENZEN VERWISCHEN
Der Einspruch gegen diesen Wahn ist ebenso politisch wie ästhetisch: Je irrer es in jenem Haus Venezuela zugeht, desto kristalliner der Erzählfluss. Tatiana, die Lebensgefährtin des Journalisten Fredy, weiß nämlich nichts von dessen aus finanzieller Not geborenen Eskapaden und muss während seiner Abwesenheit nun selbst kämpfen: Weil das Paar aus Geldknappheit seit Monaten keine Miete mehr gezahlt hat, aufgrund ihres Kindes jedoch per Gesetz nicht zum Verlassen des Apartments gezwungen werden kann, bricht die wohlhabende Besitzerin quasi in die eigene Wohnung ein und macht Tatiana und ihrem Sohn das Leben zur Hölle – paradoxerweise mithilfe von drei Chávez-treuen Slumbewohnerinnen, die sich für derlei inzwischen übliche Aktionen gut bezahlen lassen. Ergo: Der Voluntarismus an der Staatsspitze wuchert metastasengleich ins Gewebe der Gesellschaft, verwischt die Grenzen zwischen Gesetzestreue und Illegalität und bringt – anstatt der vollmundig versprochenen „Solidarität“ – lediglich die archaischsten Raubtiermechanismen wieder zur Geltung.
Die Wohnung, die sich die rechtmäßige Besitzerin auf diese Weise zurückergaunert, gleicht am Ende einem Schlachtfeld, das keine Sieger kennt. Kurz darauf stirbt der unsterbliche Comandante, „dessen verbale Temperatur bei Weitem seine Lebenswirklichkeit überstieg“. Und das vermeintlich explosive Handyvideo? Entpuppt sich als ebenso mythosüberladen wie alles im Umfeld dieses Gauklers. Doktor Sanabrias zynischer Neffe aber vollbringt eine weitere Volte, nun eilfertig an der Seite von Chavéz’ Präsidentennachfolger Maduro.
Währenddessen schreibt der Journalist Fredy, wegen der Heirat vom venezolanischen Geheimdienst gestellt und erpresst, mit noch höherem Vorschuss (und noch größerer Angst) nun ein völlig anderes Buch: der Krebs des Comandante als finstere Verschwörung des Imperialismus. Dieser grandiose Roman, der in keiner Zeile didaktisch ist, taugt gerade deshalb zum Lehrstück: Die innere Leere, die der Aktivismus der Autoritären hinterlässt, kann nur mit neuen Lebenslügen, neuer Niedertracht gefüllt werden. Ein Perpetuum mobile des Schreckens, das aktueller nicht sein könnte.