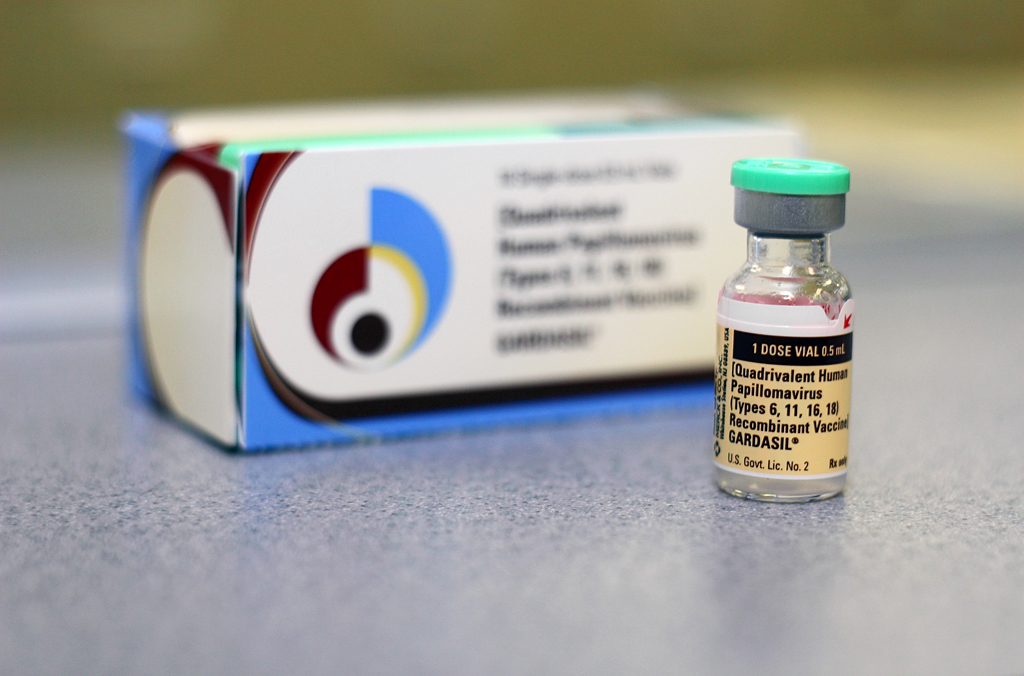Adern der Wahrheit
Vor dreißig Jahren starb in Wien die Schriftstellerin und Kulturpublizistin Hilde Spiel. Eine gutbürgerliche Herzenslinke, die „die Weite der alten österreichischen Monarchie, die noch in uns war“ ohne schönfärberischen Goldrand beschrieb, sondern im Wissen um Niedergang und Verlust. Ihre Geschichten sind vergangen, aber ihr Stoff bleibt ewig aktuell.
Sie ist fünf Jahre alt, als sie von einem Erkerfenster der elterlichen Wohnung in Wien den riesigen Trauerzug beobachtet. Er zieht drüben am Ring entlang. Woran sie sich später ebenfalls erinnern wird: Die Stille und die bedrückten Gesichter der Erwachsenen, in denen bereits die Ahnung aufschien, das an diesem grauen Herbsttag des Jahres 1916 nicht nur der ehrfürchtig verehrte Kaiser Franz Josef zu Grabe getragen wurde, sondern mit ihm eine ganze Welt. Eine Szene wie aus einem Joseph-Roth-Roman auch das nächste Initiationserlebnis jener Hilde Spiel, die im Sommer 1936 dann schon Studentin ist: „Am 22. Juni fuhr ich mit der Elektrischen, dem Einundsiebziger, zur Stadt und blickte zufällig über die Schulter eines Nebenstehenden auf die Schlagzeile seiner Zeitung: `Der Philosoph Moritz Schlick erschossen´“.
Für die junge Frau aus jüdischer Familie, deren Vorfahren bereits Ende des 19. Jahrhunderts zum Katholizismus konvertiert waren, hatte der rational-neoposivistische Denker, ein Gegner jeder scholastischen Spekulation, eine Art intellektueller Vaterstelle eingenommen. „Schlicks naturwissenschaftliche Philosophie hat mich davor bewahrt, mich in einem philosophischen Überbau nach Art von Martin Heidegger zu verirren. Sie hat mich aber auch gegen den Marxismus imprägniert, der ein Gebilde von Konstruktionen war und Regeln festlegte, die nicht beweisbar waren.“
Die austrofaschistische Presse jener Zeit aber bejubelte die Ermordung („Der Jude ist der geborene Ametaphysiker und verdirbt das Edelporzellan des Volkstums“). Hilde Spiel erkannte rechtzeitig, dass in diesem Wien kein Bleiben mehr war. Zusammen mit ihrer Familie und ihrem ersten Mann, dem späteren Thomas-Mann-Biographen Peter de Mendelsohn, übersiedelte sie noch im gleichen Jahr nach London. An all das erinnert sich die inzwischen betagte, ihre Alterskrankheiten tapfer niederringende Dame in ihrer zweibändigen Autobiographie. Teil zwei heißt „Welche Welt ist meine Welt? Erinnerungen 1946-1989“ und erscheint im Herbst 1990, ein Jahr nach den friedlichen Revolutionen im Ostblock.
Keine Etiketten, keine -ismen
Auf der Frankfurter Buchmesse hält Marcel Reich-Ranicki, der schon Anfang der sechziger Jahre Essays von Hilde Spiel rühmend besprochen hatte, die Präsentationsrede. Er erwähnt leicht maliziös auch die Passagen, in denen die Autorin über ihre in England scheiternde Ehe schreibt, über Arrangements zu dritt und einen neuen, mit ihr ebenfalls nicht allein in Monogamie verbundenen Mann. Die Grande Dame der deutschsprachigen Publizistik, quasi ein lebendes Muster an Feinheit, klugem Urteil, Stil und Takt, gar als eine frühe Feministin?
Noch wenige Wochen vor ihrem Tod am 30. November 1990 aber hatte Hilde Spiel dieses Etikett abgelehnt. So wie die gutbürgerliche Herzenslinke ja auch keine Marxistin hatte sein wollen und jedem -ismus distanziert gegenüberstand. Das galt genauso für einen rabiaten Antikommunismus, wie ihn ehemalige Genossen wie Arthur Koestler oder Franz Borkenau vertraten. Ihnen war Hilde Spiel, als Kulturkorrespondentin 1946 temporär auf den Kontinent zurückgekehrt, in Berlin begegnet, wo sie als Filmkritikerin der „Welt“ arbeitete. In Melvin Laskys Zeitschrift „Der Monat“ veröffentlichte sie zudem jene feinziseliert-bildungsgesättigten, aber nie wortklingelnd-schwerblütigen Miniatur-Essays, für die sie berühmt werden sollte. Melvin Lasky, so erinnert sie sich in ihren Memoiren, war es schließlich auch, der sie gegen die üble Nachrede ihres oszillierenden Freundfeindes Friedrich Torberg verteidigte, der versucht hatte, die erzliberale Hilde Spiel als wankelmütige Krypto-Kommunistin zu denunzieren.
Alte Geschichten, ewiges Gespräch
Alte, vergessene Geschichten aus der längst entschwundenen Welt jener jüdischen Intellektuellen, die ihre existentiellen Erfahrungen zumindest im westlichen Nachkriegs-Europa hatten fruchtbar machen können? Ja und Nein.
Die spannenden und bis heute eminent lesbaren Memoiren zeugen ebenso wie die während der Jahrzehnte in zahlreichen Sammelbänden veröffentlichten Rezensionen, Theaterbesprechungen, Essays, Gedicht-Interpretationen und Schriftsteller-Porträts von dem, was Hilde Spiel so wichtig war: Trotz oder gerade wegen der miterlebten Zivilisationsbrüche „the great conversation of mankind“ niemals abbrechen zu lassen, den roten Faden straff zu halten, sich von der Kultur kein Allheilmittel gegen Barbarei zu erhoffen, aber doch darauf bestehen, wie wichtig das unentwegte Vermitteln einer Tradition ist, die stets mehr sein muss als nur traditionell. „Die Weite der alten österreichischen Monarchie, die noch in uns war“ wird bei ihr ohne schönfärberischen Goldrand beschrieben, sondern im Wissen um Niedergang und Verlust.
Erst 1963 war sie aus London nach Wien zurückgekehrt, Anfang der achtziger Jahre ging sie noch einmal für zwölf Monate als Kulturkorrespondentin der FAZ an die Themse. Ihre 1984 erschienenen „Englischen Ansichten“ erinnern nicht zuletzt daran, was „anglophil“ tatsächlich bedeutete, ehe teutonische Wirrköpfe wie Karl Heinz-Bohrer oder, auf der nach unten offenen Skala, Alexander Gauland diesen Ehrentitel zur ungerechtfertigten Selbstbeschreibung kaperten.
Mutiger Verlag gesucht
Vor allem aber würde Hilde Spiels Prosawerk eine Wiederentdeckung lohnen. So etwa der konzise, von eleganter Beschreibungsgenauigkeit zeugende Geschichtenband „Der Mann mit der Pelerine“ oder der bereits Ende der dreißiger Jahre zuerst auf Englisch geschriebene Roman „Flöte und Trommeln“. Er porträtiert eine junge Frau im faschistischen Vorkriegs-Italien, wo sie sich an Kultur und Landschaft nicht sattsehen kann, erotische Erfahren diverser Art sammelt und gleichzeitig spürt, dass die Lebendigkeit längst in einen inhumanen Vitalismus abgekippt ist und auch auf den vorerst in der Espresso-Bar noch willkommenen geheißenen jüdischen Dorfarzt eine schlimme Zukunft wartet. Ein Vergleich mit Georg Hermanns Roman „Der etruskische Spiegel“ böte sich an, aber die an der Neuen Sachlichkeit“ geschulte, präzise sinnliche Diktion Hilde Spiels ist uns Zeitgenossen dann wohl doch näher.
Wie gut, fände sich ein couragierter Verlag für eine Neu-Veröffentlichung, vor allem auch für das literarische Tagebuch „Rückkehr nach Wien“. Hilde Spiel, 1946 in der britischen Uniform eines „war correspondent“ zurückgekehrt in ihre Geburtsstadt, wo sie im Café Herrenhof den alten, aber nicht unbedingt guten „Dämonen der Gemütlichkeit“ wieder begegnet, in den Gesichtern nach den Verbrechen des NS-Zeit forscht, gerührt wieder die alte Tram 71 um die Kurve knirschen hört… – und sich dann erinnert, welch schreckliche Nachricht sie im Sommer 1936 in einem dieser Wagen empfangen hatte.
Hilde Spiel zu lesen bedeutet Beunruhigung und gleichzeitig ein wieder zu entdeckendes Vertrauen in die Kommunikationsfähigkeit der Sprache. Denn nicht nur „die Wahrheit“ ist sagbar, sondern auch die feinen, beinahe unsichtbaren Nuancen, die sie wie Adern durchziehen.