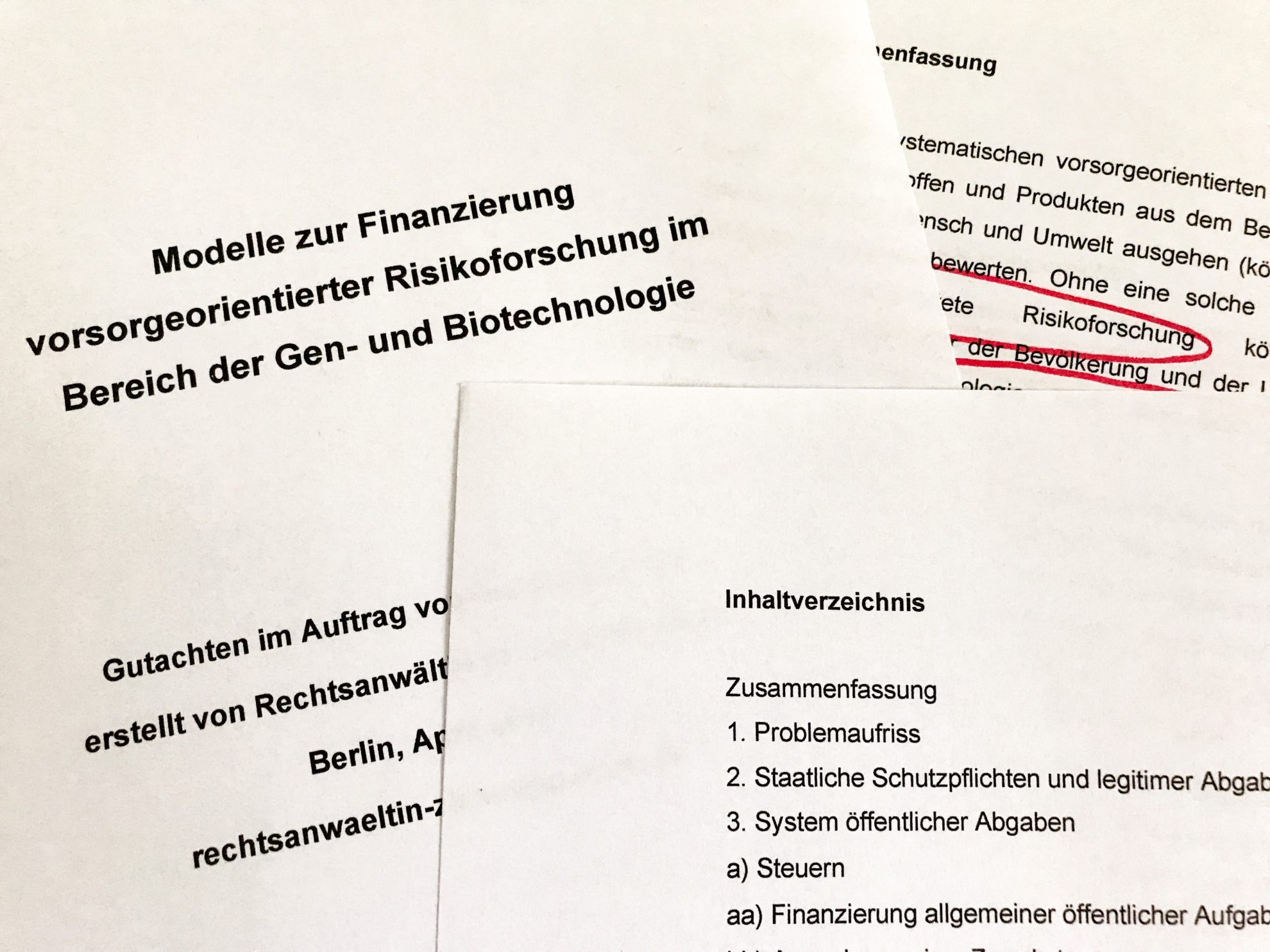Für dem Recht auf Dummheit!
Demokratie ist die überlegene Staatsform, tut aber manchmal weh. Trotzdem sollten wir dem Einzelnen das Recht lassen, dumm zu sein.
Die meisten Gedankenexperimente machen Spaß, aber Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Zu deren bekannteren zählt das sogenannte Trolley-Problem, das als Paradebeispiel eines moralischen Dilemmas inzwischen im Internet zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob durch das Umleiten einer außer Kontrolle geratenen Straßenbahn („Trolley“) auf ein Gleis mit einer dann todgeweihten Person das Leben einer größeren Anzahl von Menschen auf dem ursprünglichen Weiterfahrgleis gerettet werden darf oder nicht. Bezogen auf dieses Grundmuster existieren unzählige Variationen und Ergänzungen, die Idee bleibt immer dieselbe. Sie klingt vielleicht ein wenig konstruiert, ist tatsächlich aber alles andere als wirklichkeitsfern, wie etwa die intensive Debatte um den fernsehgerecht aufbereiteten Moot Court „Terror – Ihr Urteil“ jüngst wieder gezeigt hat.
Auch ohne den Life-or-Death-Aspekt begegnen uns solche schwer auflösbaren Gegensätze täglich. Im Rahmen der Podiumsdiskussion zur Eröffnung dieser Blogplattform stellte etwa der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt die unangenehme Frage, ob die freiheitliche gesellschaftliche Mitte einen Wähler der AfD einem Nichtwähler moralisch vorzuziehen habe. Für beides lassen sich Argumente finden, denn während der Nichtwähler durch seine persönliche Enthaltung die Legitimität der Wahl und damit mittelbar des die Wahl erfordernden demokratischen Systems untergräbt, erreicht der AfD-Wähler dasselbe gerade durch seine Wahlentscheidung oder strebt dies zumindest oft an. Was also ist unter dem Strich schädlicher?
Reichelt erklärte sich schließlich dahingehend, dass die Indifferenz gegenüber dem demokratischen Diskurs die Wahlenthaltung seiner Meinung nach knapp zur ablehnungswürdigeren Entscheidung mache. Dieser Einschätzung kann man auch und gerade als Gegner der „Alternative“ nur vollauf beipflichten, weil sie zwei wertvolle und wichtige Botschaften aussendet.
Zum Einen schwingt in ihr die Überzeugung mit, dass ein starkes demokratisches Gemeinwesen auch einen so fragwürdigen Verein wie die AfD aushalten und überleben kann, so wie sie selbst in wesentlich schwierigeren Zeiten schon ganz andere Angriffe ausgehalten hat. Kaum einer weiß zum Beispiel noch, dass der erste Bundestag nicht weniger als neun Fraktionen umfasste, deren Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht durch die Bank weg unhinterfragbar war. Verbote antidemokratischer Parteien wie der Sozialistischen Reichspartei (1952) und der KPD (1956) folgten erst später. In den Jahrzehnten danach saßen Rechtsradikale und -extreme Gruppierungen wie NPD, DVU, Republikaner oder Schill-Partei immer wieder in zahlreichen Landtagen, in denen sie mal mehr, mal weniger nervenschonend für die anderen Fraktionen eingehegt wurden. Den ganz großen Sprung hat keine von ihnen geschafft. Ein Einzug der AfD in den Bundestag wäre zwar eine andere Situation, aber von siebzig bis achtzig AfD-Abgeordneten in Berlin würde das parlamentarische System auch nicht untergehen. Zumal man jedem einzelnen „Alternative“-Wähler im Zweifel vorhalten kann, dass er mit seiner Stimmabgabe (wenn auch vielleicht nicht mit seiner Stimme) dem „System“ Legitimität verschafft hat. Sicher würden wie schon nach den Landtagswahlen in diesem Jahr viele politische Kommentatoren die gestiegene Wahlbeteiligung nur eher schmallippig kommentieren, aber genau darin liegt eben unser demokratisches Trolley-Dilemma.
Was zum noch wichtigeren zweiten Punkt führt: Eine Wahlentscheidung für die AfD ist in vielerlei Hinsicht nicht klug. Das Spitzenpersonal der Partei ist zerstritten, ihr Programm weitgehend unausgegoren, die Außenwirkung der Wahl für die jeweilige Region verheerend. In Ländern, in denen die AfD bereits Abgeordnete stellt, fallen diese kaum durch besonders überlegte und konstruktive Beiträge im parlamentarischen Diskurs auf. Aus politisch mittiger Sicht ist eine Stimme für die AfD also einigermaßen dämlich. Indem wir den AfD-Wähler trotzdem mehr schätzen als den Nichtwähler, schützen wir jedoch ein absolut zentrales, so nur in der liberalen Demokratie zu findendes Recht: Das Recht auf Dummheit. Oder, etwas weniger plakativ ausgedrückt, das Recht auf die falsche Wahl.
Die Überzeugung, dass jeder Mensch für sich selbst Entscheidungen treffen darf, und zwar ausdrücklich auch falsche oder schädliche, ist einer der Eckpfeiler liberalen Denkens. Nur wer schließlich eine freie Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten hat, kann überhaupt erst in die Verlegenheit geraten, sich falsch oder dumm zu entscheiden. Dieser Gedanke weist über die politische Wahl als solche hinaus und reicht bis in den Alltag. Der niedersächsische FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg Bode fasste das Konzept kürzlich im Rahmen einer Landtagsdebatte so zusammen: „Ich trinke Rotwein und esse Schokolade, weil ich es will!“ Natürlich weiß Bode, dass Schokolade dick und Alkohol dumm machen, aber er konsumiert sie trotzdem. Er gab an gleicher Stelle auch noch zu verstehen, dass er gerne Auto fährt, obwohl er zweifellos ebenso weiß, dass es unter bestimmten Umständen klüger sein kann, das bleiben zu lassen. Nur, wer will schon ewig leben? Und warum sollte ich als Individuum anderen die Entscheidung darüber überlassen müssen, ob ich lieber vegan ernährt, kerngesund und gertenschlank sterbe oder an einer Überdosis Big Mäcs?
Es können in Anbetracht dieser Überlegungen nur solche Zeitgenossen Zuckersteuern oder Warnhinweise auf Zigarettenschachteln befürworten, die anderen Menschen die moralische Eignung oder intellektuelle Fähigkeit zur eigenen Entscheidung absprechen. Das ist schon im Alltag nicht ohne, aber wer so denkt, der darf fettleibige Betrunkene dann konsequenterweise auch nicht mehr an allgemeinen Wahlen teilnehmen lassen, nicht zuletzt, weil diese sogenannten Dummen daraufhin mit einigem Recht die Frage stellen könnten, wer eigentlich definieren darf, was dumm ist – das politische System, das sie ausschließt, ja wohl kaum. Egal also, wie viel (Wahres) man über Nanny-Staat und ausuferndes Nudging sagen kann, ein demokratischer Staat muss seinen Bürgern die Entscheidungsfähigkeit in der Wahlkabine selbst dann zutrauen, wenn er ihnen die Fähigkeit zur korrekten Kaufentscheidung im Supermarkt abspricht. Tut er das nicht, hört er auf, eine Demokratie zu sein – und so weit möchte auch in Berlin trotz aller Nährstoffampeln und Paternosterführerscheine selbstverständlich niemand gehen.
Viel entscheidender ist demgegenüber die Fähigkeit unseres politischen Gemeinwesens insgesamt, die individuelle Dummheit durch systemische Ausgleichsmechanismen zu mäßigen und beim Legitimationstransfer auf die repräsentative Ebene entscheidend abzuschwächen. Das kann unser System trotz aller Nachteile ziemlich gut. Zwar kann keine Demokratie auf Dauer überleben, wenn alle ihre Wähler sie abschaffen wollen, aber solange wir nur von einer lauten, aber überschaubaren Minderheit sprechen und Checks and Balances die Ausläufer der Glockenkurve auf Bedeutungsgröße zurechtstutzen, sollte die mittige Mehrheit schon die nötige durchsetzungsstarke Gelassenheit mitbringen, um sich nicht verrückt machen zu lassen und mit dem angemessenen Selbstbewusstsein aufzutreten. Der Ausgleich polar entgegengesetzter Positionen ist schließlich genau der Witz an der repräsentativen Demokratie, der die Querfrontfraktion nicht ohne Grund ständig irgendwelche „volksdemokratischen“ Fantasien entgegenstellt. Diese Vorschläge stehen in bester autoritärer Tradition der antiparlamentarischen „Quasselbude“-Vorwürfe von rechts und links aus den Zeiten der Weimarer Republik. Wer sich aber dagegen wendet, dass eine Regierung den kollektiven „Volkswillen“ erspüren soll und lieber dem Einzelnen seine Möglichkeit zur Wahl belässt, der muss stets dafür Sorge tragen – und fest davon überzeugt sein – dass der Parlamentarismus jedes auch noch so dumm zusammengestellte Parlament überdauern kann.