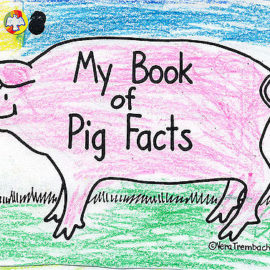L.A. Chronicles I: „Living the dream“ – Schießen an der Westküste
Pass abgeben, Formular ausfüllen und schon kann man in L.A. mit einer Kriegswaffe losballern.
Als „Bild“-Reporter darf ich gerade ein paar Monate in L.A. verbringen. Die ersten Tage hatte ich frei und habe sie sinnvoll genutzt. Zunächst habe ich mich von einem freundlichen Kanadier auf dem Basketballplatz am Venice Beach, auf dem „White Men Can’t Jump“ mit Woody Harrelson gedreht wurde, zwei Mal 7:1 abziehen lassen. Verlieren bildet den Charakter.
Dann bin ich mit Kollegen zur LAX Firing Range nahe dem gleichnahmigen Flughafen gefahren. Das X ist dort im Logo zu einem Fadenkreuz stilisiert. Als Junge hatte ich öfters mit einem Luftgewehr rumgeschossen, mit einer scharfen Waffe aber nur einmal mit einem Jäger im Wald.

Die Schießhalle in einem Industriegebiet nahe des Flughafens
Bei Troy, Mitte Zwanzig, Vollbart, geben wir zunächst unsere Reisepässe ab und füllen mit den Handys online Formulare aus, auf denen wir versichern, keine mentalen Defekte zu haben und nicht vorbestraft zu sein. Unsere Wartezeit beträgt eineinhalb Stunden, die Schießhalle mit zehn Ständen ist gut ausgebucht. Ein Opa zeigt gerade seinem etwa neunjährigen Enkel, wir man mit einer AR15 schießt, das ist das amerikanische Infanterie-Gewehr M16 ohne Dauerfeuer.
Ein Kunde fragt Troy, wie es ihm geht. „Living the dream!“, sagt er. Troy hat Humor.

Troy erklärt uns die Sig Sauer
Wir holen uns um die Ecke stilecht Donuts mit Zimt-Apfel-Füllung, laufen ein wenig durch ein Industriegebiet. Dann endlich sind wir dran. Troy empfiehlt uns ein bisschen wie ein netter, gut informierter Kellner in einem Restaurant für den Anfang eine 9-Millimeter-Handfeuerwaffe. „Ihr könnt aber auch alles andere nehmen!“, sagt er. In der Ecke steht eine Kalaschnikow.
Andere Kunden bringen ihre eigenen Waffen mit. Ein großer, kräftiger Mann schießt mit seiner Frau mit einem Maschinengewehr, das so schwer ist, dass es auf einer dreiarmigen Vorrichtung liegen muss.
Wir bestellen als Vorspeise für 18 Dollar die Stunde eine deutsche Sig Sauer und für 30 Dollar 100 Schuss Munition. Dazu kommt eine stündliche Standmiete von zehn Dollar.
Innerhalb von zwei Minuten erklärt Troy uns die Waffe. Man darf sie nicht im Bereich des Schlittens halten, da der einem sonst beim automatischen Neuladen die Hand aufreißt. Es gibt keinen Sicherungshebel. Wenn man noch nicht schießen will, sollte man den Zeigefinger entlang des Laufes legen. „Okay, jetzt könnt ihr loslegen“, sagt er und gibt uns das Tötungsgerät in die Hände.
Wir schießen los. Ich habe als Papier-Ziel einfache, runde Scheiben genommen, mein Kollege Zombies, die eine blonde Frau angreifen.

Der Kollege schießt auf Zombies
Als ich dran bin und das Magazin mit den Kugeln laden will, zittern meine Hände. Neben mir höre ich trotz Ohrenschutz sehr laut die Schüsse aus den Nachbarständen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Was wäre jetzt, wenn einer von den Nachbarn durchdrehen würde? Man trägt zwar ein, dass man keine Vorstrafen habe und keine mentalen Defekte. Aber das ist eine von Troy eher schwer zu überprüfende Selbstauskunft. Jede der 30-Cent-9-Millimeter-Kugeln könnte ein Leben auslöschen.
Mit zittrigen Fingern drücke ich die kupferfarbenen Kugeln in das Magazin, es dauert lange. Ich erinnere mich an Filme, bei denen das auch passiert. Der Bösewicht kommt näher, die Kugeln wollen nicht ins Magazin, purzeln herunter.

Das Beladen des Pistolenmagazins kann eine zittrige Angelegenheit sein
Nun hebe ich die Waffe, fixiere das Ziel zwischen Kimme und Korn und drücke nach ein paar Sekunden ab. Meine Hände schnellen vom Rückschlag nach oben. Aber das Gefühl ist nicht unangenehm, der Schuss mit dem Gehörschutz nicht unmenschlich laut. Mit Luftpistolen hatte ich zuvor im Gegensatz zum Luftgewehr fast nie geschossen, ich schieße ganz okay. Aber auf weite Entfernung führen aufgrund des kurzen Laufes kleinste Zitterbewegungen dazu, dass die Kugeln neben den runden Scheiben einschlagen.
Als wir unsere 100 Schuss verballert haben, überlegen wir aufzuhören. Neben uns zeigt gerade ein junger, sympathischer Amerikaner seiner hübschen Freundin auf einer Zielscheibe, auf der ein menschlicher Körper abgebildet ist, wie sie Kopfschüsse machen soll. Vielleicht ist es jetzt genug, denke ich.

Salonkolumnist beim Schießen
Dann holen wir uns doch noch eine AR15. Dafür zahlen wir noch einmal acht Dollar drauf und für 50 Schuss 21 Dollar. Troy erklärt uns wieder die Regeln. Bei diesem Gewehr muss man die Mündung stets über dem Kopf halten, wenn man rumläuft. Es gibt einen Sicherungshebel, den man vor dem Abdrücken umlegen muss. Die Zielvorrichtung ist ein kleines Loch, das man mit mit dem Korn übereinstimmend auf das Ziel halten soll.
Das Gewehr ist überraschend leicht, schließlich ist der Schaft aus Kunststoff, so dass amerikanische Soldaten es im Vietnamkrieg „Mattel“ nannten wie den Spielzeughersteller.
Zunächst schieße ich aus naher Distanz, etwa aus acht Metern Entfernung überraschend schlecht, schlechter als mit der Pistole. Dann fahre ich das Ziel ganz nach hinten auf 25 Meter Entfernung. Nur verschwommen sehe ich die runde, kleine rotgelbe Zielscheibe hinter der Zielvorrichtung und drücke ab. Jetzt schieße ich gut. Das Luftgewehrschießen als Junge hat sich in dem Sinne gelohnt. Von meinen letzten fünf Schüssen treffe ich fünf in die gelbe Mitte. Eine Distanzwaffe.
Stolz erzähle ich beim Bezahlen Elliot (28) davon, der auch auf dem Schießstand arbeitet und auch einen Vollbart trägt. Er erzählt, dass man die AR15 von 400 bis 5000 Dollar beim Händler kaufen kann, je nach Qualität der Bauteile. Er hat zwei AR15s, eine einfache für 500 Dollar und eine aus edlen Einzelteilen zusammengebaute für 2500. Meine 25-Meter-Schüsse sind eigentlich nichts Besonderes. „Gute Schützen können damit auf 400 Metern Entfernung treffen“, sagt er.
Elliot hat vor zwei Jahren seine Dienstzeit bei der US-Elitetruppe, den Marines, beendet, erzählt er. Er ist immer noch sehr gut trainiert. Das Training dort soll fast unmenschlich hart sein. Ein flüchtiger Bekannter, den ich mal auf einem Hosteldach in Tel Aviv kennenlernte, war selbst im Marine-Trainingsprogramm gewesen. Er erzählte von systematischen Schlafentzug, extremen körperlichen Strapazen. Irgenwann war von einem Sprung sein Knie durch, so dass er aufhören musste.
Elliot stand dieses Training durch, war in Afghanistan, im Irak, in Todesgefahr. Jetzt hat er seit zwei Monaten diesen Job auf dem Schießstand. Ich finde es ein bisschen traurig, dass dieser Mann, der in seinem Gebiet Topleistungen verbracht hat, jetzt Waffenidioten wie mir das Schießen erklären muss.
Wieder auf der Straße halte ich stolz meine Schießscheibe in die Sonne. Doch, es hat Spaß gemacht, mich hat das Ganze 55 Dollar gekostet. Den Rest des Tages bin ich ziemlich agressiv.

Die letzten fünf Kugeln landeten im Gelben
Sig Sauer-Schuss in Zeitlupe: