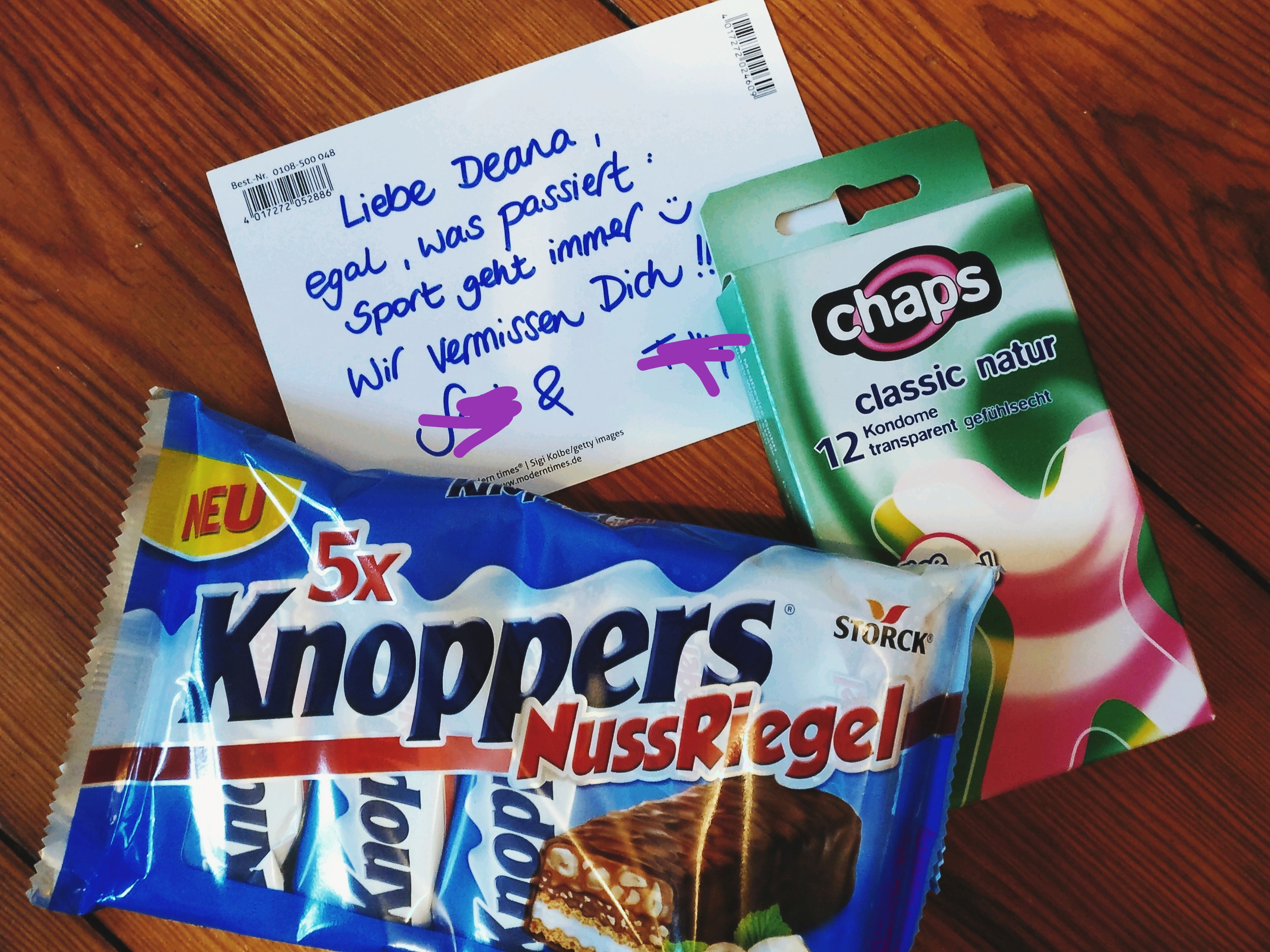Bremst die Entschleunigung!
Veränderung in atemberaubendem Tempo hat uns an den Rand des Untergangs gebracht. Die Rettung liegt deshalb in der Entschleunigung. Diese These ist allgegenwärtig – aber völlig falsch. Was wir spüren, ist kein Tempo, sondern höchstens Hektik. Und sie ist der Preis für eine Bummelei, die nicht nur Gestaltungskraft kostet, sondern auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik untergräbt. Ein Gastbeitrag von Johannes Mellein.
Deutschland rast in den Untergang. Die Gesellschaft verändert sich so dramatisch, dass die Menschen kaum noch mitkommen. Heißt es. „Wer sich gewissermaßen an etwas festhält, der droht stehenzubleiben, abzurutschen, zurückzufallen”, warnt etwa der bekannte Soziologe Heinz Bude. Die Folge: „Angst rieselt in die Poren der Gesellschaft.“ Sybille Berg zeichnet die apokalyptischen Reiter inzwischen sogar wie Rennfahrer. „Es ging absurd schnell, die Hälfte aller Spezies auszurotten, das Klima zu verändern, die Flüsse und Meere zu verdrecken. Exponentielles Wachstum. Geschwindigkeit, Leistung.“
Der Ausbruch des Coronavirus wird da als willkommener Anstoß gedeutet, es endlich wieder langsam angehen zu lassen. „Wir haben dringend eine Atempause gebraucht“, erklärte etwa der Philosoph Wilhelm Schmid im Interview mit der ZEIT. Auch der Zukunftsforscher Matthias Horx prophezeit erleichtert, das Virus werde zu einer „Entschleunigung der Menschheit“ führen. Von der Zunahme psychischer Erkrankungen über Umweltschäden und Klimawandel bis hin zur Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen und dem Aufstieg des Rechtspopulismus: Die Diagnose lautet Beschleunigung.
Aber stimmt das überhaupt? Leben wir wirklich in einer beispiellosen Ära der Kurzlebigkeit, der gesellschaftlichen Umwälzungen, des rasenden technologischen Fortschritts? Und wirft uns der wirklich aus der Bahn? Brauchen wir ein Tempolimit für Veränderung?
Es lebe das Gefühl
Das Zeitalter der Moderne war zweifellos mit atemberaubenden Beschleunigungserfahrungen verbunden. Während des 19. Jahrhunderts revolutionierten Eisenbahn, Telegraf und Dampfschifffahrt die Geschwindigkeit, mit der Mensch und Information um den Globus zirkulieren konnten. Automobil, Telefon und Luftfahrt sorgten an der Schwelle des 20. Jahrhunderts für weitere Temposchübe. Hinzu kamen Erfahrungen von Krieg, Massenmigration, sozialer Mobilität und die beginnende Kulturrevolution der Geschlechterrollen. Auch eine erste Welle der Globalisierung gab es bereits vor dem Ersten Weltkrieg, die damaligen Handelsvolumina wurden erst in den 1970er Jahren wieder erreicht. Dass unsere Großeltern und Urgroßeltern frei von Beschleunigungstraumata gelebt hätten, ist also schon einmal erkennbar Unsinn. Aber jede Generation schaut bekanntlich vor allem auf den eigenen Nabel. Allein: Was sehen wir da?
Im Deutschland des Jahres 2020 beruht praktisch der gesamte Verkehrssektor auf Technologien des frühen 20. Jahrhunderts. Auf Straßen, Schienen und über unseren Köpfen bewegt sich kaum etwas fort, was es in seiner Grundform nicht schon vor 100 Jahren gegeben hätte. Die meisten Deutschen wählen in unterschiedlicher Version konservativ und bevorzugen abhängige Lohnarbeit gegenüber der Selbstständigkeit – wie ihre Eltern und Großeltern. Ein normaler deutscher Arbeitstag dauert seit 1918 acht Stunden, bei seit 1974 etwa 40 Stunden Wochenarbeitszeit. Zentrum des Alltags bleibt die Familie, die Geburtenrate ist seit Mitte der 1970er weitgehend konstant. Einwanderung ist Normalität, als im Herbst 1964 der Millionste Gastarbeiter nach Deutschland kam, wurde er feierlich begrüßt und mit einem Moped beschenkt.
Selbst die Digitalisierung hat graue Schläfen bekommen: PC und Internet sind seit einer Generation Alltag in deutschen Büros. Der einzige namhafte deutsche Digitalkonzern, SAP, feierte vor Kurzem seinen 50. Geburtstag. Allgemein ist das Tempo bei der Digitalisierung zum Gähnen. Ein Experte verglich die Liste der DAX-30-Titel jüngst mit einem „Industriemuseum”. Gegen den Befund einer Nation mit Schwindelgefühlen spricht nicht zuletzt die Tatsache, dass sich die Lebenszufriedenheit der Deutschen auf einem historischen Höhepunkt befindet.
Make Stagnation great again
Das mögen oberflächliche Eindrücke sein, aber sie haben eine feste Basis. In seiner faktengesättigten Langzeitstudie „The Rise and Fall of American Growth“ (2016) entwickelt der amerikanische Ökonom und Wirtschaftshistoriker Robert J. Gordon die These, dass der Fortschritt lahmt. Verglichen mit der Zeit zwischen 1870 und 1970 sei die Gegenwart eine Epoche der Stagnation. Gerade der vielbeschworene Wandel der alltäglichen Lebensumstände habe sich enorm verlangsamt. Selbst digitale Technik könne es nicht mit Alltagsrevolutionen wie Kraftfahrzeugen, Elektrogeräten und sanitären Anlagen aufnehmen. Damit steht der Forscher aus Illinois in scharfem Gegensatz zur Selbstvermarktung einiger Tech-Aristokraten aus dem Silicon Valley. Prominente Fachkollegen wie der Nobelpreisträger Paul Krugman halten Gordons Thesen dagegen für plausibel.
Vielleicht fußt die zeitgenössische Beschleunigungskritik also weniger auf dem Tempo des Wandels, sondern mehr in einer kulturell gewachsenen Skepsis gegenüber Veränderungen allgemein? Unter Publizisten und Kulturschaffenden gibt es eine Tendenz, Veränderungsprozesse primär als Verlustgeschichten zu erzählen. Ob Ostseetunnel, Wohnungsneubau oder Wiedervereinigung: Verlorenes wird betrauert, Veränderung macht Verlierer. Der polnische Soziologe Zygmunt Bauman prägte den Begriff „Retrotopia“, um auszudrücken, wie in unserer Zeit die Vergangenheit idealisiert wird. Hier besteht eine bemerkenswerte Analogie zum Rechtspopulismus und seiner politischen Nostalgie, kumuliert in dem wieder aufbereiteten Slogan „Make America great again!” Auch das lagerübergreifende Comeback des Heimatbegriffs weist in diese Richtung. Die Überforderung, die noch jede Generation gefühlt hat, wird zelebriert und sentimentalisiert.
Politik im Schongang
Entschleunigung soll eine Schlüsselrolle bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Lebensweise einnehmen. Aber die politische Praxis zeigt, dass sich das Konzept ebenso für Strukturkonservatismus und plattestes „Nimby”-Denken in Stellung bringen lässt. „Entschleunigung” ist der Kampfbegriff gegen Autobahnen, SUVs und Inlandsflüge, aber eben auch gegen klimapolitisch einwandfreie Schnellzugstrecken oder leistungsfähige Mobilfunknetze. „Protest ist angesagt: Entschleunigen – nicht beschleunigen” kann man auf der Internetseite des Dachverbands der Anti-Windkraft-Initiativen „Vernunftkraft” lesen. Selbst in den Bekennerschreiben zu den Anschlägen auf den Berliner ÖPNV wird ausgiebig über „Entschleunigung” philosophiert. Von Ökoaktivisten über Linksextremisten bis zum fanatisierten Frührentner kann jeder zum Helden werden, der dem monströsen Rad der Beschleunigung in die Speichen fällt.
Für die Gewählten wird das zum Dilemma: Sie sollen Probleme lösen und Veränderungsprozesse anstoßen, aber irgendwie auch alles beim Alten lassen. Die einfache Wahrheit, dass es keinen Fortschritt ohne Verlusterfahrungen gibt, ist ein so heißes Eisen geworden, dass die Politik zirkusreife Verrenkungen vornimmt, um gar nicht erst den Eindruck zu erwecken, irgendjemand könnte etwas verlieren. In diesem Sinne hat die Bundesregierung bei der Benennung ihrer Innovationsagentur alle Begriffe vermieden, die für Argwohn sorgen könnten. Auf dem Klingelschild steht nichts von Veränderungen oder gar „Disruption“, sondern: „Agentur für Sprunginnovationen“. Als Forscher des IWH in Halle mit guten Argumenten für den beschleunigten Ausbau urbaner Zentren eintraten, anstatt Dörfer in strukturschwachen Regionen zu retten, gab es aus der Politik empörte Reaktionen. Selbst die Co-Chefin der Grünen erklärte im Interview zum Thema Automobilindustrie, dass „Brüche” vermieden werden müssten.
Für die Brüche sorgt schließlich der Amerikaner. Vielleicht ist die Aversion gegen Geschwindigkeit auch deswegen so ausgeprägt, weil sie als Teil einer fremden Wirtschaftskultur wahrgenommen wird. Bei den Protesten gegen den Elektroautobauer Tesla in Grünheide vermischt sich das modische Entschleunigungsdenken mit einer guten Portion Antiamerikanismus.
Allzu leicht fällt so die harte Wahrheit unter den Tisch, dass es nicht deutsches Vorsorgedenken oder schwäbische Ingenieurskunst waren, die die überfällige Wende zum emissionsfreien Individualverkehr eingeleitet haben, sondern die Start-Up-Kultur Kaliforniens. Eine trostlose Variante der internationalen Arbeitsteilung, an die sich die Deutschen zunehmend gewöhnen: Innovationen kommen aus dem Ausland, deutsche Politiker schützen und bremsen. Am Ende könnte es uns damit ähnlich ergehen wie dem Möbius in Dürrenmatts „Die Physiker“. Der scheinbar kluge Verzicht mündet in den totalen Kontrollverlust. Während hier die Ethikräte tagen, lernen die Pioniere aus ihren Fehlern, setzen Standards und schaffen Pfadabhängigkeiten. Das ebenso verzweifelte wie verspätete Streben Europas nach digitaler Souveränität spricht jedenfalls Bände.
Hektik ist der Preis für zu viel Bummelei
Dabei gehört die Vorstellung, dass Langsamkeit für mehr Sicherheit sorgt, spätestens seit der Coronakrise dringend hinterfragt. Die Pandemie hat vor Augen geführt, wie digitale Strukturen die Resilienz gegenüber externen Schocks erhöhen. Zoom, Skype und Co. haben die Gesellschaft zusammengehalten, als physischer Kontakt unmöglich wurde. Ein Befund, der im krassen Gegensatz zu der Spaltungs- und Risikosemantik steht, die die Deutschen sonst mit der Digitalisierung verbinden. Wie viele Unterrichtsstunden, wie viele Jobs, wie viele Menschenleben wären noch zu retten gewesen, wenn längst vorhandene Technologie schneller zum Standard geworden wäre? Die Flaschenhälse vor 2020 waren weder Technik noch Geld, sondern Gesetze und Mentalitäten. Am Ende hat Corona dem Land einen Innovationsschub aufgezwungen – besser wäre es gewesen, wir hätten uns freiwillig und vor allem schneller digitalisiert. Vielleicht könnten wir sogar noch mehr gewinnen, wenn wir als Gesellschaft einen Zahn zulegen würden: Hin zu einer leistungsfähigen und emissionsarmen Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel.
Die Bundesregierung möchte, dass bis 2030 doppelt so viele Menschen IC und ICE fahren. Die Grünen versprechen sogar, den Bahnverkehr so stark auszubauen, dass Inlandsflüge bis 2035 obsolet werden. Das Problem dabei: Von der Planung bis zur Inbetriebnahme neuer Verbindungen vergehen in Deutschland mittlerweile Jahrzehnte, weshalb diese Zielvorstellungen reine Luftschlösser sind. Im Moment gelingt es nicht einmal, das vorhandene Eisenbahnnetz im Zeitplan zu elektrifizieren.
Im Deutschland des 21. Jahrhunderts ist Planungsbeschleunigung das Thema für alle Infrastrukturprojekte. Die Langsamkeit kostet nicht nur Gestaltungskraft, sondern untergräbt auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit demokratisch gewählter Akteure, weil selbst gesteckte Zielmarken fortwährend gerissen werden. Der große Zeitdruck, unter dem die Dekarbonisierung nun durchgeboxt werden soll, ist nicht zuletzt die Folge jahrzehntelanger Bequemlichkeit. Wie im Alltagsleben ist es meist die Bummelei zur falschen Zeit, die am Ende für Hektik sorgt.
Was wäre, wenn das fehlende Vertrauen, ja die Gereiztheit, die viele politische Beobachter diagnostizieren, gar kein Kollateralschaden einer irgendwie gearteten Beschleunigung wäre, sondern das genaue Gegenteil: Frustration über deren Ausbleiben? Resultat des lähmenden Gefühls, dass sich wenig bewegt, egal welche Partei man wählt oder wie oft man demonstrieren geht? Kurz: die logische Konsequenz eines immer geringeren politischen Wirkungsgrads? Sollte dem so sein, gösse die Politik mit ihren Schutzversprechen und ihrer Konsens- und Stabilitätsorientierung weiteres Öl ins Feuer, statt es zu löschen. Sie träte als Bremser auf, obwohl sie dringend als Beschleuniger gebraucht würde.
Der Entschleunigungsdiskurs vergiftet die politische Kultur, indem er jeden Gestaltungswillen verdächtig macht, der über das Bewahren und Wiederherstellen hinausgeht. Wandel oder Schongang – gerade die Parteien des linken Spektrums werden sich entscheiden müssen, auf welcher Hochzeit sie wirklich tanzen wollen. Jede Form der Modernisierung, besonders die ökologische, erfordert Veränderungsbereitschaft. Und die wird nicht größer, wenn man Menschen einredet, sie seien erschöpft, überfordert und hätten ein heiliges Recht auf den Status-Quo.
Johannes Mellein hat Geschichte, BWL und Jura studiert. Obgleich Historiker, gilt sein Interesse der Zukunft: Neben der beruflichen Tätigkeit als Referent für Umwelt- und Wirtschaftspolitik schreibt er für Magazine und Blogs zum Thema Veränderung.