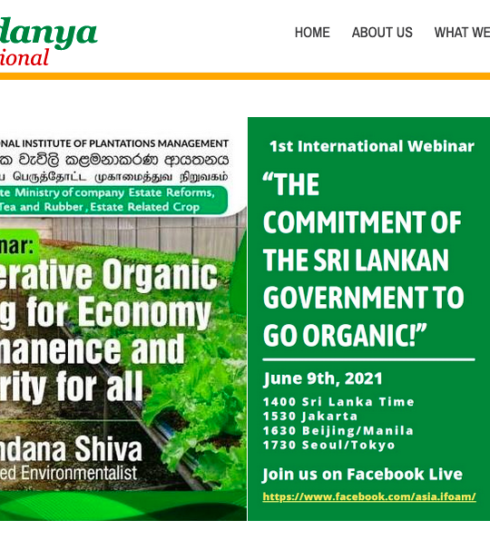Der „Sonstige“
György Dalos erhielt im März den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. Marko Martins Laudatio auf der Preisverleihung reichen wir hier in voller Länge nach.
Lieber György Dalos, liebe Gäste, verehrte Anwesende,
der nach dem Namen eines renommierten deutschen Schriftstellers und Militarismuskritikers benannte Preis geht dieses Jahr an den nicht minder renommierten ungarischen Dissidenten, den Romancier, Historiker und Essayisten György Dalos. In diesem Stil, Verbindungen aufzeigend und Traditionen der Machtkritik beleuchtend, ließe sich fortfahren. In erbaulichem Vortrag dem Guten, Wahren und Schönen huldigend, das als idealistische Trias ja sogar weiterwirkt in der hehren Rede von „Geist versus Macht“. So könnte das in den für eine Laudatio zugestandenen zwanzig Minuten weitergehen, und es wäre nicht einmal falsch. Gewiss nicht mit Blick auf jenen Heinrich Mann, der das autoritäre Kaiserreich kritisiert und die Weimarer Republik verteidigt hatte, ehe er, in schon fortgeschrittenem Alter und unter Lebensgefahr, aus Berlin fliehen musste nach Frankreich und von dort über Spanien und Portugal weiter in die Vereinigten Staaten. Und natürlich auch nicht falsch in Bezug auf György Dalos, 1943 in Budapest geboren, potentielles Opfer des Holocaust, in dem auch Mitglieder seiner Familie ermordet worden waren, späterhin dann als oppositioneller junger Literat angeklagt und verurteilt, Insasse schließlich auch in den Gefängniszellen jenes János Kádár’schen Nach-56er-Ungarn, dessen huschige Bezeichnung als „lustigste Baracke im sozialistischen Lager“ schon damals in die Irre führte.
Wie viel Humanistisches und natürlich auch Warnendes ließe sich dazu sagen – und wie viel aus falsch verstandener Pietät verschweigen. Da die Geschichte der Macht doch kaum zu erzählen wäre ohne jene Lobhudeleien durch den „Geist“. Als bis heute unverdauliche Kostprobe: „Als größter Realist unter den öffentlichen Männern hat Stalin sich der widerstrebenden Mitwelt herausgestellt. Gerade er verzichtet am wenigsten auf den Rang eines Intellektuellen. Eher noch ließe er seinen Marschallstitel fallen.“ So Heinrich Mann in seinen 1944 abgeschlossenen Aufzeichnungen „Ein Zeitalter wird besichtigt“, in denen darüber hinaus die Moskauer Prozesse, ja selbst der Hitler-Stalin-Pakt belobigt werden.
Gegen die großen Linien
György Dalos hingegen erzählt in „Kurzer Lehrgang, Langer Marsch“, seiner bereits 1985 erschienenen literarischen Dokumontage, u. a. auch von eben dem: Von intellektueller Hybris, vom Fatalen und letztlich Dehumanisierenden eines Denkens und Schreibens in „großen Linien“ und „politischen Lagern“ – wohlgemerkt als Kritik in eigener Sache. Nicht zu vergessen „Neunzehnhundertfünfundachtzig“, seine satirische George-Orwell-Fortschreibung von 1982, in der ebenfalls allzu schmeichelhafte intellektuelle Selbstbilder geradezu lustvoll zerzaust werden.
Vor allem aber ist da das unbändige, das spöttische, ja sarkastische Lachen von Tamás Cohen. Denn wie von György Dalos sprechen, ohne jenen Tamás Cohen zu hören und zu sehen, den Anti-Helden aus seinen zwei im besten Wortsinn umwerfenden Gesellschaftsromanen „Der Versteckspieler“ und „Seilschaften“? Denn von wegen „Geist versus Macht“, wie es ihm die Edel-Heuchler in den staatlichen Kulturorganisationen, aber auch so manche Wortführer in den Oppositionszirkeln anpreisen. Nebbich! Wo doch auch die Macht sich mitunter geistreichelnd gibt – in trockener Täter-Humorigkeit oder mit dem Kaugummiwort der „Dialektik“ – und auch der sogenannte Geist durchaus machtlüstern sein kann: im vermessenen Wunsch, die Herrscher auf den „richtigen Weg“ zu lenken oder auch nur in rhetorisch überdrehten Momenten bei spätnächtlichen Oppositions-Debatten. Der junge Tamás Cohen streift im Budapest der sechziger und siebziger Jahre durch all diese Milieus und stolpert dabei auch nicht zu knapp in erotische Komplikationen, die freilich weniger im rosig Fleischlichen baden als vergleichbare Szenen bei Heinrich Mann. Ein Hang zu Sentenzen, dem etwa in Milan Kunderas Romanen so manche Figuren ausgiebig frönen, aber ist dabei ebenso wenig die Sache dieses Cohen, der vielleicht eher beschreibbar wäre als eine Melange zwischen Oblomow und Bartleby.
Sein „Ich möchte lieber nicht“, Frucht einer erlernten Skepsis vor Zuordnungen, verführt ihn allerdings nie dazu, es sich zwischen den harten Stühlen der politischen Positionen bequem zu machen auf dem Sessel der Äquidistanz. Seine Erfahrungen bei Verhören durch die ungarische Staatssicherheit und im opportunistisch verschmierten Alltagsleben erinnern den Romanprotagonisten stattdessen immer wieder daran, in was für einer kaputten Gesellschaft er lebt. Nicht nur, dass er sich ihr irgendwann durch den Weggang in den Westen entzieht; dort in München wird er als langjähriger Mitarbeiter von „Radio Free Europe“ auch dazu beitragen, den Erfahrungsfluss zwischen Ost und West nicht versiegen zu lassen und zwar jenseits reiner Empörung. Was dieser Tamás Cohen danach im Nachwende-Ungarn erlebt, mit alten Mitläufern und neuen Netzwerkern, mit alten und neuen Liebschaften, das lesen Sie, meine verehrten Damen und Herren, aber am besten selbst. Wobei Cohens Eintauchen in die Welt der kulturbeflissenen und „zivilgesellschaftlich sensiblen“ Projektemacher und Einander-Preise-und-Stipendien-Zuschieber besonders amüsant ist, die Entdeckungstour in eine prätentiöse Parallelwelt, in der das Schielen nach medialer Aufmerksamkeit und, natürlich, nach immer neuen öffentlichen und privaten Subventionen, einhergeht mit quantitativ beachtlicher Plattitüten-Produktion und einer geradezu irrwitzigen Überschätzung der eigenen Fähigkeit, „kritische Debatten anzustoßen“.
Ohne falsche Eindeutigkeiten
Und noch einmal „Geist versus Macht“: Hatte György Dalos in diesen beiden Gesellschafts-, Liebes- und Intellektuellen-Romanen jene Unvereinbarkeit suggerierende Begrifflichkeit in komplexe Geschichten überführt, so scheint es den Romancier ebenso gereizt zu haben, auch das verlorene Land der Kindheit und frühen Jugend im Blick zurück vor falschen Eindeutigkeiten zu bewahren. Wie gelingt so etwas? Sein Landsmann György Konrád schrieb einmal: „Dalos ist ein Seiltänzer zwischen Ironie und Melancholie. Seine Prosa ist eine einfache Rede über das Komplizierte, eine lange Anekdote über die Weltgeschichte der kleinen Leute.“ Konrád und Dalos – sie beide säkulare ungarische Juden und Herzens-Linksliberale, die späterhin, Ironie der Geschichte, ausgerechnet in Berlin eine weitere Heimstatt finden. Im Roman „Die Beschneidung“ ist es für den zwölfjährigen Robi Singer, gut vorstellbar als ein junger György Dalos, jedoch zuerst einmal weniger wichtig, jene Identitätsfragen zu wälzen, die um das Thema der (ohnehin verspäteten) Beschneidung kreisen, als seine geliebte alte Großmutter gesund zu wissen. Wobei die Kunst des Geschichtenerzählers darin besteht, das Kind, dessen Vater kurz nach seiner Geburt gestorben war und dessen ewig kränkelnde Mutter seither nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, dann sehr wohl mit seiner Herkunft zu konfrontieren. Da er im Blick der jüdischen wie auch der nichtjüdischen Umwelt doch nahezu in jeder Minute als „der Andere“ erscheint.
In einem Lehrerzimmer und unter den Porträts der streng blickenden Lenin, Stalin und Rákosi, seinerzeit auch gern genannt „unser ungarischer Stalin“, möchte nämlich die Genossin Vizedirektorin unter der Formular-Rubrik „Klassenzugehörigkeit“ auch noch den sozialen Status des Kindes feststellen, das aus einer einstmals bürgerlichen, doch nun unter prekären Umständen lebenden Familie stammt. Und was tut daraufhin die lebenskluge Großmutter? Tippt nach einigen Zögern auf die eventuell Ruhe vor weiteren Nachfragen versprechende Kategorie „Sonstige“.
Auch später, im Roman „Jugendstil“, wird der inzwischen von Robi zu Robert Singer gewordene Protagonist ein „Sonstiger“ bleiben: Als einst in den Westen Ausgereister nach 1989 besuchsweise nach Budapest zurückgekehrt und dort in einer unerwarteten Begegnung mit einem unguten und im Laufe der Jahrzehnte längst verdrängten Ereignis konfrontiert. Damals war er vom rigiden Funktionärs-Vater seiner ersten Liebe scheel angesehen und mit Verachtung gestraft gestraft worden, während ihn ein Klassenkamerad, dessen Vater nach dem gescheiterten Aufstand von 1956 lange Jahre im Gefängnis gesessen hatte, voller Eifersucht als aufstrebenden Jungkommunisten wahrgenommen hatte – und dies ebenfalls voll antisemitischer Ressentiments.
Tamás Cohen, Robi Singer, schließlich Gábor Kolosz, der als junger jüdischer Gymnasiast im Roman „Der Gottsucher“ die beiden Erstgenannten dann aus der Ferne betrachtet – weiter indessen treibt György Dalos sein autofiktionales Vexierspiel nicht. Da sich doch auch für den fünfzehnjährigen Gábor zuvörderst die Frage stellt, mit wem ein besseres Auskommen wäre: Mit dem stur abwesenden und unsichtbaren Gott, dem er in Gebeten und auf Zetteln Bitten sendet und Ultimaten mitteilt, ihm erfolglos in Synagogen und sogar in Kirchen nachstellt, oder dem vermeintlich sichtbareren „objektiven Bewegungsgesetz der Geschichte“, verkündet von seinem kommunistisch-idealistischen und gleichzeitig auf Karriere-Erfolg bedachten Schuldirektor. Und auch hier weniger „Geist versus Macht“ als vielmehr Geister und Mächtige – und jede Menge sich quasi überkreuzender Selbstgerechtigkeiten, vom Autor beschrieben ohne wohlfeilen Sarkasmus, dafür mit einer Ironie, die milde ist, manchmal aber auch nicht. Sowohl der atheistische Direktor wie auch der christliche, nach 1956 politisch abgestrafte Musikaushilfslehrer kämpfen um die Seele des Jungen, der die beiden Überzeugten mit präzisen Zweifeln dann so manches Mal in die argumentative Bredouille bringt, jedoch in seinem juvenilen Überschuss mitunter auch selbst ins hochgemute Schwadronieren gerät. Am Schluss wird Gábor Kolosz dann doch in den Kommunistischen Jugendverband eintreten und bei der 1.-Mai-Demonstration in der ersten Reihe des Gymnasiums mitmarschieren und versuchen, den Tribünen-Oberen mit seiner roten Seidenfahne zuzuwinken.
Wir Leser aber ahnen, dass jenem „Gottsucher“ in den kommenden Jahren noch so manche Desillusionierungen, Brüche und Bedrohungen bevorstehen. Wie es mit dem Autor nach den jungen Jahren in jüdischen Kinderheimen und der darauf folgenden kommunistischen Sozialisation weitergegangen war, wissen wir – nicht zuletzt Dank György Dalos‘ 2019 erschienenen Erinnerungen mit dem schönen, souveränen Titel „Für, gegen und ohne Kommunismus“.
„Keine typische Dissidentenfigur“
Gewiss, der heutige Preis wird vor allem für Essayistik verliehen. Und doch ist das umfangreiche essayistische und historische Werk von György Dalos undenkbar ohne jene Romane, die eben keine Thesen abspiegeln, keine Synthesen behaupten, sondern uns Lesern mit unaufdringlicher Finesse etwas schenken, das mit dem Wort „Ambivalenzbewusstsein“ zu beschreiben wäre – würde Dalos nicht gängigen Mode-Vokabeln zutiefst misstrauen.
So hieß es bereits in seiner 1979 im West-Berliner Rotbuch Verlag erschienenen und von Thomas Brasch und Hans Magnus Enzensberger auf deutsch bearbeiteten Textsammlung „Meine Lage in der Lage“ am Ende einer knappen autobiographischen Notiz: „Bin keine typische Dissidentenfigur.“ Gut vorstellbar, dass beim Lesen oder Anhören eines solch trotzig-fröhlichen Statements noch heute auch jene erleichtert aufatmen, die in der Vergangenheit ebenfalls „keine typischen Dissidentenfiguren“ gewesen waren – vielleicht auch deshalb nicht, weil sie sich als „kritisch-loyale“ Vermittler verstanden, als realsozialistische Prinzenerzieher, die mit ihren furchterregenden Herren zumindest das seit jeher in Deutschland von rechts bis links, von rot bis braun wabernde antiwestlich-illiberale Ressentiment teilen konnten. Diese Damen und Herren, nicht wenige fanden dann nach 1989 mit untrüglichem Machtinstinkt ihren Weg auch in westliche Institutionen, wo die Performance des „machtkritischen Intellektuellen“ quasi zum Nulltarif fortzuführen war, diese Leutchen jedenfalls würden in György Dalos keinen der ihren finden. Schon gar nicht im Dalos der siebziger Jahre, der bereits Haft und Berufsverbot hinter sich hatte und bei seinen Reisen in die DDR Menschen traf, die ihn prägten und zu Seelenfreunden wurden. Obwohl oder gerade weil deren Namen vielleicht hier im Hause nicht so oft Erwähnung finden, seien sie jetzt noch einmal genannt: Jürgen Fuchs. Reinhard Weißhuhn. Gerd Poppe.
Treffen im Gefängnis
Als er bei einer genehmigten Reise nach West-Berlin in der Akademie der Künste am Hanseatenweg zusammen mit seinen ungarischen Schriftstellerkollegen Miklós Haraszti und György Konrád diskutierte, gab es dann nur wenig Publikum – darunter einige Journalisten und, selbstverständlich, Stasi-Mitarbeiter, die wiederum mit ihren ungarischen Geheimdienst-Kollegen Bericht erstatteten. Zu dieser Zeit stand Dalos bereits seit längerem mit dem Schriftsteller Peter-Paul Zahl in Briefkontakt, der ihm – und zwar aus seiner Gefängniszelle in Nordrhein-Westfalen – Zeitungsausschnitte zu Ostblockthemen nach Budapest geschickt und dazu das Angebot gemacht hatte, Dalos‘ bereits roh übersetzte Texte auf Deutsch zu bearbeiten. Man mag sich vorstellen, mit welchem Staunen die Geheimdienste in Ost und West diesen Briefwechsel zwischen einem wegen Mordversuchs verurteilten westdeutschen Linksradikalen und einem Budapester Juden aus der Sozialkategorie „Sonstige“ mitgelesen hatten. Von West-Berlin aus flog Dalos dann nach NRW – und erinnerte sich an seine Moskauer Studentenjahre, in denen der berüchtigte Prozess gegen Andrej Sinjawski und Julij Daniel stattgefunden hatte (dessen Gedichte dann später Wolf Biermann ins Deutsche übertrug). Undenkbar jedenfalls, in ein mordwinisches Straflager ebenso besuchsweise hinein zu spazieren wie nun – und das auch noch mit ungarischem Pass – in die JVA Werl! Peter-Paul Zahl, inzwischen Träger des Literaturpreises der Hansestadt Bremen, kam in Zivilkleidung in den Besucherraum, und sofort begann eine literarische Debatte. Noch wichtiger aber ist der Satz, den György Dalos in seinen Erinnerungen dieser Geschichte folgen lässt: „Dann begleitete mich der gemütliche Schließer wieder durch Türen und Tore, fand unterwegs gute Worte für Ungarn, das er seit 1944 leider nicht mehr gesehen hätte – er habe dort als einfacher Soldat der Wehrmacht gedient.“
Stille Detonationen. György Dalos ist – als Romancier und Essayist – mit bislang circa dreißig veröffentlichten Büchern zwar ein ungemein produktiver Autor, aber kein geschwätziger. Selbst in seiner Autobiographie drängelt er sich niemals vor, sondern bleibt auf eine modeste Weise präsent, die den Blick auf Kontinuitäten und Brüche in der Außenwelt ebenso schärft wie die Wahrnehmung seiner selbst. Wie aus einem „dicklichen Jungen mit Plattfüßen“, einem „kleinbürgerlichen Angsthasen“ irgendwann ein Oppositioneller wird, ist nämlich eher ein Zickzackweg als eine lineare Entwicklung zum „aufrechten Gang“ (eine ausgelutschte Formulierung, die dem Chronisten ohnehin nicht über die Lippen gekommen wäre). Als Kind erfährt er sowohl von der Befreiung durch die Rote Armee, die auch ihm und seiner verbliebenen Familie das Leben gerettet hatte, jedoch auch von den Gewaltexzessen der Sieger, von denen selbst jüdische Frauen betroffen waren – ebenso wie von „malenkij robot“, der als „ein bisschen Arbeit“ verharmlosten Praxis der Verschleppung von Zivilisten zur Zwangsarbeit in die UdSSR. Erst Jahrzehnte später, als Historiker, wird er die Tragweite der gescheiterten Revolution von 1956 verstehen.
Später Solschenizyn-Schock
Als er dann Anfang der sechziger Jahre, noch immer idealistischer Jungkommunist, doch mit zunehmenden Zweifeln, während seines Moskauer Studiums an ein Zeitschriften-Exemplar mit der darin abgedruckten Erzählung „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ gelangt, findet er die Lektüre vorerst noch ziemlich „langweilig“ – der Solschenizyn-Schock, die Wahrnehmung des mörderischen Charakters des Sowjetregimes, würde erst später einsetzen. Und was den ersten großen Zusammenstoß mit dem ungarischen Staat betrifft, der in einem Strafprozess mit Bewährungsstrafe geendet hatte: Zusammen mit einigen Gleichaltrigen hatte György Dalos damals 1968 den Maoismus für sich entdeckt, zieh die ungarische Parteiführung des „Revisionismus“, ließ sich von Besuchen in der kubanischen Botschaft inspirieren – und schreibt Jahrzehnte später in seinen Erinnerungen: „Zum Glück war ich niemals in die Position gekommen, über menschliche Schicksale mitentscheiden zu müssen, aber wenn ich bedachte, dass ich mit meinem linksradikalen Revoluzzertum nur Jahre früher, unter Rákosi, zum freiwilligen Helfer des staatlichen Terrors hätte werden können, läuft es mir kalt den Rücken herunter.“
György Dalos – und dies im Unterschied zu manch westlichem Ex-Maoisten – kokettiert nicht mit der damaligen Verirrung, noch missversteht er die spätere Einsicht in den fatalen Irrtum als Garantie dafür, fürderhin stets auf der richtigen Seite zu stehen. Selbst von seinem Weg in die demokratische ungarische Opposition, selbst von den zusammen mit Miklós Haraszti durchgestandenen Gefängniswochen samt lebensgefährlichen Hungerstreiks erzählt Dalos präzis, ohne jegliches Tremolo. Da ist, wie auch in seinen anderen Büchern und Essays, etwas Erz-Ziviles in dieser Art, Diktatur und Gesellschaft zu analysieren, das Ineinander von falscher Gemütlichkeit und echter Repression, nicht zu vergessen die Gefahr, entweder im Pathos des Widerstandes zu erstarren oder in falsch verstandener Ironisierung schließlich doch noch seinen Irgendwie-Frieden mit den Umständen zu schließen. Und Ja, es ist trotz allem eine Freude, von all dem zu lesen, sich einem illusionslosen Kenner des menschlichen Herzens, will heißen auch allzu-menschlicher Herzensträgheit beim Lesen anzuvertrauen, der nicht zuletzt deshalb gegen das System aufbegehrt, weil dieses in das doch ohnehin komplizierte Tohuwabohu unserer endlichen Existenz auf eine Weise hinein fuhrwerkt, die eben nicht allein ideologisch stupid ist, sondern auch ganz lebenspraktisch weiteres Leid schafft. Und keine geringe Leistung, von all dem zu berichten, ohne sich von Empörung übermannen zu lassen, sondern stets auch mit dem rettenden Seitenblick auf das absurde Detail, das ein befreiendes Gelächter schenkt.
Befreiendes Gelächter über den Kommunismus
Seit Beginn der achtziger Jahre mit Einreiseverbot in die DDR belegt, jedoch häufig in die Bundesrepublik reisend und dort publizierend, schließlich ansässig in Wien, doch immer wieder, mit mehr oder minder Konterbande im Gepäck zurückkehrend nach Budapest, trifft auch auf György Dalos zu, was dann in seinem nach Mauerfall erschienenem Buch „Proletarier aller Länder, entschuldigt mich! Das Ende des Ostblockwitzes“ unter dem Stichwort „Die Intelligenz“ als Apercu zu finden ist: „Warum kehren so viele ungarische Intellektuelle von ihrer Westreise zurück? Aus Abenteuerlust.“ An anderer Stelle heißt es freilich auch, aus dem Mund eines Bekannten: „Ich bin Pessimist. Ich glaube an den Sieg des Kommunismus.“
Der Psychoanalytiker und Soziologe Carlo Strenger hat ein solches Verfahren einmal als „zivilisierte Verachtung“ beschrieben. Bei György Dalos kämen dann – und zwar keineswegs in folkloristischem Sinn – der Nachhall einer k.u.k-Prägung im stilistisch Nuancierten hinzu und natürlich der jüdisch-osteuropäische Witz, melancholisch, weltweise und stets konkret. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass, über Generationsgrenzen hinweg, drei der renommiertesten ungarischen Osteuropa-Vermittler im Westen einen vergleichbaren Hintergrund haben, jenseits des akademischen Betriebs und als solitäre „Sonstige“: Paul Lendvai in Wien, Francois Fejtö in Paris – und György Dalos in Berlin. (Mütterlicherweise trug seine Familie übrigens sogar den Namen „Berliner“.)
Und heute, in Berlin und hier, wo man zurecht dankbar ist, dass so viele Ungarn ihre Archive der Akademie gegeben haben? 1983, bei der von Günter Grass initiierten „Zweiten Berliner Begegnung“, hatte Dalos‘ Freund György Konrád darauf hingewiesen – und dies unter der Beobachtung von Stasi-IMs, die ebenfalls im Publikum saßen – dass eines der aktuellen Kriegsgefahren den Namen „Jalta“ trug, sprich das gewaltsame Einfügen Mittel- und Osteuropas in den Macht- und Einflussbereich der totalitären Sowjetunion. Nicht nur beim ostdeutschen Geheimdienst, sondern auch bei jenen, die sich ostentativ als „Lehrenzieher aus der Geschichte“ gaben, leuchteten damals alle Lampen auf rot. Folgt man so manchen Wortmeldungen der letzten Zeit, in denen etwa von „unserem Nachbar Russland“ und „russischen Einkreisungsängsten“ zu hören ist und in denen die überfallene Ukraine und ihre noch lebenden Bewohner lediglich als Objekt vorkommen, dem man überdies jegliche Waffenhilfe verweigern möchte – nun, angesichts solch moralistisch camouflierter Niedrigkeit wäre die Vermutung vielleicht gänzlich nicht von der Hand zu weisen, dass sich unzählige Deutsche auch weiterhin vor allem die Täterperspektive zu eigen machen und noch immer im Sumpf der gewalttätigen Einflusszonenlogik des Hitler-Stalin-Paktes stecken.
Unterschätze keiner die „Sonstigen“!
György Dalos indessen hat in den Jahrzehnten seit Konráds früher Intervention Buch auf Buch, Essay für Essay geschrieben, seine zahlreichen Rundfunk-, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge gar nicht mitgerechnet, um all jenen, die es lesen und hören wollen, ohne professoralen Duktus und ohne jegliche Vereinfachungen eindringlich zu vermitteln, wie es zuging in jenen Staaten, die als Resultat von „Jalta“ zwangsstalinisiert worden waren. Diese Bücher tragen Titel wie „Archipel Gulasch. Die Entstehung der demokratischen Opposition in Ungarn“, „Lebt wohl Genossen. Der Untergang des Sowjetischen Imperiums“ oder „Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa“. Sie zeigen den freigeistigen Romancier als ungemein akribischen Historiker und Erzähler des Non-Fiktionalen. Sein untrügliches Radar – auch hier – für bislang Unbekanntes, für Anekdoten und irrwitzige Pointen und nicht zuletzt für die Lebenswirklichkeit der oft so herablassend genannten „kleinen Leute“ macht dabei aus dem gesellschaftlichen Panorama auch immer wieder faszinierende Fallstudien von Individuen. Unterschätze nur keiner die „Sonstigen“! Anstatt Nationalhistorie erzählt Dalos Verknüpfungsgeschichten, die keineswegs historische Patina angesetzt haben. Denn nein, die polnische Gewerkschaft Solidarność war nicht, wie einst Egon Bahr behauptet hatte, „eine Gefahr für den Weltfrieden“, sondern im Gegenteil auch eine der Gründe dafür, dass wir uns nun jetzt und hier an diesem Ort frei versammeln können.
Anders als Hegel, der Weltgeschichte noch apodiktisch als „Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“ definierte, hält es jedoch Dalos eher mit Jacob Burckhardt: „Das Wesen der Geschichte ist Wandlung.“ Und selbstverständlich nicht immer eine zum Positiven. So erzwangen die deprimierenden Veränderungen im gegenwärtigen Ungarn Überarbeitungen und Aktualisierungen seines Geschichtswerks „Ungarn in der Nußschale. Ein Jahrtausend und dreißig Jahre“, während dem letztes Jahr erschienenem Buch „Das System Orbán“, das wie kein anderes die autoritäre Verwandlung Ungarns beschreibt, inzwischen quasi in Tagesabständen ein Appendix nach dem anderen zuwächst: Der vom einstmals jung-liberalen Antikommunisten zum feisten Potentaten gewordene Viktor Orbán hat inzwischen seine Bewunderung für den chinesischen Diktator um ein Relativieren von Russlands Angriffskrieg erweitert und gibt forsch bekannt, den Haager Haftbefehl für den Kriegsverbrecher Putin ignorieren zu wollen. Überdies versucht Ungarn gerade, im Schulterschluss mit dem Erdogan-Regime, den Beitritt Schwedens zum Verteidigungsbündnis der NATO zu torpedieren.
Gegen die neue Internationale der Autoritären
György Dalos wird hier also gewiss seine historisch-essayistische Arbeit fortsetzen, als humaner Realist keineswegs überrascht von dieser neuen Internationale der Autoritären. Obwohl niemals in der Attitüde des Alleswissers, wäre deshalb von diesem Autor wohl auch kaum ein großäugig-törichtes „Das hätte ich dem Orbán oder Putin nicht zugetraut“ zu hören.
Im Unterschied zu manchen, die seit dem 24. Februar 2022 lautstark behaupten, sie hätten als „gelernte DDR-Bürger ein besonderes Verständnis der Sowjetunion und des heutigen Russlands“, spricht György Dalos überdies nach seinen Moskauer Jahren und zahlreichen weiteren Aufenthalten nicht nur fließend Russisch, sondern ist auch tatsächlich ein versierter Kenner der russischen Geschichte und Kultur. Davon zeugen seine Biographien über die Zaren-Familie Romanow und über Gorbatschow ebenso wie die sensible Nachzeichnung von „Pasternaks letzter Liebe“ oder, sein wohl schönstes Buch, „Der Gast aus der Zukunft“, die bis zum heutigen Tag geradezu atemlos machende Geschichte einer Leningrader Begegnung zwischen der verfemten Dichterin Anna Achmatowa und dem exilrussisch-britischen Ideenhistoriker Isaiah Berlin. Wer von „Begegnungen“ mehr erwartet als die wohlfeilen Katheder-Aussagen, man sei gegen den Krieg und für den Frieden, wer stattdessen noch einmal erfahren will, wie sich ein Friedhofsfrieden in einer totalitären Diktatur wirklich anfühlt und auf welche Weise er von zwei mutigen, isolierten und bespitzelten Menschen an jenem Novembertag 1945 reflektiert und im Reflektieren gleichsam für einen Moment aufgehoben wird, der lese unbedingt dieses Buch.
Geist gegen Macht – zumindest in dieser Konstellation, damals in Leningrad, beschrieb das Begriffspaar eine Realität. Auch wenn andere just in jenen Monaten wider besseres Wissen Stalin bejubelten, im heutigen Russland Anna Achmatowa erneut als „Defätistin“ denunziert wird und sich Populisten in Ost und West darin einig sind, dass der von Isaiah Berlin vertretene Liberalismus mausetot sei und stattdessen wieder völkisch repressive Zucht und Ordnung zu herrschen habe.
Subversion in den Sternen
Und György Dalos? Hatte, eine Verszeile Anna Achmatowas zitierend, seinem Buch ja diesen ganz und gar Mut machenden Titel gegeben: „Der Gast aus der Zukunft.“ Und berichtet dann am Schluss, dass bereits in den achtziger Jahren Astrowissenschaftler auf der Krim auf ihre Weise Fakten geschaffen hatten, quasi hinter dem Rücken der Moskauer Staatsmacht. Ein Asteroid nach dem anderen war damals nach den Verfemten benannt worden – nach Marina Zwetajewa, nach Boris Pasternak und Andrej Tarkowski, nach Isaak Babel und Nikolaj Gumiljow, dem bereits 1921 erschossenen Dichter. Und irgendwann dann auch nach dessen Witwe Anna Achmatowa. Jener Planet 3067 gilt in der Sprache der Wissenschaft zwar als „Minor Planet Circulars“, aber schließlich, das wissen wir ja, ist die Sache mit dem Großen und dem Kleinen ebenfalls relativ – es braucht halt nur Mitmenschen, die uns immer wieder daran erinnern.
Lieber György Dalos – wie gut, dass es Dich gibt. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Lebenswerk.