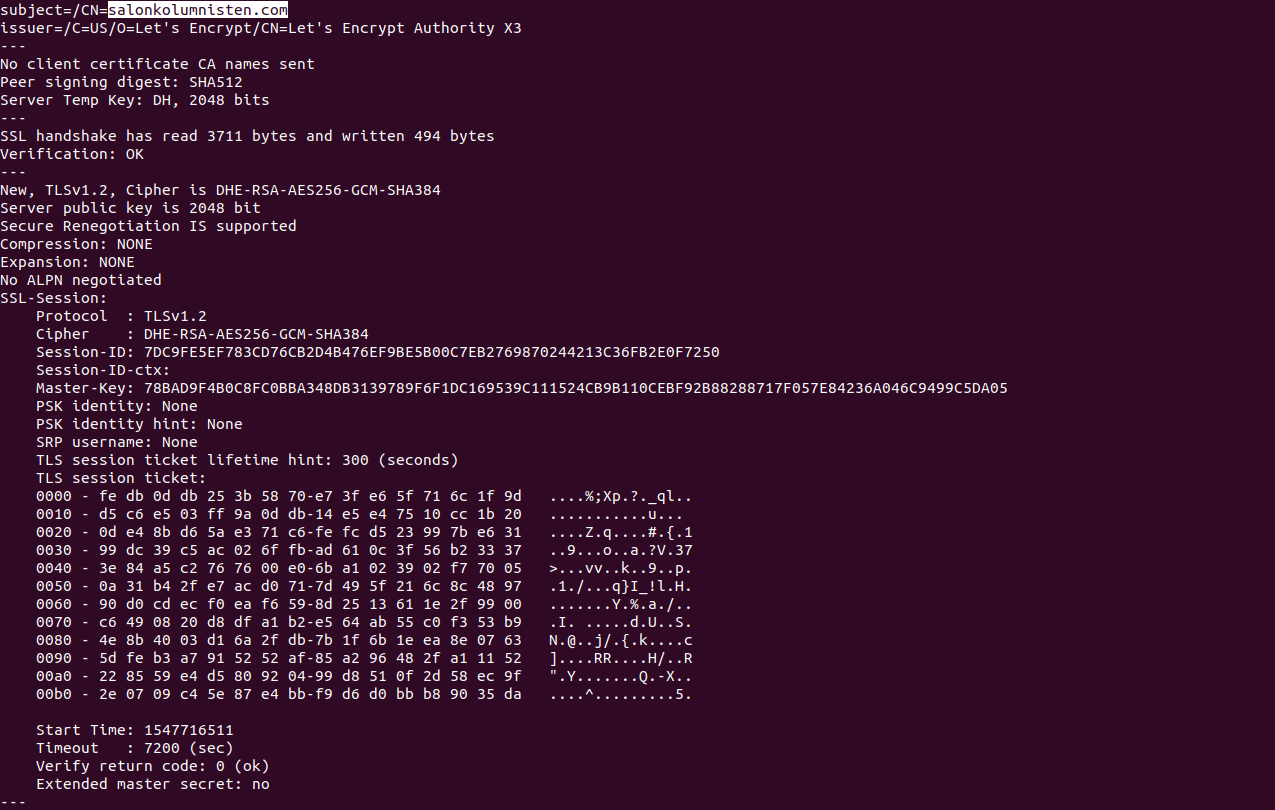Ein tropischer Herbst in Brasilien
Eine Reise nach Brasilien. Schon der Besuch eines winzigen Teils dieses Riesenreichs begeistert.
Auf der Südhalbkugel in Brasilien ist der Sommer vorbei, wenn bei uns Frühjahr ist. Im tropischen Rio und Umland ist es noch warm, manchmal gefährlich und wunderschön.
Ich liege in einem Zimmerchen in einer Favela an der Copacabana in Rio. Das Zimmer habe ich per Internet von einem Einheimischen gebucht für 13 Euro die Nacht. Direkt vor meinem Fenster ist ein Dschungelgarten.
Die Luft, die durch das Fenster in das Zimmerchen weht, ist hier am Hügel angenehm kühl und duftet nach Urwald. Es ist fünf Uhr morgens, oben in der Favela tobt eine Party mit Live-Musik. Baile Funk und Brasilianischer Reggae. Da sie hier kein R aussprechen, sagen sie „Heggae“. Ich liebe diese Musik, überlege hochzulaufen. Aber ich habe etwas Angst.
Schließlich bin ich noch etwas verwirrt im Jetlag, ein weißer Tourist, da oben stehen Dealer mit Kalaschnikows, habe ich gelesen. Ich habe auch gelesen, dass dort oben bei solchen Partys manchmal Dealer mit Kalaschnikows stehen sollen. Ich lasse es dann. Es wird hell, die Musik verstummt. Kleine Kapuzineräffchen schauen herein und schreien.
Die Favela nahe der U-Bahn-Station Siqueira Campos wurde wie all die anderen einst von armen Schwarzen gebaut, die sich ein Grundstück in der Ebene nicht leisten konnten. Diese Hütten-Siedlung gilt als befriedet, ganz oben auf dem Hügel haben Militärpolizisten einen Container. In anderen Favelas gibt es immer noch Gefechte mit Kriegswaffen zwischen Gangs mit Namen wie „Rotes Kommando“. Das lese ich täglich in einem Boulevard-Blatt.
Aber auch bei meinem Domizil herrscht hin und wieder Gesetzlosigkeit. Einmal sehe ich, wie zwei Polizisten versuchen mit gezogenen Pistolen einen jungen Schwarzen herauszuholen, der einem Mann blutende Löcher in den Kopf geschlagen hat.
„Komm runter, Puta“, ruft eine Beamtin mehrfach von einer Straße nach oben. Der Schläger schüttelt den Kopf. Mehr und mehr junge Männer sammeln sich um ihn. Die Polizisten trauen sich nicht den Hügel hoch und ziehen unverrichteter Dinge wieder ab.
Ich frage Einheimische, was da los war. Sie schieben die Schuld auf den Mann mit den Löchern im Kopf. „Er ist verrückt, hat hier Stress gemacht“, sagt ein Älterer. Manchmal gehen die Untaten ins extrem Grausame über. Gerade wurde eine 16-jährige in einer der Armensiedlungen nach einer Baile-Funk-Party von über 30 Männern vergewaltigt. Ein Video davon wurde stolz herumgeschickt.
Als ich nach Brasilien fliege, ist in Deutschland Frühling, hier auf der Südhalbkugel des Planeten Erde ist Herbst. Ich gehe zur Copacabana, von meinem Zimmerchen sind das 15 Minuten zu Fuß. Der riesige, berühmte Sandstrand ist ziemlich leer zu dieser Jahreszeit, vielleicht hat auch das von Mücken übertragene Zika-Virus ein paar Urlauber abgeschreckt.
Etwa 20 muskelbepackte Brasilianer rennen im tiefen Sand einem Fußball hinterher. Nach verlorenen Bällen und schlechten Pässen schreien sie im portugiesischen Slang empört „Poha!“ Das Wort für Menschen-Samen. Nippes-Händler bieten Hüte und Schlüsselanhänger an und zischen dann „Marihuana?“, „Blow?“
„Blow“, das ist Kokain. Eine Einheimische erzählt mir, dass sie ein Gramm des weißen Goldes für zehn Reais, also etwa 2,50 Euro, in den Favelas kaufen kann. Und das ist bestimmt viel weniger gestreckt als das 70-Euro-das-Gramm-Zeug in Berlin. Das Produzenten-Land Kolumbien ist nah.
Der Atlantik ist frisch und gewaltig
Rote Flaggen am Strand der Copacabana warnen davor, ins Wasser zu gehen. Die Wellen sind hoch, etwa vier Meter. Kein Wunder, schließlich hatten sie seit Namibia auf der anderen Seite des Atlantiks Zeit, Anlauf zu nehmen. Ich gehe trotzdem rein. Das Wasser ist angenehm kühl, denn für mich Europäer ist die Luft immer noch sehr heiß und schwül hier.
Ich werfe mich wie ein Surfbrett in den Schwung einer großen Welle. Sie nimmt mich zunächst mit, ein Geschwindigkeitsrausch. Dann bricht sie, wirbelt mich zwei Mal unter Wasser um die eigene Achse, ich schlucke Salz. Am Ende klatscht sie mich auf den Strand wie ein Wrestler. Um mein Genick zu schützen, fange ich mich mit der rechten Hand auf. Das Gelenk scheint fast zu brechen. Das zurückfließende Wasser will mich in die Tiefe zerren.
Ich versuche es noch ein paar Mal. Bis eines Tages, ich bin ziemlich zerstört von der Nacht zuvor, eine Riesenwelle auf mich zukommt. Ich spreche als Agnostiker ein kurzes Gebet und schwöre mir, mich nie wieder in diese Wellen zu werfen, wenn ich hier heil wieder rauskomme. Ich schaffe es gerade so eben.
Anfangs zweifele ich, ob es eine gute Wahl war, nach Brasilien zu fliegen. Und nicht stattdessen meinen weißen Körper in die friedliche thailändische Sonne zu legen. Aber dann lerne ich das Land lieben. Mit einem Freund wandere ich zur Christusstatue hinauf. Cristo Redontor, „Christus, der Erlöser“ thront mit ausgebreiteten Armen 700 Meter über der Stadt.

Man kann für 70 Reais (etwa 18 Euro) mit einer kleinen, halboffenen Bahn hoch und runter fahren. Wir fahren lieber mit dem Bus zum verwunschenen Parque Lage am Fuß des Felsens und nehmen den Trampelpfad. Am Eingang zum Pfad schreiben wir Namen und Telefonnummern bei Polizisten auf, falls etwas passieren sollte. Manchmal gibt es Räuber, manchmal stürzen Wanderer ab.
Wir wandern durch den Dschungel, immer nach oben, die Urwaldbäume um uns herum. Nach etwa einer Stunde wird der Weg so steil, dass unsere Lungen pumpen. Der europäische Alltag ist weit weg. Der grüne Wald liefert Sauerstoff. Es ist wunderbar. Als wir ganz oben sind, und mit etwa tausend Touristen über die Stadt schauen, fühlt sich der mühsame Aufstieg gut und richtig an. Zurück nehmen wir dann doch die Bahn.
Die meisten der 200 Millionen Brasilianer sprechen kein Englisch. Ich radebreche mich durch mit einem Mix aus Lehrbuch-Portugiesisch, Schul-Französisch, Urlaubs-Spanisch, Ex-Freundin-Italienisch und Uni-Latein. Und latinisierten englischen Wörtern. „Difficult“ wird zu „difficil“. Es funktioniert irgendwie.
Die Ilha Grande, die „große Insel“, liegt etwa drei Stunden mit dem Bus südlich von Rio. Von der nach Kloake stinkenden Hafenstadt Angra dos Reis nehmen wir ein Schnellboot und sind eine halbe Stunde später im größten Ort der Insel, Abraao. Sie ist ein Piraten-Südseetraum. In tausend Grüntönen wächst sie aus dem Meer empor. Keine Autos verpesten hier die Luft, Lasten werden mit Handkarren transportiert. Wir mieten ein Zimmer in einer „Pousauda“, einer Pension, für 30 Euro die Nacht und essen wunderbares Meeresfrüchte-Risotto, trinken süßsauren Caipirinha.
Diese Insel-Perle hat eine dunkle Vergangenheit, die von der Tourismusbranche weitgehend verschwiegen wird. Früher wurden hier die Sklaven nach der Überfahrt aus Afrika für die Märkte auf dem Festland aufgepäppelt. Dann war die Insel bis in die 1990er-Jahre eine grüne Hölle, ein einziges Freiluft-Gefängnis. Jetzt sind viele Touristen da, trotz Nebensaison. Einmal fahren wir mit einem Boot zur Blauen Lagune, wo man mit Fischen tauchen kann. Ein alter einheimischer schwarzer Indio kommt mit einem Einbaumkanu und verkauft in Holzfeuer gerösteten, süßen Kokosnuss-Kuchen.

Abends im Bett lese ich Stefan Zweigs „Brasilien – ein Land der Zukunft“, das er 1940 veröffentlichte. Der österreichische Jude war aus Europa vor den Nazis nach Brasilien geflohen und berichtet überschwänglich vom sicheren Hafen: „Das Wort ‚Mischling ist hier kein Schimpfwort, sondern eine Feststellung, die nichts Entwertendes in sich hat: Der Klassenhass und Rassenhass, diese Giftpflanze Europas, hat hier noch nicht Wurzel und Boden gefasst.“
Seine Beschreibungen von Rio und der Geschichte des Landes sind legendär. Über die Armensiedlungen schrieb er: „Weil sie hoch auf den Bergen liegen, an den unzugänglichsten Kanten und Ecken, haben diese Favelas den schönsten Blick, den man sich denken kann, denselben Blick wie die kostbarsten Luxusvillen, und es ist dieselbe üppige Natur, die hier ihr winzigstes Stückchen Grund mit Palmen überhöht und mit Bananen großmütig speist, jene wunderbare Natur von Rio, die es der Seele verbietet, schwermütig und unglücklich zu sein, weil sie unablässig tröstet mit ihrer weichen, beschwichtigenden Hand.“
Aber Zweig wurde schwermütig. 1942 brachte er sich verzweifelt ob des Wütens in Europa in den Bergen über Rio um, gemeinsam mit seiner Frau. Gerade ist ein hochgelobter Film über Zweigs Zeit in Amerika ins Kino gekommen: „Vor der Morgenröte“. Manche kritisierten Zweig, ob seines überschwänglichen Lobes für Brasilien, ein Land, in dem es natürlich auch Ungleichheiten gab und gibt. Aber wer will es Zweig verdenken? Das tatsächlich sehr vermischte Brasilien war für ihn ein Balsam nach dem Rassenwahn des Deutschen Reiches.
Brasilien: „Ein Land der Zukunft, die niemals eintritt“
Später in Rio erzähle ich einem Gastgeber von dem Buch. Er kennt es nicht, aber den Satz „Brasilien – ein Land der Zukunft“ sehr wohl. Er heißt Marcos, ist 26 Jahre alt und Ölbohr-Ingenieur: „Wir spotten, Brasilien ist ein Land der Zukunft, die niemals eintritt.“
Er ist wütend, gerade hat er nach einem Korruptions-Skandal seinen Job beim Öl-Riesen Petrobras verloren, der 80 Prozent seiner Angestellten entlassen musste. Marcos ist sauer auf die sozialistische Staatspräsidentin Dilma Rousseff, die abgesetzt wurde. „Sie hat zu viel Geld für die Armen ausgegeben. Und wir haben nicht wie Griechenland ein Deutschland, das uns freikauft“, sagt er. Er hofft, dass der neue Präsident Michel Temer, dessen Vorfahren einst aus dem Libanon einwanderten, das Land wirtschaftlich nach vorne bringt.
Denn Brasilien geht es wirtschaftlich schlecht. Für vier Reias bekam man vor einigen Jahren fast zwei Euro. Jetzt ist es noch einer. Das macht das Land günstig für Europäer und teuer für die Einheimischen. Viele Menschen schlafen auf den Straßen, manche verrückt. Sie müssten eigentlich in einer Psychiatrie unterkommen. Die Armen aus den Favelas ziehen zu Raubzügen aus, um zu nehmen. Den meist minderjährigen Räubern drohen so oder so nur geringe Strafen.
Polizisten sind machtlos oder korrupt oder überbrutalisiert. Deshalb sollte man abends nur mit Bargeld rausgehen, Kreditkarte und Handy im Zimmer lassen. Ein schwules Pärchen, das im Flugzeug neben mir saß, wurde später im Stadtteil Ipanema mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt.
Sao Paulo liegt sechs Stunden mit dem Nachtbus südlich von Rio. Auf einem Hochplateau gelegen, ist das Klima fast europäisch. Die 11-Millionen-Stadt ist das industrielle Zentrum des Landes. In Rio wird gelebt, hier in grauen Häuserschluchten gearbeitet.
Als der Kaffeeboom im 19. Jahrhundert das Land nach vorne peitschte und die Sklaverei abgeschafft war, siedelten sich hier viele Italiener, Japaner und Libanesen an, welche die Stadt mit aufbauten. Ich lerne über mein Airbnb-Zimmer ein paar Leute aus der weißen Mittelschicht kennen, manche ziehen Kokain für zwölf Euro das Gramm und lieben das Leben im Moloch. Sao Paulo ist mit seiner Prachtstraße Avenida Paulista ein bisschen New York und mit seinem heruntergekommenen Charme ein bisschen Berlin. Sie sind eher links eingestellt und traurig, dass Rousseff abgesetzt wurde. Tatsächlich hatte sie ja den Armen geholfen.
Wunderbare Graffiti zieren Wände, mache haben etwas Hieroglyphenhaftes, andere sind Cartoons: Ein grüner Mann, lechzend mit Drink, steht hinter einer schönen Frau in Minirock, sagt: „Ich habe den Sinn des Lebens entdeckt!“ Sie gelangweilt mit Zigarette: „Das ist nicht schwer.“
Mich zieht es ins schwüle Rio zurück. Als ich mit dem Bus in die Stadt fahre, erwacht der Tag. Die vielen Hügel und Hütten, gerade noch Lichtermeere, erwachen im roten Morgenlicht, ich sehe Mini-Häuschen auf Flachdächern, Inseln der Ruhe in der Riesenstadt.
Ich besuche dann noch die Favela Vidigal im Süden der Stadt, laufe den grünen Morro Dois Irmaos, den „Berg der zwei Brüder, hinauf. Eigentlich sieht man von diesem Felsen aus ganz Rio, ich im Nebel nur drei Meter weit und Äffchen. Unter mir pulsiert die Stadt, hier oben ist die Freiheit.
Unten esse ich in einem Restaurant, das die afrikanisch geprägte Küche des Nordostens anbietet, Feijao (schwarze Bohnen, das Nationalgericht) mit Reis und Fisch. Ich laufe durch die Gassen der Favela und treffe einen Elektriker, der gerade die Spule für einen Ventilator neu wickelt. 
Ich habe nur einen winzigen Teil dieses Riesenreiches Brasilien kennengelernt. Es ist 24 Mal so groß wie Deutschland. Der besagte Nordosten soll karibisch sein, afrikanisch. Der Amazonas, die grüne Lunge der Welt. Das Hinterland ist noch größtenteils unbesiedelt, unkultiviert, wild. Im kälteren Süden soll es Siedlungen geben, in denen Einwanderer noch ein eigentümliches Deutsch sprechen und Fachwerkhäuser bauen. Man könnte hier Jahre umherreisen und immer noch etwas Neues kennenlernen. Ich will wiederkommen.
Als ich wieder in Berlin lande und nachts durch die frühlingshaften Straßen von Neukölln gehe, merke ich, wie eine gewisse Anspannung abfällt, die ich in Rio spürte, wenn ich spät durch die Straßen lief. Eine auch unterbewusste Anspannung, die vielleicht auch eine Steppentier in einem Löwenrevier fühlt. Ich merke, wie relativ wohlhabend und sicher wir hier leben können. Schon deshalb hat sich diese Reise gelohnt.
Dieser Artikel erschien zuerst in kürzerer Form in der B.Z. am Sonntag