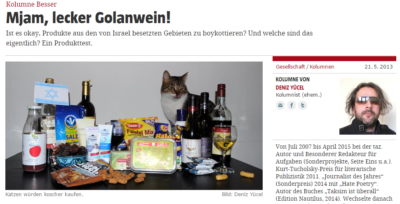Israel in der „taz“: Wo ist der Anstand der Aufständischen?
Die linke Traditionszeitung ist meine heimliche College-Liebe. Ich will nicht mit ihr Schluss machen – ich will, dass sie sich ändert.
Unsere Romanze begann vor ungefähr zehn Jahren. Sie war die erste, mit der ich eine dauerhafte Bindung einging, die erste, mit der es richtig ernst wurde. Mit ihr hatte ich mein erstes Mal. Im Winter 2010 war das, in Berlin. Es war mein erster Besuch in der Hauptstadt überhaupt, abgesehen von einer Klassenfahrt Jahre zuvor.
Damals waren die Winter in der Hauptstadt noch richtige Winter, solche, die den Boden für gefühlte sechs Monate unter einer unbarmherzigen Eisdecke verschwinden ließen. Ich war Teilnehmer eines „Panther-Workshops“ der taz-Akademie und übernahm zusammen mit einer Handvoll anderer Jungjournalisten für vier Tage die Redaktionsräume in der Rudi-Dutschke-Straße. Es war eine bezaubernde Atmosphäre und man kümmerte sich rührend um uns.
Häppchen, Hausparty, Herzenswärme
Es gab (okay, vegane, aber immerhin) Häppchen, Hauspartys bei Redakteuren und einen exklusiven Einblick in den Arbeitsalltag der taz-Belegschaft. Und das Beste: Nie zuvor hatte ich einen Artikel geschrieben, nun tat ich es, und der wurde auch noch gedruckt. Ich hatte mein Herz endgültig verloren.
Ich hing an ihr und sie an mir. In den folgenden Jahren lud sie mich immer wieder zu sich ein, um auf ihren Kongressen zu bloggen. Und auch als sie sich diesbezüglich nicht mehr meldete, ebbte unsere Verbindung nicht ab.
Einmal wurde ein Debattenbeitrag von mir abgedruckt, ein anderes Mal meldete sich gar die wunderbare Cigdem Akyol um einen Artikel zu schreiben – über mich, oder genauer gesagt, über einen Artikel von mir. Plötzlich stand mein Name prominent im überregionalen Politikteil meiner geliebten taz.
Religionsfreiheit in Deutschland: „Die Hamas marschiert mit“
Klar gab es auch Streit. Das erste Mal sind wir 2013 aneinander geraten, als die taz 16 dämliche Fragen an den ehemaligen FDP-Chef Phillip Rösler abgedruckt hatte. Ich fand das schrecklich und sagte ihr das auch. Einige Jahre später krachte es wieder, und ab da ging es mit unserer Beziehung bergab. Was habe ich sie manchmal angeschrien, Dinge gesagt, die ich später tief bereute. Meiner Liebe hat das keinen Abbruch getan.

Für Unmut sorgte (und sorgt) bei mir vor allem eine gewisse Frau K., ihres Zeichens Nahost-Korrespondentin. Was für ein unfairer Mensch! Was für gemeine Dinge sie über das Land verbreitet, das ihr seit zwanzig Jahren eine Heimat bietet! Ich spreche natürlich von Israel. „Kauft nicht bei diesen Juden“, steht zum Beispiel in ihren Artikeln, und wie oft sie Verständnis bis hin zu offenen Sympathien für Terroristen zeigt! Einmal titelte die taz: „Zwei Palästinenser kaltblütig erschossen“. Es ging um Attentäter. Über tote Juden habe ich von Frau K. noch nie Vergleichbares gelesen.
BDS: Boykott richtig adressieren
Überhaupt habe ich in all den Jahren von ihr noch kein einziges positives Wort über das Land gehört, dafür Artikel über verhaftete Clowns und traurige Kinder, böse Juden und unschuldige Palästinenser. Standardrepertoire aus dem Werkzeugkasten des Entlastungsantisemitismus. Zuletzt erschien wieder ein für sie typischer Artikel, in dem sie den Juden nach dem jüngsten Anschlag mit vier Toten ein „Das habt ihr nun davon!“ hinterher ruft.
Kommentar Lkw-Anschlag in Israel: Jerusalem ist nicht Berlin
Ein taz-Kollege versicherte mir vor einiger Zeit, eigentlich liebe Frau K. Israel. Ich kann das kaum glauben. Freunde, so sagte der ehemalige Zentralratspräsident Dieter Graumann einmal, dürfe man selbstredend kritisieren. Aber man sollte auch ab und zu ein freundliches Wort für sie übrig haben.
Derselbe taz-Kollege, der mir von Frau K.’s angeblicher Israel-Liebe erzählte, nannte einen anderen damaligen taz-Autoren einmal einen „schreibenden Kombattanten“, völlig zu Recht, weil dieser sich offen mit der Hamas solidarisiert hatte.
Soll ich euch was sagen? Frau K. ist für mich ebenfalls eine schreibende Kombattantin. Ich weiß, dass viele das ähnlich sehen. Die taz ist nicht per se israelfeindlich. Die Zeitung ist vielfältig und so finden sich dort ebenso viele Menschen, die dem Judenstaat wohlgesonnen sind. Allerdings schreiben diese in der Regel nicht darüber. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Deniz Yücel: „Mjam, lecker Golanwein!“
Es sind alte taz-Hasen, renommierte Kollegen, keine Jung-Guns, die bei Widerspruch um ihren Job fürchten müssten (was bei der liberalen Kultur, die in der Redaktion herrscht, ohnehin unwahrscheinlich ist). Okay, einer von ihnen, der Golanwein-Liebhaber, hat sich vor einiger Zeit in Richtung Springer davongemacht, allerdings dürfte das eher mit der prekären Bezahlung im Hause taz zu tun haben.
Aber die anderen? Warum schweigen sie? Warum kann Frau K. unbehelligt ihre Kampagne fahren, ohne dass sich in der sonst so debattenfreudigen Zeitung wahrnehmbarer Widerstand regt? Es geht nicht um Hofberichterstattung. Es geht um Ausgewogenheit. Die taz stand immer für den politischen Aufstand. Nun müssen die Aufständischen Anstand zeigen. Ich will meine alte College-Liebe nicht aufgeben. Ich will, dass sie sich ändert.