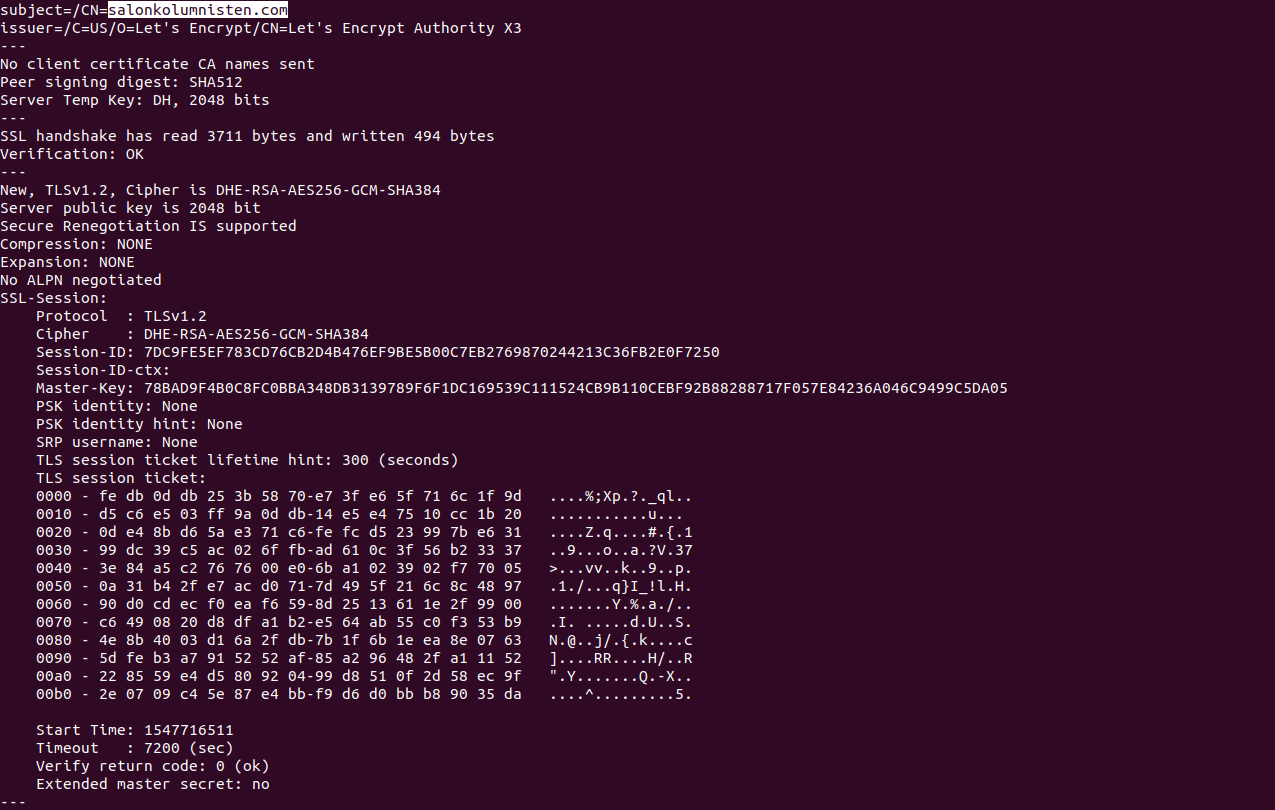Mails, Mails, Mails!
Wenn der Mail-Verkehr einen Auspuff hätte, würde man mehr von ihm lesen und hören. Aber so leiden wir alle still vor uns hin. Ein Erfahrungsbericht von der Kommunikationsfront.
Jüngst erzählte mir ein Bekannter in einer Bar, dass er seine Arbeit liebe. So weit, so schön. Wir hatten ein paar Biere getrunken, und plötzlich kam er in Fahrt. Eigentlich müsse er den ganzen lieben langen Arbeitstag Texte lesen, korrigieren und verbessern: Studien und anderen wissenschaftlichen Kram. Dafür sei er angestellt, und es mache ihm Spaß: dass er wie ein Gärtner aus dem üppigen Gestrüpp der Worte einen halbwegs verständlichen Text zaubere durch Beschneiden, Umstellen, Austauschen und einige andere handwerkliche Kniffe. Eigentlich. Doch immer öfter, gegen Jahresende sogar exponentiell steigend, funkten jene Nachrichten bei der Arbeit dazwischen, die wir Menschen in den Büros „E-Mails“ nennen oder einfach nur „Mails“, elektronische Post also, die jeder kennt, dessen Werkzeug ein Computer ist.
Mails sind raffiniert – und eine Plage. Sie tauchen nicht einfach nur aus dem Nichts auf, sondern kündigen sich auch noch mit einem „Pling!“ an, einem kurzen akustischen Stromschlag, weil sie so wichtig sind, denn sie sind ja Kommunikation, also der „basale Prozess sozialer Systeme“, wie der Soziologe Niklas Luhmann schon vor Jahrzehnten feststellte. Aber das weiß sowieso jeder, der nicht gerade wie Tom Hanks in dem Robinsonade-Film Cast Awayallein auf einer Insel leben muss (aber Hanks’ Figur hält es auch nicht lange ohne diesen „Prozess“ aus, und so beginnt er mit einem Volleyball, den er Wilson nennt, zu reden, um nicht verrückt zu werden; während einen im richtigen Leben das allgegenwärtige Reden verrückt macht).
Ich kriege auch schon ganz gerne ab und zu Post, das kann ja eine willkommene Unterbrechung in einem öden Tagwerk sein. Das Problem mit diesen Mails ist ihre Zahl: Sie sind nicht mehr Unterbrechung, sie mausern sich – ja, zu was? Zu einer Epidemie? Ich weiß nicht wie viele Mails ich täglich bekomme. Denn warum sollte ich sie – verdammt noch mal! – auch zählen? Es sind zu viele. Der Bekannte sagte, er kriege im Moment 4 bis 5 Mails in der Stunde, das sind also etwa 40 am Tag und rund 8 Tausend im Jahr. Und wenn es nur 6 Tausend sind: Wer hat je davon gehört, dass der eigene Vater oder die Großmutter oder ein vielschreibender Goethe aus der Vergangenheit Tausende Briefe oder Postkarten oder Telegramme im Jahr bekommen oder geschrieben hätte? Haben sie, von Ausnahmen abgesehen, natürlich nicht, weil man sich damals noch etwas zu sagen hatte – oder schwieg.
MAIL IS WORK
Ich habe mich mal umgehört. Mails nehmen in der Angestelltenwelt zunehmend einen gehörigen Teil des Arbeitslebens ein, denn das Öffnen und Lesen und Beantworten dauert ja im Durchschnitt einige Minuten. Hinzu kommen jene Mails, die man selbst geschrieben hat und mit denen man dann möglicherweise weitere Kommunikation auslöst.
Kommunikation ist geheimnisvoll, auch die im Büro. Denn manchmal versandet sie und manchmal löst sie wie in einem Schneeballsystem Lawinen aus. In der Regel ist die Mail-Kommunikation aber die zwischen zwei oder mehreren Personen. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Manchmal hängt an der Mail eine Kette weiterer Mails, die man bislang nicht kannte und die man nun aufgefordert ist, zur Kenntnis zu nehmen, um die eigentliche Mail beantworten zu können. Das dauert dann ein paar Minuten mehr. Macht nichts. In der Zeit kommt eine weitere Mail – das „Pling!“ hat man ausgeschaltet, aber im Blickfeld unten rechts kündigt ein Info-Kasten den Mail-Eingang an –, vielleicht eine Mail ganz anderer Art, nämlich mit Bitten, Anforderungen, Fragen, Aufforderungen, Belegen, Informationen, Rechnungen, Text-Dateien, Einladungen und Absagen und wieder Einladungen. Auch das Leben auf Arbeit ist bunt und vielfältig.
Meine liebsten Mails sind „Bilder-Konferenzen“. Dann diskutieren Menschen beispielsweise über ein mögliches Cover-Motiv. Bei fünf Personen gibt es dann mindestens sechs Meinungen, und am Ende kann man sich auf kein Bild einigen. Bis dahin hat man aber eine erkleckliche Menge an Mails produziert. Und dann beginnt die Runde mit einem neuen Bild von vorne.
These: Mit der Zunahme der Teilhabe von allen an allem und der Abnahme der Hierarchien nehmen die Kommunikation und also der Mail-Verkehr zu. Wie sollte es auch anders sein? Aber Max Weber würde sich die Haare raufen und seine These von der Rationalität in den Institutionen zurücknehmen.
Mails können auch kryptisch tun. Dann steht da im Betreff: „Merle-Papier“. Welches Merle-Papier? Habe ich da etwas vergessen? Ich kenne jedenfalls keine(n) Merle. Aber da es sich um ein „Papier“ handelt, muss ich die Mail wohl öffnen, um herauszufinden, wie wichtig die Mail und das Papier sind und ob ich nicht überflüssigerweise nur auf einem cc-Nebenschauplatz gelandet bin. Doch ich lasse mir Zeit damit. Was nichts nützt. Denn man kann im firmeneigenen Mail-System sehen, ob die Mail „geöffnet“ wurde. (Ich weiß noch nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, dass das nicht jeder weiß.) Wenn man sich also stur und stumm stellt und nicht antwortet, dann kommt eine zweite Mail oder ein Anruf, oder man wird im Fahrstuhl coram publico angequatscht. – Es gibt kein Entrinnen.
„JETZT MACH DU WAS DRAUS!“
Das System nährt sich vor allem davon, was ich „Abwälzung“ nennen möchte. Mit einer Mail wälzt man ein Problem, den Beginn eines Projekts, das Unerledigte, aber flugs zu Erledigende an einen Kollegen ab, im Sinne von: „Jetzt mach Du was draus!“ Alle tun das. Es ist wie ein Zug beim Blitz-Schach: Man hat die Verantwortung für den Fortgang des Spiels an den Anderen übergeben. Ein perfekter, aber leider hinterfotziger Zug. Da kann nur ein langes Palaver folgen mit der Klärung von Zuständig- und Verantwortlichkeiten.
Einfach das Schlimmste ist die Überflüssigkeit der meisten Mails, sie simulieren Handlung und suggerieren, dass etwas weitergeht. Aber nichts dergleichen. Vor allem fressen sie Zeit für Wichtigeres. Sie sind die Antithese zum Wesentlichen im Leben. Soviel spüren wir, wissen wir. Vom Wesentlichen wissen wir nicht so viel.
Manchmal wünscht man sich, man könnte den Spamfilter anders einstellen, ganz speziell, er ließe nur eine Mail am Tag noch durch, die Einladung zu einer Feier: „Heute kleiner Sekt-Umtrunk um 15 Uhr im Foyer anlässlich meines Abschieds nach 15 Jahren in der Firma.“ Sekt? Nein, danach kann man die Arbeit ganz vergessen.
Manchmal kommt zu den Mails auch noch ein Brief hinzu, ein ganz altehrwürdiger teurer Brief mit Briefkopf und Anrede und Unterschrift, und man merkt gleich, dass der Absender schon etwas älter ist. Man legt den Brief ab – um ihn zu beantworten, wenn man mal Zeit hat zwischen den ganzen Mails, Telefonaten, Planungs- und Evaluierungstreffen, Fortbildungen, Brandschutzseminaren, Erste-Hilfe-Kursen, Betriebs- und Mitarbeiterversammlungen, Teamsitzungen, Atemübungen, Alexander-Techniken – und seiner „eigentlichen Arbeit“.
Doch vorher lädt dich die Gesundheitsbeauftragte vor und weist mit strengem Blick auf die hohe Zahl an Überstunden hin. Ihre Befürchtung: Aus dem White Collar Blues könnte sich ein Burnout entwickeln, der die Work-Life-Balance ganz gehörig aus dem Gleichgewicht bringt. Man klagt ihr notgedrungen sein Leid. Immerhin braucht man bei ihr nicht befürchten, dass sie eine neue Technologie ins Gespräch bringt, die das Tun erleichtert, das durch eine andere Technologie erschwert wurde. Sie schlägt stattdessen einen internen Mailverkehr-Kodex vor. Den bräuchten wir! Ob ich den nicht mitformulieren wolle…
EINE ENTSPANNUNGSÜBUNG ZUM SCHLUSS
Was kann man tun? Ich weiß es nicht. Aber eine Kollegin erzählte mir kürzlich, dass sie begonnen habe, am Computer ein Fotoalbum zu erstellen, das sie ihrer Tochter zum 18. Geburtstag schenken wolle. Nach einigen Tagen wurde ihr bewusst, dass sie diese Arbeit – das Suchen und Auswählen, Sortieren und Einfügen – nervös machte; sogar gewaltig nervös! Also druckte sie die vielen Fotos im Drogeriemarkt aus – es wurde ein dickes Paket, es kostete etwas Geld. Aber danach konnte sie die Fotos alle vor sich hinlegen, auf Tisch und Boden. Sie habe sie alle in die Hand genommen und betrachtet, und sehr oft stießen die Bilder Erinnerungen an, denen sie sich in aller Bequemlichkeit und mit aller Muße hingab. Und dann habe sie die schönsten Bilder in ein Album eingeklebt und etwas dazu geschrieben. Das sei ihr kein bisschen auf die Nerven gegangen und habe ihr großes Vergnügen bereitet.
Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Und mehr ist eigentlich nicht zu sagen.