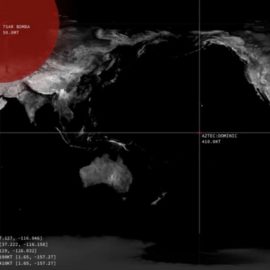Mitgift fürs Leben
Was gibt man seinem Kinde mit ins Leben? Es ist nicht so leicht, das herauszufinden. Eine Verzweiflungstat in knapp 900 Wörtern.
Etwas Wichtiges fehlt. Vor ein paar Wochen erhielt mein Sohn sein Reifezeugnis, und mich befällt das ungute Gefühl, dass ich ihm in den vergangenen bald zwei Jahrzehnten nichts, aber auch rein gar nichts mitgegeben habe außer einer halben genetischen Software, in der der Hang zur Melancholie eingeschrieben ist.
Was seit einiger Zeit vor meinem inneren Auge ständig aufscheint, das ist eine jener Vater-und-Sohn-Szenen aus einem amerikanischen Film – in der Bildproduktion aus Hollywood sind nicht alle Traditionen verdampft –, bei der, vorzugsweise am Lagerfeuer an einem See unter einem Himmel aus Millionen Sternen, eine Weisheit, eine Erfahrung, ein sich bewahrheitetes Lebensmotto von der älteren auf die jüngere Generation übergeben wird. Man hat sich den ganzen Tag durch den Wald gekämpft, Bären in die Flucht geschlagen, Rebhühner mit selbst gebasteltem Pfeil und Bogen erlegt – und plötzlich ist da eine Offenheit bei dem Jungen, der vorher kaum ein Wort mit seinem Dad sprach und das Wochenende in der Wildnis nur widerwillig akzeptierte, quasi als Erfüllung eines letzten Wunsches des Alten – und dann soll es auch endlich gut sein. Aber nun haben die Abenteuer die beiden zusammengeschweißt wie nie zuvor seit jener mythischen Zeit, als der Kleine noch aufschaute zum Großen und alles für Wundertaten hielt, was dieser vollbrachte. Und da ist beim Flackern der Flammen ein Zugang direkt zur Seele plötzlich offen, einen winzigen Moment nur, und dem Vater fällt dann auch das richtige Wort ein, vielleicht weil er es so lange schon auf der Zunge wägte, und nun empfängt es der Sprössling wie eine Hostie. So könnte es sein in einem Film.
DIE WAHRHEIT
In Wahrheit musste der Alte eine bittere Zeit durchleben. Zwölf oder dreizehn Jahre lang war er das Monument, das große Rund-um-die-Uhr-Vorbild, an dem das Kind hochschaute – doch von einem auf den anderen Tag wird er zur Null, zum Peinsack, in einem Eilprozess geht das Positiv durch das Entwicklerbad der Individuation, und heraus kommt ein Negativbild, das an Kenntlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. So muss es halt sein: Man wird entlarvt. Und es dauert Jahrzehnte, bis sich das Bild als Trug herausstellt und man als ein großes Geheimnis wiederentdeckt wird. Aber bis dahin steckt in jedem Blick, in jeder Geste des Sprösslings fortan soviel Verständnis, Nachsicht und Herzensgüte wie in einem Satz aus Kafkas Brief an seinen Vater.
Doch dann hofft man auf einen Verbündeten: den Verstand. Bald muss er sich doch melden, Zeichen geben, dass er bereit sei, Worte aufzunehmen, die den Beginn einer fairen Kommunikation bedeuten. Von einem herrschaftsfreien Diskurs kann der Vater in dieser Zeit und länger schon nur noch träumen, denn die Gesprächsverweigerung seines Sohnes lässt ihn am langen Arm kommunikativ verhungern. Eigentlich ist Schweigen ja ganz okay. Aber er würde so gerne etwas sagen. Etwas von Bedeutung. Und zumindest ein Ping! würde er gerne zurückschallen hören: dass er verstanden wurde.
Der Vater hat längst eingesehen, dass die Peer Group, die Schule und die vielen unbekannten jungen YouTube-Gurus mehr, ja, sehr viel mehr Einfluss ausüben auf seinen Sohn als er selbst. Aber ihn beschleicht halt unstillbar das Gefühl von einem letzten Wort, das noch nicht gesprochen wurde, das aber fehlt als Schlussstein dieses windschiefen Gebäudes, welches Erziehung heißt.
Erich Kästner sagte zum Abschied in einem Gedicht, er habe sich selbst erzogen. Das ist bemerkenswert. Aber er war auch Dichter. Das ist immer etwas anderes.
DER TROST
Was wollte er also noch alles sagen, vermitteln am Lagerfeuer? Den Rat, Homer zu lesen vor allen anderen? Die Warnung vor Frauen mit schwarzlackierten Fingernägeln? Die Fähigkeit zur Unterscheidung von Koryphäen und Koniferen? Irgendetwas, was den Jungen immunisiert gegen die kommenden brunnenvergiftenden Denkmoden? Es sollte etwas sein, das ihn trotz aller geschichtlichen Schrecken zum Menschenfreund macht. – Aber letztlich ist das doch alles sinnlos und irgendwie peinlich.
Wahrscheinlich würde dieser Lagerfeuer-Moment auch nicht mehr kommen. Dann könnte der Vater aber immer noch einen Brief schreiben, was andere ja auch schon getan haben. Matthias Claudius schrieb einen Brief, gespickt mit wunderbaren Sentenzen wie: „Es ist leicht zu verachten, Sohn; und verstehen ist viel besser.“ Böll schrieb auch einen Brief an seine Söhne – er geriet aber etwas lang. Das sollte vermieden werden, denn der Junge ist mit Kurznachrichten groß geworden. Vielleicht ginge das, ein letzter Versuch: Vergiss nie – das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Eine Weisheit (von Kierkegaard), ermutigend und verständnisvoll. Sie verbindet die Zeiten, die jeder selbst erleben muss, mit dem Augenblick gerade da am Lagefeuer, wenn man nichts weiter ist als der Vertreter einer Generation Alt und einer Generation Jung. Und wenn der Vater gerade anfängt, noch einmal darüber zu grübeln, ob das die Worte sind, die er sagen will, ob sie die Bedeutung tragen, die er weitergeben will, steht der junge Erwachsene auf, sagt, ihm sei kalt, trotz des Feuers, und er wolle ins Zelt, in den Schlafsack, denn er sei außerdem müde, und sie müssten ja morgen früh nachhause aufbrechen, und wer wisse schon, was noch an Abenteuern auf sie warten möge; und der Vater kann nur nicken, wissend, dass der Moment vorbei ist oder nie da war und nie kommen wird und ihm nur der Trost bleibt: dass er alles getan hat, als er gebraucht wurde und die schönen, kleinen, belanglosen, tröstenden, aufmunternden Worte des Alltags sprach, die gütigen, die strengen, die sorgenden – und die immerfort liebenden.