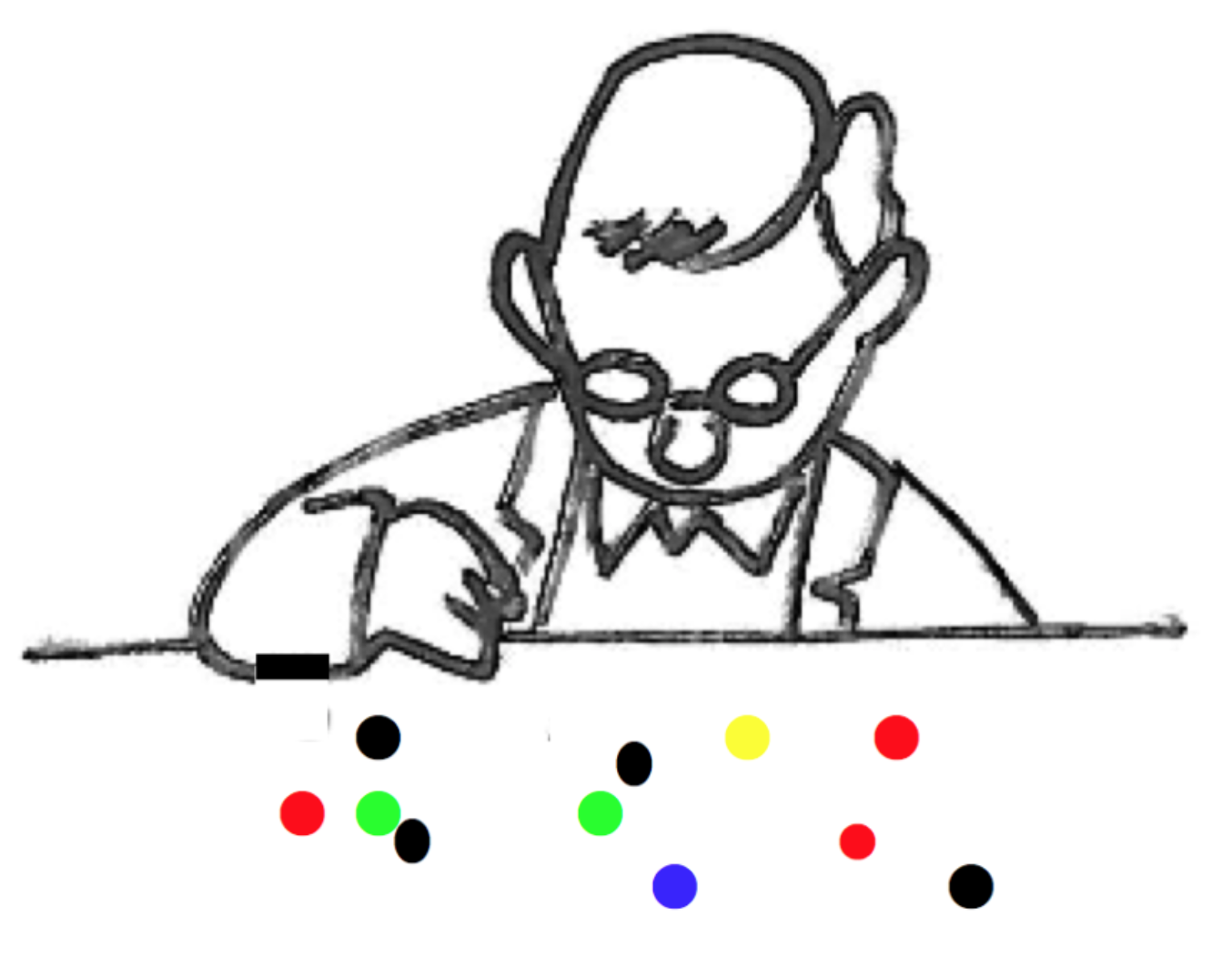Auf einem Hamburger Drogenmarkt
Vor dem „Drob Inn“ am Hauptbahnhof spielen sich täglich Szenen wie aus einem Apokalypse-Film ab.
Vor der Fixerstube „Drob Inn“ in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs wuseln etwa 200 Menschen, hauptsächlich Männer, rastlos herum. Drinnen kann man in Ruhe spritzen, draußen, auf dem Vorplatz, wird gehandelt und gehustled. Viele sind gebückt, mache habe aufgeschlagene Brauen und Nasen, Krücken, hier eskalieren oft brutale Schlägereien um fast nichts.
Ein alter Mann mit schwarzgrauem Bart und blutender Hand kriecht auf dem Boden herum und sucht heruntergefallene „Steine“, auf Kokain und Speed basierendes Crack. Es hat etwas Apokalyptisches von einer Armee der Finsternis. „Brauchst Du Steine?“, preisen manche an, besonders laut ein Marokkaner, wie ein paar Kilometer weiter Aale auf dem Hamburger Fischmarkt. Andere wollen „Schore“ verkaufen, Heroin.
Einer sagt: „Wer kauft Lyrica“ und „Vier 500er fünf Euro?“ Ein starkes, verschreibungspflichtiges, süchtigmachendes Medikament aus der Apotheke. Ein Mann hat irgendwo zehn Riesentafeln Milka-Schokolade aufgetan, er verkauft sie für neun Euro und holt sich davon Drogen. Viele haben kleine Crackpfeifen in der Hand und konsumieren offen.
So auch Yusuf aus Tschetschenien, der 2001 nach Deutschland kam. In seinen schmutzigen Händen liegen eine Crackpfeife und ein kleines Taschenmesser, mit dem er sie säubert.
„Mein Asyl wurde 2002 abgelehnt. Seitdem habe ich nie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Und seit 2015 wollen sie mich abschieben. Schon drei Mal haben sie mich in Handschellen in die russische Botschaft gebracht. Aber Russland sagt, meine Papiere seien noch nicht fertig. Ich will nicht zurück nach Tschetschenien, da gibt es für mich keine Zukunft.“
Eine Art Labor
Ein blonder deutscher Koch in Jogginghose mit aufgeschwemmten Drogengesicht hat ein blaues Auge, er ist groß und erzählt seinen Kumpels Kriegsgeschichten. Ein anderer Junkie schlug ihm das am Vortag aus dem Nichts, weil er dem keine fünf Euro leihen wollte. Nun hat er sich revanchiert und dem anderen Junkie den Kiefer gebrochen, während der gerade an seiner Crackpfeife zog. Da der Vorplatz des „Drob Inn“ komplett von Kameras überwacht ist, hat die Polizei alles aufgenommen. Die Süchtigen sind hier wie in einer Art Labor sich selbst überlassen, aber beobachtet. „Die wollen mich jetzt anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil ich Kampfsportler bin, sehen sie meinen Körper als Waffe an“, sagt der Koch.
Piero (53) ist staatenlos. Der Sinto steht hier in seinem Nadelstreifenanzug. Ein fein geschnittener Schnurrbart zieht sich über seine Oberlippe, das Haar schwarz zu einem Scheitel frisiert. Er sieht aus, wie ein verarmter Edelmann aus den 1920er-Jahren. Sein Vater ist Franzose, seine Mutter Tschechin, geboren wurde er in Italien.
Er hat keinen Pass. Das einzige, was er bei sich trägt ist ein Blatt, eine Meldeauflage, die seine Staatenlosigkeit amtlich bescheinigt. Bald muss er wieder beim Amt erscheinen. Unter der Rubrik der mitzubringenden Unterlagen steht nur „Dieses Schreiben“. Andere Ausweisdokumente hat er schließlich nicht. Er ist auf Methadon, aber holt sich noch manchmal Steine. „Du musst hier aufpassen, den Leuten hier ist alles egal. Wenn die Deine Kamera sehen, schlagen die Dich kaputt“, sagt er.
Am nahen Steindamm, wo Crack-Prostituierte sich für ein paar Euro verkaufen, unterhalten wir uns weiter.

„Ich spreche neun Sprachen. Ich bin seit kurzem in Hamburg, vorher war ich in Holland und Belgien. Hamburg hat mir jetzt Papiere für einen Monat gegeben. Dann muss ich wieder vorsprechen. Ich hatte mal einen belgischen Pass, aber den hat die belgische Polizei mir weggenommen, weil ich keinen festen Wohnsitz hatte. Sie mögen uns Zigeuner nicht. Schlafen gehe ich in Obdachlosenunterkünfte wie das Pik As. Ich halte mich über Wasser, indem ich ein bisschen handle und klaue. Ich will das nicht. Am liebsten würde ich als Diamantenschleifer arbeiten, das habe ich mal in Antwerpen gelernt. In Holland habe ich Asyl beantragt, aber die sagten, das geht nicht, weil ich Europäer bin.“
Er erzählt über seine Verwandten, eine alte Sinto-Familie, die unter den Nazis gelitten hat. Jetzt ist die Familie auf der Welt verteilt. Manche leben in Wohnwagen in der Schweiz, andere haben es nach Kanada geschafft. Er kann nicht zu ihnen ohne Pass. „Kannst Du mir helfen?“, fragt er.
Diese Eindrücke sammelte ich bei der Recherche für eine BILD-Geschichte über illegal in Deutschland lebende Menschen.