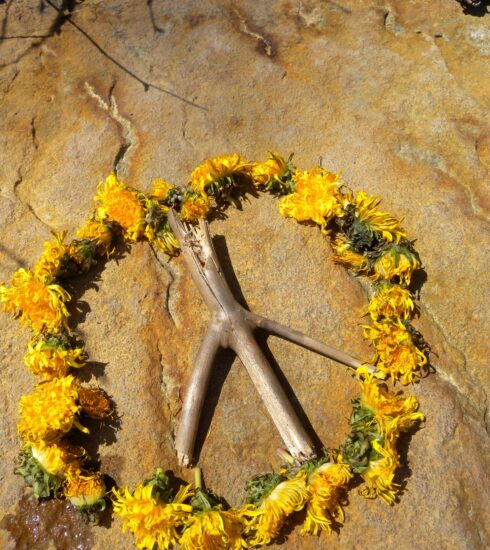Rechts-Irrtum
Für die FDP ging es 2017 steil bergauf. Zum Jahresende weiß allerdings niemand, wo die Partei mit ihren Erfolgen und sich selbst noch hin will. Besonders der Vorsitzende gibt kein gutes Bild mehr ab.
Wer es im Verlaufe des abgelaufenen Jahres mit der FDP gehalten hat, der musste dafür starke Nerven mitbringen. Allzu leicht verdeckt der Wiedereinzug in den Bundestag im Rückblick die Monate des Streits, der Verwirrung und der Zweifel, mit denen Sympathisanten und Mitglieder der Partei sich herumzuschlagen hatten. Und leider haben Verwirrung und Zweifel für viele seit Wahl nur noch zugenommen.
Das liegt, wie so vieles in der FDP, vor allem an Christian Lindner. Der Erfolg, den Lindner seiner Partei zurückbrachte, schuf bei aller Freude einen Strauß neuer Probleme. Wo jahrelang nur die Rückkehr in den Bundestag verbindendes Ziel gewesen war, stand nun die Frage im Raum, wo die Liberalen eigentlich dauerhaft ihren Platz im deutschen Parteiensystem sahen. Seit der Bundestagswahl, mithin seitdem fancy Wahlplakate allein nicht mehr genügen, kristallisiert sich zunehmend heraus, dass Lindner seine FDP als eine rechtsbürgerliche Alternative positionieren möchte: Links der AfD und von dieser durch professionelleren Umgangston, bürgerlicheres Auftreten und profiliertere Rechtsstaatlichkeit klar getrennt, aber auch deutlich rechts von Merkels CDU. Bis zum 24. September gab der Erfolg Lindner hier recht: Die riesige Wählerwanderung von der Union bewies, dass fünf Prozent plus X mit diesem Kurs allemal zu bewerkstelligen waren.
Die Geister, die er rief
Leider hat Lindner den Moment verpasst, um die von ihm gerufenen Geister wieder zu vertreiben (sofern das Teil seines Plans war). Von seinem bis heute rätselhaften Krim-Interview Anfang August über die Berichte aus den Jamaika-Sondierungen, nach denen die FDP plötzlich anfing, die Union rechts zu überholen, bis hin zu einem dpa-Interview letzte Woche, in dem Lindner mit der unglaublichen Aussage zitiert wird, Länder wie Polen oder Ungarn dürften mit „liberalen, bunten Lebensmodellen“ nicht „überfordert“ werden. Das irritierte. Hatte Lindner sich für das Interview schon Gaulands Hundekrawatte geborgt?
Nicht die Schuld der FDP oder ihres Vorsitzenden war, dass die Bundestagsverwaltung die Liberalen gegen deren erklärten Willen neben der AfD platzierte. Dass unter Lindner zuletzt trotzdem zusammenwuchs, was normalerweise nie und nimmer zusammengehören dürfte, machte allerdings der Deutschlandtrend von Anfang Dezember unmissverständlich klar: Während Lindners Zufriedenheitswerte insgesamt im Vergleich zum Vormonat um 17 auf jetzt nur noch 28 Prozent eingebrochen waren (bei Unionsanhängern halbierten sie sich auf 30), fanden inzwischen knapp zwei Drittel der AfD-Anhänger Lindner gut – ein Plus von satten 25 Prozent. Dabei war das eben erwähnte dpa-Interview hier noch nicht einmal berücksichtigt; es dürfte diese fragwürdige Entwicklung auch kaum gebremst haben.
Jamaika, Neinmaika
Zur strategischen Abirrung gesellt sich ein Kommunikationsproblem. Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat Lindner die Partei und vor allem sich selbst in eine Ecke manövriert, aus der keiner von beiden gesichtswahrend herauskommen dürfte. Man wollte nicht „schlecht regieren“, ließ man damals wissen, es mangele am Vertrauen. Substanzielleres war bis heute nicht zu hören. Auch der Nachgang war chaotisch: Erst schloss Lindner selbst einen zweiten Jamaika-Anlauf auch nach Neuwahlen kategorisch aus und fing im Laufe des Herbstes sowohl seinen Vize Kubicki als auch Generalsekretärin Nicola Beer wieder ein, die zumindest die Möglichkeit einer Neubetrachtung für den Fall ins Spiel gebracht hatten, dass auch Schwarz-Rot keine Regierung bilden könne. Zuletzt erklärte Lindner allerdings der Wirtschaftswoche, dass eine „geänderte politische und personelle Konstellation“ (Lindner selbst auf Twitter) nun vielleicht doch Grundlage für Jamaika II sein könnte. Bemühte Hinweise darauf, dass dies im Übrigen schon seit Wochen seine Meinung sei, machten die Sache für Lindner nicht besser; seine höfliche Umschreibung von „Merkel muss weg“ dürfte ihm zahlreiche weitere Sympathien im hellblauen Lager eingebracht haben. Auch Kubicki sekundierte inzwischen, die CDU brauche eine „personelle Erneuerung“.
Applaus und Schulterzucken
Man muss annehmen, dass die Opposition von Anfang an Lindners bevorzugter Ausgang der Bundestagswahl war, was seinerzeit auch durchaus dem Sentiment an der Parteibasis entsprach. Dank der Charmeoffensive auf dem rechten Flügel hat Lindner nach dem Jamaika-Aus jedoch einen Pyrrhussieg eingefahren: Die FDP muss zwar nicht regieren, kann anders als in Nordrhein-Westfalen aber auch schlecht als glaubwürdige Speerspitze einer bürgerlichen Opposition glänzen, wenn ständig die Banknachbarn von der AfD dazwischen applaudieren. Anstatt vier Jahre lang öffentliche Sympathien einzusammeln, droht nun eine programmatische Abnutzungsschlacht. Zumal die FDP auch an einer neuen Groko kaum legitime liberale Kritik formulieren kann: Wer lieber nicht regiert als schlecht, der muss damit leben, wenn andere noch schlechter regieren.
All das muss nicht heißen, dass die FDP in einer existenzbedrohenden Krise steckt. Acht Prozent sind jedenfalls noch kein Grund zur Panik. Mittelfristig täten die Partei und ihr Vorsitzender aber gut daran, ein politisches Angebot zu unterbreiten, das nicht nur rechts der Merkel-Wasserscheide in russlandvernarrten und europafeindlichen Kreisen verfängt. Denn erstens ist der Versuch, der AfD Wähler abspenstig machen zu wollen, eine reichlich verwegene Wette, und zweitens muss die Partei auch für den Tag planen, da Merkel irgendwann tatsächlich geht: Soll dann die FDP Seit‘ an Seit‘ mit der AfD stehen und Beifall klatschen?