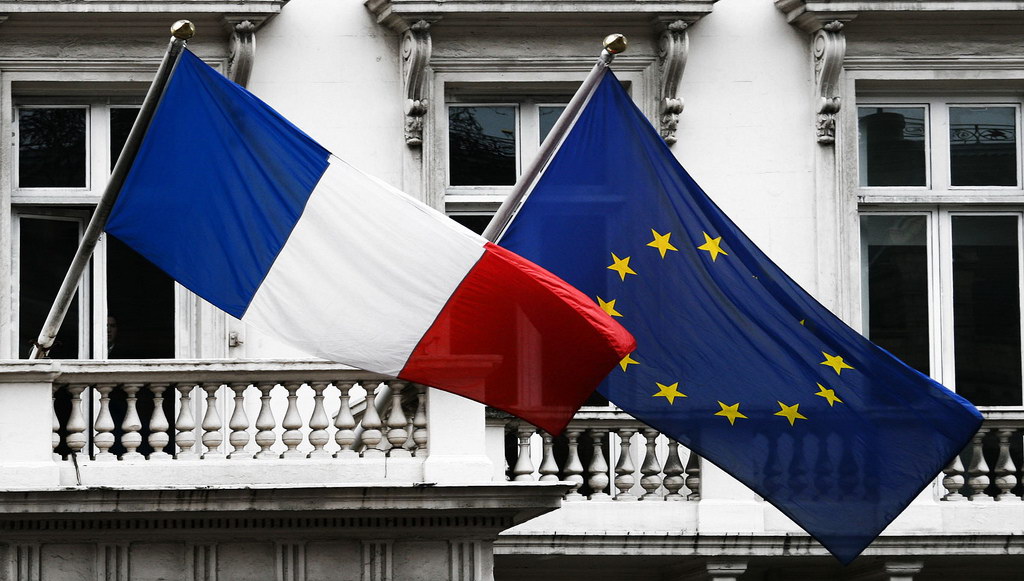So denken Trumper über ihren neuen Präsidenten
Seitdem Donald Trump im Amt ist, gibt es besonders in den großen Städten der USA Demonstrationen. Aber was denken die Menschen, die ihn gewählt haben? L.A. Chronicles VI.
US-Präsident Donald Trump (70) ist gerade mal rund zwei Wochen im Amt, hat mit seinem Füllfederhalter und seinem Smartphone „Breaking News“ geschaffen und die Hoffnungen vieler, die meinten, das Amt könnte ihn zähmen, zunichte gemacht. In der ersten Woche verging kaum ein Tag, an dem er nicht eines jener schon sieben Exekutiv-Dekrete unterschrieb, mittels der er am Senat und am Kongress vorbei Entscheidungen per Befehl trifft.
So hat er mal eben den (mindestens) 15-Milliarden-Dollar-Mauerbau an der mexikanischen Grenze befohlen. Auch kein Tag vergeht, an dem er nicht Tweets mit viel Bauchgefühl absetzt, die bei seinen Anhängern für Freude und bei seinen Gegnern für fassungsloses Kopfschütteln sorgen. Neulich kritisierten ihn seine republikanischen Parteikollegen, die Senatoren John McCain (80) und Lindsey Graham (61), scharf für seinen zunächst auf drei Monate beschränkten Einreisebann gegen Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern, den er – natürlich – per Dekret befohlen hatte.
Trump antworte per Tweet, die beiden sollten sich „lieber um ISIS“ kümmern und „nicht immer“ versuchen, „den Dritten Weltkrieg anzufangen“. Das kommt von einem Mann, der als oberster Befehlshaber des mächtigsten Militärs der Menschheitsgeschichte ohne Prüfungen, ohne Absicherungen und ohne zweite Meinungen tatsächlich ganze Länder in nukleare Wüsten verwandeln könnte.
Der Einreisebann wurde nun vorerst durch einen US-Bundesrichter gestoppt. Trump nannte den renommierten vom Parteikollegen George W. Bush eingesetzten Rechtsexperten daraufhin auf Twitter einen „sogenannten Richter“. Ein weiteres Beispiel: Weil die „New York Times“ über seine Lügen berichtete, hat Trump einen gewissen Drang entwickelt, die Publikation per Twitter anzugreifen. Eine seiner neuesten Tiraden: Jemand Vernünftiges solle das Blatt aufkaufen und in die Spur bringen, um diese „Lügenpresse“ („FAKE NEWS“) zum Schweigen zu bringen. Interessant auch deshalb, da es von Trump heißt, dass er kaum liest. Aufgrund der Politik und dem Auftreten Trumps gibt es landesweit Demonstrationen gegen ihn, besonders in den großen Städten.
Das denken Wähler
Aber was denken seine Wähler über seine ersten zwei Wochen im Amt? Ich habe mich in den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien umgehört. In Las Vegas, inmitten der Spielhöllen, ist es nicht schwer Trump-Unterstützer aus den ganzen USA zu finden. Der Schweißer Todd (50), ein gemütlicher Typ aus Texas, findet es gut, dass Trump „den ganzen Sch**ß durchschüttelt“. „Ja, ich bin für Trump. Er hat Amerika wieder auf Platz Eins gesetzt und das mag ich“, sagt Todd. Am Ende würde der Präsident sicherlich Fehler machen, aber Amerika „nach vorne“ bringen.

Der Pharmazeut Archie (53), ebenfalls aus Texas zum Spielen rübergekommen, groß und kräftig, kommt gerade vom Frühstück. Auch er bereut seine Wahl nicht, schließlich mache Trump ja nur „was er während der Wahl versprochen hat.“ Allerdings gibt es eine Sache, die ihm übel aufgestoßen ist. Der Vorschlag Trumps, die Mexiko-Mauer zu bezahlen, indem man mexikanische Waren mit Einfuhrzöllen von 20 Prozent belegt. „Wir sind die, die das am Ende bezahlen müssen“, sagt Archie. „Sie werden das einfach auf den Verkaufspreis rauflegen. Bestraft nicht das amerikanische Volk!“
Andererseits, so Archie, sei eine sicherere Grenze eine gute Sache. Er wohnt neun Meilen von Mexiko entfernt in einem Ort namens Welasco. „Da ist ein Fluss an der Grenze. Da können Sie bis zum Horizont das aufgeblasene Innere von Autoreifen sehen, mit denen die rüberkommen.“ Er erklärt dann, wie das geht mit den Autoreifen. „Einfach aufblasen und dann das Ventil mit Seife verschließen.“
Frank (72), ein ehemaliger Ingenieur aus dem kalifornischen San Diego, hat noch antikommunistische Propaganda mitbekommen und vermischt alles ein bisschen. Trump sei großartig, sagt er. „All diese verdammten Demokraten sind nur Wischiwaschi.“ Wie die Europäer würden sie nur reden und nichts machen. „Die Kommunisten werden alles übernehmen, wenn man sie nicht stoppt“, sagt Frank dann etwas wirr. Deshalb ist er auch für Trumps Einreiseregelungen, „um die ganzen Kommunisten draußen zu halten.“ Seine eigenen Vorfahren seien aus Deutschland gekommen. „Aber das war legal.“

Kaufmann Brian (41), dunkel getönte Brille, breiter New Yorker Akzent, ist aus dem „Big Apple“ vor fünf Jahren nach Las Vegas gezogen, „wegen der Waffengesetze“. Er sei ein „NRA-Guy“, ein Mitglied der „National Rifle Association“, die sich für das Recht der Amerikaner einsetzt, Waffen fast aller Art zu besitzen. Brian hat rund 30 Waffen und mit denen will er nach Herzenslust schießen, das kann er in Nevada. Er liebt alles, was Trump bis jetzt gemacht hat: „Seine Einwanderungsgesetze werden die besten der Welt sein.“
Zwischen den Trumpern sind natürlich auch jene, die ihn nicht gewählt haben und ihn geradezu hassen. Einer hofft, dass eine Kugel dem „ganzen Schrecken“ ein Ende machen würde, da Trump „sehr gefährlich“ sei und zwar auch „für die dummen Kapitalisten, die ihn lieben“. Ein Anderer, ein Veteran, der durch die fehlgeleiteten Kugeln eines Vorgesetzen in Afghanistan schwer verwundet wurde und vor einem Kasino seine Narben zeigt und bettelt, hat sich vor Wut ein „fuck you“ auf die Stirn tätowieren lassen.
Es fällt schwerer, Frauen zu finden, die für Trump gestimmt haben. Eine davon ist die Kundenbetreuerin Joy (52) aus Minnesota, die mit ihrem Mann, Tiefbauer Kelly (53), auf einer Harley für Urlaub in den Süden gekommen ist. Ihr Leben habe sich in den letzten Jahren verschlechtert. Alles sei teurer geworden, der Lohn aber nicht gestiegen. „Er macht das wunderbar“, sagt Joy über Trump. „Er erfüllt seine Wahlversprechen und hält sich nicht zurück.“ War sie nicht empört darüber, wie Trump sich über Frauen geäußert hatte, denen man als reicher Mann einfach „an die Pu**y“ fassen könne?

„Nein und dabei bin ich empfindlich“, sagt Joy. „Ich war empörter darüber, was ich gestern Abend in Las Vegas gesehen habe, die ganze Nacktheit.“ Las Vegas wird von den Amerikanern auch „Sin City“ genannt.
Ihr Mann ist ein bisschen vorsichtiger. Er hätte auch für Trump gewählt, ist aber nicht zur Wahl gegangen, weil er dachte, dass Trump so oder so keine Chance haben würde.
Jetzt hat Kelly die Sorge, dass Trump „den Topf ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu heiß“ anrühre.
Trumps Turm
Nicht weit von den Kasinos, in der Nähe des legendären „Strips“, steht golden in der Sonne eines von Donald Trumps Hotels. Es ist ein schönes Gebäude, gerade im Vergleich zu den gigantischen Häusern mit angeschlossenen Spielhallen wie „Treasure Island“ und „Mirage“. Ein Zimmer gibt es ab 290 Dollar. Das Drei-Raum-Penthouse macht 2427 Dollar die Nacht.

Im Hotel ist auch ein Trump-Fan-Shop. Seine rote „Make America Great Again“-Mütze (30 Dollar) ist ausverkauft und darf nicht mehr nachbestellt werden. „Der Wahlkampf ist vorbei“, sagt eine Verkäuferin.
Vor dem Hotel steht gerade Craig (55) und versucht, Kredite zu verkaufen. Er trägt ein günstiges Jacket und Sonnenbrille. Ja, er habe Trump gewählt. Er fragt dann, ob die „B.Z.“, für die ich recherchiere, ein linkes Blatt sei. Ich sage, wir versuchen, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. So wie ihn. „Trump kriegt viel Gegenwind, aber er geht keinen Schritt zurück“, sagt Craig. Er hoffe, dass Trump der Mittelschicht helfen wird, indem er „Bestimmungen, Vorschriften und Regeln“ abbaut.
„German Motors“
Ein paar hundert Meter vom Hotel entfernt ist eine Autowerkstatt. Sie heißt „German Motors“. Hier ist ein Mann Chef, der sich, vielleicht im Gegensatz zu Wählern wie dem Waffenfan Brian und dem Kommunisten-Fresser Frank, tiefe Gedanken zu seiner Wahl gemacht hat und diese auch ausdrücken kann. Er nimmt sich eine Stunde Zeit, um diese dem Reporter aus Deutschland zu erklären.
„Ich dachte immer, es wäre klug, einen Geschäftsmann die USA leiten zu lassen“, sagt Danial (42). „Um wirkliches Talent zu bekommen, müsste man ihm 20 Millionen Dollar im Jahr zahlen, um den wichtigsten Job der Welt zu machen.“ Jetzt ist er froh über Trump. Danial, ein muskulöser Mann mit klugen Augen und Lederjacke, redet dann über Bürokraten-Politiker, die er satt habe. „Die schützen vielleicht einen pinken Schwan in Georgia und machen meine Geschäfte kaputt.“ Danial glaubt, dass „wir mit Trump etwas Historisches“ erleben werden. Er habe noch nie einen Präsidenten schon in den ersten Wochen so hart arbeiten sehen: „Die meisten hier in der Firma haben Trump gewählt. Dabei komme ich ursprünglich aus Kanada. Ich glaube an Gesundheitsversorgung. Ich habe 2008 Obama gewählt.“
Barack Obamas Gesundheitsreformen, die den Armen Zugang dazu ermöglichten, hätten aber die Versicherungsprämien für die Einzahler in die Höhe schießen lassen. Früher habe er für seine rund 15 Arbeiter freiwillig die Hälfte der Prämien bezahlt. Jetzt könne er sich das nur noch für die eigene Familie leisten. Er mag Trump. „Die anderen reden nur und machen nichts. Trump ist ein reiner Macher.“ Danial glaubt daran, dass jeder Einzelne eine gewisse Grundversorgung bekommen sollte, wie es in Deutschland der Fall ist. „Ich glaube aber, Trump wird das besser schaffen als seine Vorgänger, weil er ein Präsident des Volkes ist und nicht von Interessengruppen.“

Danial wählte 2008 Obama, jetzt Trump Foto: Til Biermann
Danial hat auch kein Problem damit, dass Trump, anders als alle Präsidentschafts-Kandidaten seit den 1970ern, nie seine Steuererunterlagen veröffentlicht hat. „Ich will einen Präsidenten, der Steuern so sehr hasst wie ich.“ Natürlich sei Trump „kein perfekter Mensch“, der auch Fehler machen würde, der die „Schmutzarbeit“ macht. Am Ende würde Trump vielleicht sein „wie eine bittere Pille“, die man schlucken muss, wenn man krank ist. Erst sei es ein bisschen unangenehm, aber dann könne man gesund werden. „Sowieso“, sagt Danial, „wie bisher wäre es nicht weitergegangen. Hillary Clinton wäre nur mehr vom Selben gewesen.“
Dass manche Deutsche sich Sorgen machen wegen Trump, versteht er. Er sei „eigentlich selbst Deutsch“, seine Mutter sei in Deutschland geboren worden, fast alle seine Vorfahren kamen irgendwann aus diesem Land nach Kanada. „Wir zahlen für Militärbasen in Deutschland, Südkorea, Japan. Finanziell ist das nicht vernünftig. Vielleicht haben die Deutschen jetzt Angst, dass sie sich selbst um ihre Probleme kümmern müssen.“
Zum Abschied sagt Danial: „Vielleicht wird er versagen, vielleicht wird er Erfolg haben, lasst uns das Beste hoffen. Es ist nicht gut zu hoffen, dass der Pilot eines Flugzeugs abstürzt.“
In Baker
Auf dem Weg von Las Vegas nach Los Angeles liegt mitten in der Wüste ein Örtchen namens Baker, das eigentlich eine Ansammlung von Tankstellen, Alkohol-Läden und Fressbuden mit Namen wie „Mad Greek“ ist. Vor einem „Liquor Store“ steht Bradley (41) aus Orange County, der gerade mit einem Kumpel und seinem weißen Mercedes-SUV in der Wüste war und mit einer modifizierten M16-Kriegswaffe geballert hat.
„Eine Meile außerhalb von Ortschaften ist das erlaubt“, sagt er. „Man muss nur einen Hügel finden, in den man reinschießt.“ Bradley trägt einen Ziegenbart und riecht ein bisschen nach Schnaps. Auch er hat Trump gewählt. „Der Dow Jones geht nach oben, das zeigt, dass alleine sein Geschäftssinn den Glauben in unsere Wirtschaft gestärkt hat. Willkommen zurück in Amerika!“, sagt Bradley.

Kommt gerade vom Schießen aus der Wüste: Bradley Foto: Til Biermann
Tatsächlich ist der US-Aktienindex nach der Amtseinführung am 20. Januar leicht gestiegen, aber auch schon wieder leicht abgesackt. Trumps Ankündigungen hoher Einfuhrzölle und Firmen zu zwingen, in den teuren USA zu produzieren, verschrecken manche Anleger.
Bradley kommt aus einer Militär-Familie, in der „Respekt groß geschrieben“ wird, sagt er: „Die Medien sollten ihm eine faire Chance geben und ihn als unseren Präsidenten respektvoll behandeln.“
Los Angeles
In Los Angeles haben 1.893.770 Millionen Menschen Hillary Clinton gewählt, nur 620.285 Trump. Hier ist es schwerer, Trump-Unterstützer zu finden. Laura (60), Redakteurin eines kleinen Lokal-Online-Portals, ein Alt-Hippie mit Hut, schüttelt nur den Kopf, als ich sie frage, ob sie Trump gewählt habe. Sie sitzt gerade an dem Basketball-Platz am Venice Beach, an dem der Film „Weiße Jungs bringen’s nicht“ (1992) mit Woody Harrelson (55) und Wesley Snipes (54) gedreht wurde.

Sonnenaufgang über Los Angeles Foto: Til Biermann
Sie lebte 30 Jahre hier direkt am Pazifischen Ozean bevor sie in den Norden nach Minnesota zog. Sie ist gerade zu Besuch in der alten Heimat. „Trump ist ein sehr gefährlicher Mann“, sagt sie. „Ich hoffe, wir kommen da irgendwie durch.“
Ein Bewohner der Stadt, der sich jedoch auch schon im Wahlkampf öffentlich zu Donald Trump bekannt hatte, ist der aus Deutschland stammende Prinz Frédéric von Anhalt (73), der einst seinen Adelstitel von einem Titelhändler kaufte, aber nie dafür bezahlte.
Er lebt in der Villa ganz oben in Bel Air, in der Michael Douglas (72) und Matt Damon (46) „Liberace“ (2013) drehten. Hier kümmerte er sich bis vor kurzem um seine im Dezember mit 99 Jahren verstorbene schwerkranke Frau Zsa Zsa Gabor.
Prinz Frédéric kennt Trump seit langem und war zu den Amtseinführungs-Feierlichkeiten in Washington. „Außer mir war aus Hollywood nur Caitlyn Jenner eingeladen“, sagt er stolz. Caitlyn hieß mal Bruce und ist Teil des Kim-Kardashian-Clans. Jetzt ist der Prinz ein bisschen ernüchtert. „Er hält seine Wahlkampfversprechen ein. Aber eine Mauer zu bauen, das finde ich nicht gut“, sagt er. Die, die aus Mexiko rüber kommen wollten, würden das sowieso irgendwie weiterhin schaffen. Außerdem seien die Mexikaner, mit denen er „seit über 30 Jahren“ zusammenarbeite „tüchtige“ Leute. „Sie sind sauber und wollen am Ende des Tages nur Essen auf dem Tisch für die Familie“. Auch den Einreisebann findet er schwierig. „Wir sind ein Land von Einwanderern. Ein großes Land mit viel Platz.“

Prinz Frédéric war bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Foto: Til Biermann
Grundsätzlich steht er aber weiterhin zu seinem Präsidenten. „Er ist erst die zweite Woche im Amt und schauen Sie mal, was er schon alles gemacht hat!“ Trump anzugreifen bringe nichts, man müsse „mit ihm reden.“ Denn: „Wer ihn kritisiert, wird gefeuert. Bei Trump gibt es für Erwachsene keine zweite Chance.“
Der Prinz hat die Erbangelegenheiten geregelt. Er bekommt Zsa Zsas Millionen und wird bis Ende des Jahres sein Riesenhaus in Bel Air verkaufen. Stattdessen hat er sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung am feinen Wilshire Boulevard in der Stadt besorgt. Und ein Anwesen in Brandenburg. „Dort will ich meine letzten Tage verbringen. Brandenburg gehört ja den Anhaltinern, so bleibe ich meinem Erbe treu.“
„Teherangeles“
In „Teherangeles“, dem iranisch geprägten Stadtteil Westwood, gibt es einige iranischstämmige Händler, die Trump ihre Stimme gaben und das in keiner Weise bereuen. Einige sind Juden, die vor der islamischen Revolution von 1979 aus ihrer Heimat flohen. Und auch ein paar muslimische Anhänger des Schahs von Persien, der von den Islamisten vertrieben wurde. Sie hoffen, dass Trump dem Iran gegenüber einen heftigeren Standpunkt einnimmt, als Obama das tat.
Einer hat lange in Hamburg gelebt, im großen Stil Teppiche verkauft. „Was soll ich bereuen?“, fragt er. Man solle Trump ein bisschen Zeit geben. „Weißt Du“, sagt er dann ein bisschen traurig. „Ich habe keinen einzigen Freund aus meiner Zeit in Hamburg. Hier in den USA sind die Menschen offener.“ Im Viertel lebt auch Michael (63), der in Immobilien macht, ein religiöser, aus England eingewanderter Jude, der eine schwarze Kipa auf seinen weißen Haaren trägt. Er spricht Deutsch, das hat er in England in der Schule und von seiner Mutter gelernt, die vor Hitler entkam. Er sagt: „Ich bin Republikaner und Trump macht das wunderbar.“ Er ist die Minderheit einer Minderheit. Nur knapp ein Viertel der in Amerika lebenden Juden wählten Trump.

Michael erklärt vor seinem Häuschen in Westwood seine Sicht der Dinge Foto: Til Biermann
„Amerika ist wie ein sanfter Riese“, findet er. „Dieser sanfte Riese braucht auch einen Knüppel, sonst schubsen ihn unfreie Länder wie Iran, Russland und China herum.“ Er glaubt, dass Trump dieser Knüppel ist.
Gräben vertieft
Die Wochen nach Trumps Amtsübernahme haben die Gräben zwischen den Wählern sich eher noch vertieft. Seine Anhänger feiern ihn als einen „Politiker, der endlich mal macht, was er auch versprochen hat.“ Seine Gegner hoffen im extremen Fall auf seinen Tod.
Am Ende fand ich dann noch einen Wähler, der nicht GANZ in seinem Lager geblieben ist. Er heißt Max, ist in seinen 30ern. Mehr will er nicht öffentlich machen, denn die ganze Sache ist ihm unangenehm. „Ich habe Trump gewählt, aber das war eine Wahl GEGEN Clinton“, sagt er. „Ich war nie ein Fan von Trump.“ Er wählte gegen Clinton, weil ihn der „Nepotismus“, die Klüngelwirtschaft dieser Familie störte. Außerdem glaubte er, Clinton wäre schlecht für die Wirtschaft. Und dass sie seiner Meinung nach nicht pro-israelisch sei. Jetzt wünscht Max sich, er hätte gar nicht gewählt. „Ich bin frustriert davon, dass Trump sich in keiner weise präsidentenhaft verhält“, sagt er. „Ich war davon ausgegangen, dass er seinen Ton ändern würde, sobald er das Amt übernimmt, aber da lag ich falsch.“
Diese Reportage erschien zuerst in kürzerer Form in der „B.Z. am Sonntag“