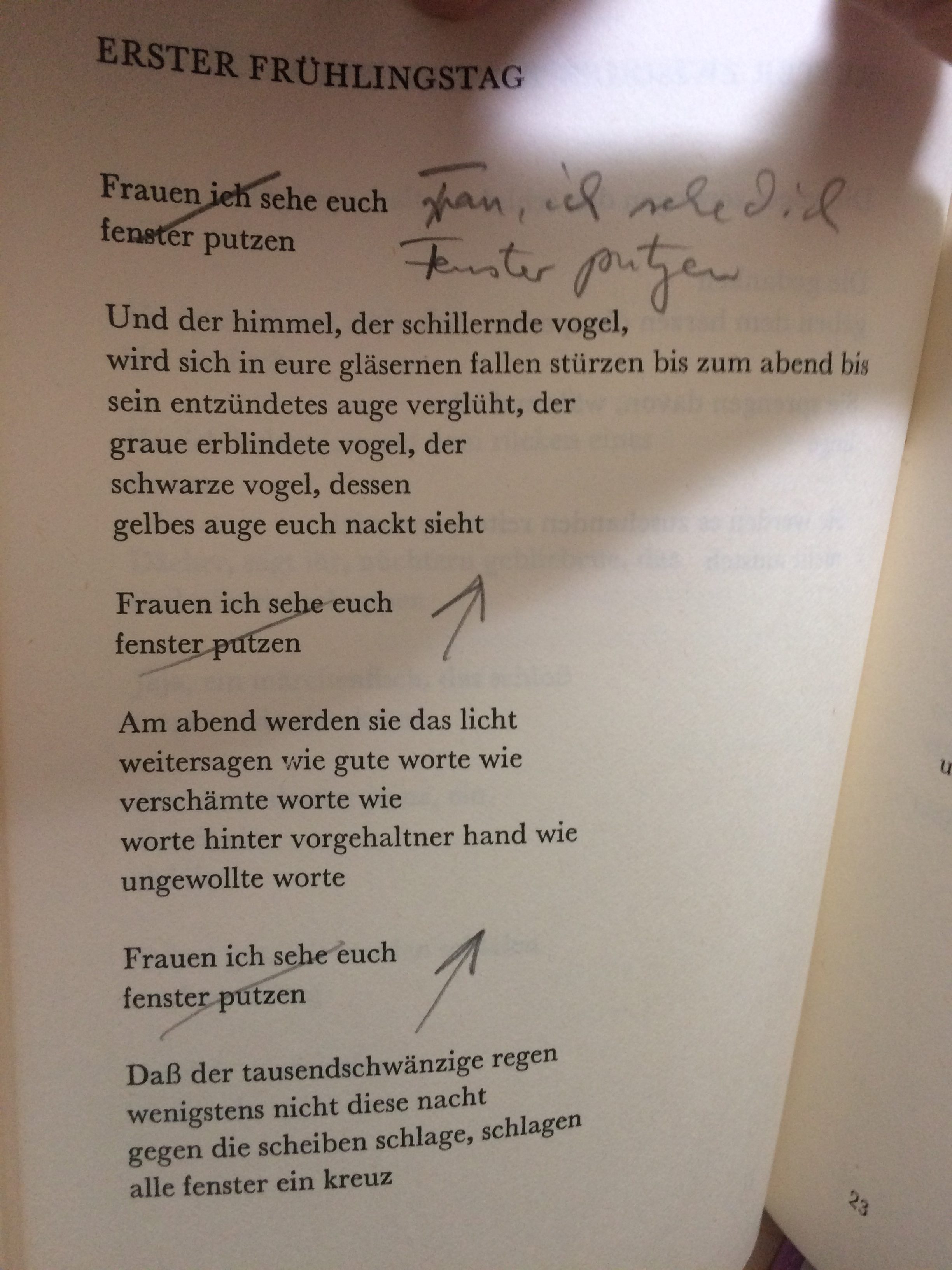The Antiamerican Dream
Donald Trump befeuert ein altes und mächtiges Ressentiment. Doch wer Amerika hasst, dem ist es egal, wer im Weißen Haus das Sagen hat.
Es ist dringend Zeit, über Antiamerikanismus zu sprechen. Das Ressentiment hat gerade Hochkonjunktur. Der neue US-Präsident senkt die Hemmschwelle für jeden Antiamerikaner. Die einschlägig negativen Gefühlswallungen gegenüber der Nation, die die erste funktionierende deutsche Demokratie installierte, können so einfach wie selten zuvor als realpolitische Analysen getarnt unters Volk gebracht werden, das seinen einstigen Befreiern nie so richtig vertraute. Beispiel: „Wer dieser US-Politik nicht entgegentritt, macht sich mitschuldig“. Der Westen sei kleiner geworden, „mindestens ist er schwächer geworden“. Man habe es, so der Urheber der vorangegangenen Zitate, mit einem „Ausfall der Vereinigten Staaten“ auf der Weltbühne zu tun.
Oder hier: Trump sei ein „Zerstörer aller westlichen Werte, wie wir es in dieser Form noch nie erlebt haben“. Seine Strategie richte sich gegen Toleranz, Respekt und Zusammenarbeit zwischen den Völkern. „Man muss sich einem solchen Mann mit seiner Aufrüstungsideologie in den Weg stellen“. Der amerikanische Präsident verfolge eine „fatale Aufrüstungslogik, die er uns aufzwingen will“.
Diesen Brei aus Krokodilstränen und Widerstandskampf rührten der ehemalige und der neue Vorsitzende der SPD an. Der erste Zitatblock geht auf Außenminister Sigmar Gabriel zurück, der zweite auf Kanzlerkandidat Martin Schulz.
Auch die Kanzlerin hat sich die Tage zum Thema geäußert. In einem Bierzelt sagte sie vor rund 2000 Anhängern der CSU: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt, und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen.“ Da war der desaströse G7-Gipfel, bei dem sich alle versammelten Staatschefs am neuen amerikanischen Präsidenten die Zähne ausbissen und verzweifelten, gerade wenige Stunden vorbei.
Betriebssystemfehler im Weißen Haus
Beim ersten Hören oder Lesen könnte man alle Statements von Gabriel, Schulz und Merkel für sehr ähnlich halten. Beim zweiten oder dritten Anlauf wird deutlich, dass sie grundverschieden sind. Bei Gabriel und Schulz gibt es einen Unterton, der erkennen lässt, dass sie in Donald Trump die Erfüllung ihrer schmutzigen antiamerikanischen Phantasien erkennen. Merkels Statement klingt eher so, als bedauere sie eine Art Betriebssystemfehler im Weißen Haus. Während die Sozialdemokraten die diskutierte Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Rahmen des von Deutschland mitbeschlossenen Zwei-Prozent-Ziels der NATO als amerikanische Erpressung Deutschlands deuten und ihrem Publikum verkaufen, geht die Kanzlerin in eine völlig andere Richtung. In ihrer Logik ist die Fähigkeit zur Selbstverteidigung ein wichtiger Schritt hin zu echter europäischer Souveränität, die sie angesichts der diversen Bedrohungen des Kontinents – vornehmlich Putins Russland und ISIS – für dringend geboten hält.
Die Diskrepanz der Reaktionen innerhalb der deutschen großen Koalition wird noch deutlicher, wenn man ein Zitat der gerade aus ihrem Parteiamt geschiedenen SPD-Generalsekretärin hinzuzieht. Katarina Barley, seit Freitag Familienministerin, warf Merkel vor, ihre Kritik an den USA sei eine Inszenierung: „Es ist keine Kunst, im Bierzelt über Donald Trump zu schimpfen.“ Haltung, so belehrte die SPD-Politikerin, müsse man im direkten Aufeinandertreffen bei den großen Gipfeln zeigen. „Und genau da knickt Merkel vor Trump ein. Sie hat erst dann den Mut, deutliche Worte zu finden, wenn Trump schon wieder weit weg ist.“ Spätestens jetzt ist klar, wohin die sozialdemokratische Irrfahrt geht. Ausgerechnet Putin-Freund Gerhard Schröder wird als leuchtendes Vorbild gepriesen. Wie und dass es anders gehe, habe der 2003 mit seinem Nein zum Irak-Krieg bewiesen, tönt die SPD-Generälin auf Abruf.
Trump ist kein verschärfter George W. Bush
Daher weht nämlich der Wind: In völliger Verkennung der Lage zeichnen die Sozialdemokraten Donald Trump als eine Art verschärften George W. Bush. Gemeinsam haben beide jedoch nur, dass sie in Deutschland perfekte Projektionsflächen für antiamerikanische Ressentiments sind. Ansonsten verhalten sich Trump und Bush jr. zueinander wie Dagobert Duck und Klaas Klever oder, um im deutschen Diskurs zu bleiben, wie Claudia Roth und Christian Lindner. Doch solche Feinheiten spielen keine Rolle mehr, wenn außenpolitische Grundsatzfragen auf Bundestagswahlkampf treffen.
Es mag sein, dass Bushs Irak-Krieg grundfalsch war, wenn auch die Bilanz weit komplexer ist, als im deutschen Nationalkonsens gemeinhin vermutet wird. Nur kann man Bush beim besten Willen nicht vorwerfen, beispielsweise verächtlich auf den Islam geschaut zu haben. So sagte der damalige US-Präsident kurz nach den verheerenden Terroranschlägen auf das World-Trade-Center und das Pentagon im September 2001:
Islam ist Frieden. Wenn wir an den Islam denken, so denken wir an eine Religion, die einer Milliarde Menschen in der Welt Trost spendet, die alle Rassen zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Amerika hat Millionen von Muslimen unter seinen Bürgern. Muslime leisten einen unglaublich wertvollen Beitrag zu unserem Land. Sie sind Ärzte, Rechtsanwälte, Juraprofessoren, Soldaten, Unternehmer, Ladenbesitzer, Mütter und Väter. Frauen, die in diesem Land ihren Kopf verhüllen, müssen sich wohlfühlen, wenn sie das Haus verlassen.
Noch einmal zum Mitschreiben: Diese Worte stammen von George W. Bush, der in Deutschland bis heute als rechtsextremer Irrer gilt, der mit verabscheuungswürdigen Motiven im Nahen Osten militärisch interveniert habe. Diese Zeilen lassen jedoch eher darauf schließen, dass er Muslime für genauso demokratiefähig wie Amerikaner hielt und das Elend der Region bei den Diktatoren sah, die ihre Völker misshandeln, nicht jedoch bei der Religion.
Bush glaubte an den Westen
Auch war Bush keiner, der den Westen und seine Institutionen verabscheute, wie es Trump mehr oder weniger offen tut. Mit der UNO, die eben nicht westlich dominiert ist, sondern von einer Vielzahl diktatorischer Regime, hatte er aus besten Gründen Probleme. Auch heute blockiert deren sogenannter Sicherheitsrat jeden Fortschritt in Syrien.
Es ist deshalb unanständig, Trump und Bush in eine Reihe zu stellen – auch wenn beide auf dem Ticket der Republikaner unterwegs waren bzw. sind. Die Sozialdemokraten tun das, weil sie in Trump ihr typisches Amerika zu erkennen glauben – eine Nation von intellektuell zurückgebliebenen, schießwütigen und rassistischen Isolationisten. Sie sind Opfer ihres Ressentiments. Sie bedauern nicht den hoffentlich nur vorübergehenden Zusammenbruch der transatlantischen Brücke, sie begrüßen ihn sogar insgeheim. Die USA waren und sind ihnen schon lange nicht geheuer.
Und wenn sie sich jetzt in schönster Projektionsleistung über einen „Zerstörer aller westlichen Werte“ mokieren, sollten sie vielleicht erstmal die bis heute von ihnen nicht einmal zart kritisierte demonstrative Freundschaft ihres Ex-Kanzlers und -Vorsitzenden Gerhard Schröder zu Putin hinterfragen. Der jedenfalls findet Trump prima. Und der Mann aus Moskau hat es wirklich auf den Westen abgesehen.