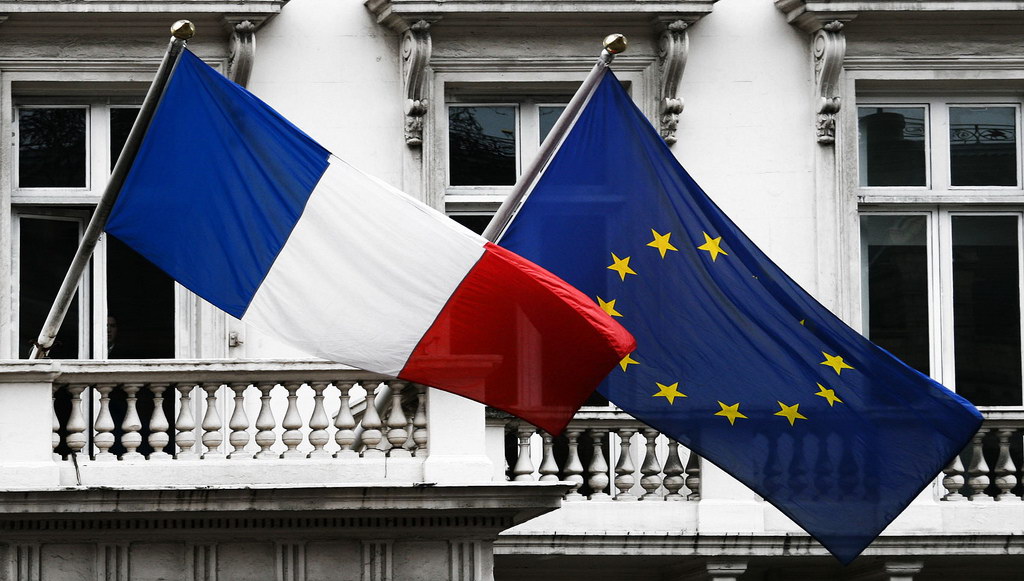Von »Nafris«, Dilemmata und Basta-Attitüden
Anders als ein Jahr zuvor kam es in der Kölner Silvesternacht diesmal nicht zu massenhaften sexualisierten Übergriffen auf Frauen. Dafür wird nun heftig über die polizeilichen Mittel gestritten, die zur Verhinderung neuerlicher Gewaltexzesse eingesetzt wurden. Völlig angemessen finden sie die einen, diskriminierend die anderen. Einige Anmerkungen zu einer verfahrenen Diskussion.
Es ist nicht ganz einfach, sich in der emotional geführten Debatte um den Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof zu Silvester einen Überblick darüber zu verschaffen, was überhaupt genau geschehen ist. Denn die Angaben und Einschätzungen von Verantwortlichen und Berichterstattern weichen teilweise doch erheblich voneinander ab. Unstrittig ist, dass sich der Einsatz auf junge Männer konzentrierte, die von der Polizei aufgrund äußerlicher Merkmale wie der Hautfarbe als »Nordafrikaner« ausgemacht wurden. Mehrere Hundert von ihnen wurden kontrolliert. Über die Gründe und die Auswahlkriterien dafür gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Die Polizei sagt, maßgeblich sei das Verhalten der Betreffenden gewesen. Schon früh am Abend hätten am Bahnhof Gruppen von »Nordafrikanern« herumgestanden, die alkoholisiert und aggressiv gewesen seien, vor allem gegenüber Einsatzkräften. Es habe eine Eskalation gedroht wie vor einem Jahr, weshalb man schließlich zahlreiche Platzverweise ausgesprochen habe.
Einige Journalisten, die vor Ort waren, hatten dagegen andere Eindrücke und kamen zu anderen Urteilen. Ihnen zufolge war nicht das konkrete Verhalten entscheidend für eine Kontrolle, sondern ausschließlich die Zuordnung zu den »nordafrikanischen« Männern. Christoph Herwartz beispielsweise schreibt, die Polizei habe zwei Ausgänge aus der Bahnhofshalle in Richtung Innenstadt geöffnet und anhand der Hautfarbe entschieden, wer welchen zu benutzen hat: »Wer nicht im engeren Sinne weiß ist und nicht in Begleitung einer Frau, muss fast immer die rechte Tür nehmen, die anderen die linke Tür.« Die Sortierung habe dabei ein Polizist »innerhalb von Sekundenbruchteilen« vorgenommen, »ohne denjenigen vorher beobachtet zu haben«. Sebastian Weiermann kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Auch er berichtet, es seien allein Äußerlichkeiten gewesen, die zur Entscheidung führten, wer kontrolliert wird: »Wer einen etwas dunkleren Hauttyp hat, muss den rechten Ausgang nehmen und landet im Kessel.«
Man wird wohl davon ausgehen dürfen, dass es tatsächlich nicht in jedem Fall aggressives Benehmen (oder die Zugehörigkeit zu einer aggressiv auftretenden Gruppe) war, das zu einer Kontrolle führte. Sondern vor allem die Übereinstimmung mit dem Profil derjenigen, die vor einem Jahr am selben Ort zum gleichen Anlass für eine Vielzahl von sexualisierten An- und Übergriffen auf Frauen verantwortlich waren. Dieses Profil stellte sich in etwa so dar: männlich, zwischen 18 und 35 Jahren, vermeintlich »nordafrikanisches« Aussehen, ohne weibliche Begleitung. Dass die Polizei Personen mit diesen Eigenschaften an diesem speziellen Tag und an diesem speziellen Ort besonders aufmerksam in Augenschein nahm, ist zunächst einmal nachvollziehbar, weil sachlich begründet. Denn es ist evident, dass zahlreiche Männer mit diesem Profil in der Kölner Silvesternacht des Jahres 2015 so viele Ähnlichkeiten gefunden hatten, dass sie sich aus eigenem Antrieb zu gemeinschaftlichen, bandenförmigen Angriffen entschieden.
Waren die Kontrollen unzumutbar?
Sie haben sich seinerzeit also selbst zu mehreren Gruppen zusammengefunden und die Übergriffe in Kollektiven verübt. Ihre Übereinstimmungen waren dabei ideologischer, politischer, religiöser Natur – also solcher, die auf dem Bewusstsein gründen –, aber auch sozialer, biografischer, geschlechtlicher, nationaler, äußerlicher, altersmäßiger, was sich der eigenen Einflussnahme weitgehend entzieht, aber als identitärer Faktor individuell und kollektiv überhöht werden und selbst zur Ideologie gerinnen kann. Die Tatsache, dass nun erneut zu Silvester viele Männer, die dem genannten Profil entsprechen, in Gruppen nach Köln reisten oder sich dort in Gruppen versammelten und aggressiv auftraten, ließ bei der Polizei die Befürchtung aufkommen, dass eine Wiederholung des Szenarios vom Vorjahr droht. Aus der Luft gegriffen war das ganz gewiss nicht.
Das Problem ist allerdings, dass wesentliche potenziell bedrohliche Eigenschaften und Gemeinsamkeiten oftmals nicht äußerlich sichtbar sind – etwa die weltanschaulichen und religiösen –, während die äußerlich sichtbaren unveränderlichen Eigenschaften häufig keine oder nur sehr bedingte Rückschlüsse darauf zulassen, ob von einem Menschen eine Gefahr ausgeht. Daraus resultierte für die Polizei am Silvesterabend des Jahres 2016 ein Dilemma: Einerseits gab es nach den Erfahrungen des Vorjahres Gründe für die Annahme, dass diejenigen, die wahrscheinlich das größte Risiko für die Sicherheit darstellen würden, bestimmte äußerliche Merkmale – männlich, zwischen 18 und 35 Jahren, vermeintlich »nordafrikanisches« Aussehen, ohne weibliche Begleitung – auf sich vereinen. Andererseits sind Menschen mit diesen äußerlichen Merkmalen selbstverständlich nicht per se ein Sicherheitsrisiko, auch nicht an einem Silvesterabend in Köln.
Es ist wie mit den Terroranschlägen: Die weitaus meisten werden von Muslimen verübt, woraus jedoch längst nicht folgt, dass jeder Muslim ein (potenzieller) Terrorist ist. Die Frage lautet also: Stellte die gezielte Kontrolle all jener, die in den Augen der Polizei einem bestimmten Profil entsprachen, für die Betreffenden eine unzumutbare Härte dar – vor allem angesichts der Tatsache, dass dabei eine unveränderliche Eigenschaft wie die Hautfarbe eine wesentliche Rolle spielte? Waren diese Kontrollen also diskriminierend, gar rassistisch und grundgesetzwidrig? Oder heiligte der Zweck die Mittel, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Wiederholung der Exzesse des Vorjahres ausblieb und dass zahlreichen Menschen, die dem besagten Profil nicht entsprachen, eine Kontrolle erspart wurde? Und war das Vorgehen der Polizei ohne Alternative? Oder hätte es Möglichkeiten gegeben, das gleiche Ergebnis – eine weitgehend friedliche Silvesterfeier vor dem Kölner Hauptbahnhof nämlich – mit anderen Mitteln zu erreichen?
Mit Rassismus gegen sexualisierte Gewalt?
In einem lesenswerten Beitrag für das Webportal Ruhrbarone hat sich Falko Apel, der bei Veranstaltungen als Türsteher arbeitet, Gedanken darüber gemacht, welche Alternativen es für die Polizei gegeben hätte, die Sicherheit im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und des Kölner Doms zu gewährleisten. Apel schreibt: »Anstelle eines Kessels hätte man die Beamten in Gruppen patrouillieren lassen und so Präsenz zeigen können. Kleinere Vergehen nicht ignorieren, sondern eben ahnden, je nach Verhalten der Angesprochenen (in Lehrbüchern zum Thema Eigensicherung und Polizeistrategie etc. steht da als Beispiel die Tit-for-Tat-Strategie) verteilt man eine Verwarnung oder einen Platzverweis. […] Man kann in kleineren Gruppen auch den Kontakt mit den Menschen suchen. Übermotivierten Jugendlichen vermitteln, dass sie nicht unbeobachtet sind, ängstlicheren Menschen zeigen, dass man für sie da ist, mit ihnen reden. Straftaten können so unterbunden werden.«
Mag sein, dass das nicht funktioniert hätte oder zumindest nicht so effektiv gewesen wäre wie die Kontrollen im Bahnhofsgebäude. Kriminologen und ausgewiesene Polizeiexperten werden diesbezüglich gewiss Expertisen und Konzepte zu bieten haben. In jedem Fall ist es allemal sinnvoll und geboten, sich Gedanken darüber zu machen, wie die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden kann, ohne zu einer Praxis zu greifen, bei der Menschen bereits aufgrund ihrer (angenommenen) Herkunft oder ihrer Hautfarbe unter Verdacht gestellt werden. Mit Blick auf Köln ließe sich etwas vereinfacht sagen: Es kann und darf nicht sein, dass sexualisierte Gewalt auch mit rassistischen Mitteln bekämpft respektive verhindert wird. Zugleich kann und darf es selbstverständlich ebenfalls nicht sein, dass in einer Debatte über sexualisierte Gewalt wie nach dem Silvesterabend 2015 des Rassismus geziehen wird, wer deutlich macht, dass nicht wenige Täter einen islamischen Hintergrund haben und dass zu diesem Hintergrund fatale Geschlechterrollenbilder gehören, die sich auch mit Oktoberfestvergleichen nicht relativieren lassen.
Die Debatte über den Polizeieinsatz am Silvesterabend in Köln zeichnet sich dadurch aus, dass sie von vielen mit dem Bedürfnis nach Widerspruchsfreiheit geführt wird, wiewohl die Gemengelage widersprüchlich und unübersichtlich ist. Stefan Niggemeier hat zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht wenige derjenigen, die das Vorgehen der Polizei richtig oder zumindest verhältnismäßig finden, eine autoritäre Basta-Attitüde an den Tag legen und bereits kritische Nachfragen für verfehlt oder gar schädlich halten. Der gegenüberliegenden Seite wiederum gerät in ihrer Fokussierung auf die Polizei oft aus dem Blick, dass sich unter den grobschlächtig als »Nordafrikaner« zusammengefassten Männern nicht eben wenige befinden, die sich schwerlich bloß als Opfer klassifizieren lassen, um es zurückhaltend zu formulieren.
Was am Begriff »Nafris« problematisch ist
Symptomatisch für die Beschränktheiten in der Diskussion ist die Auseinandersetzung über die von der Polizei verwendete Abkürzung »Nafris«. Das sei doch bloß eine harmlose Sammelbezeichnung wie »Ladis« für Ladendiebe, »Olos« für Obdachlose oder »Hilope« für hilflose Personen, sagen die einen, während die anderen meinen, der Begriff sei rassistisch und entstamme überdies dem Sprachgebrauch der Rechten. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch hat sich dieser Wertungen in einem empfehlenswerten Text angenommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Wort »Nafris« nicht per se ein Ausdruck von Rassismus und auch keine rechte Erfindung ist. Problematisch sei es trotzdem, weil die Polizei damit nicht nur Individuen aus recht verschiedenen Staaten (die teilweise noch nicht einmal in Nordafrika liegen) homogenisiere, sondern »ein und dasselbe Wort für Menschen aus bestimmten Ländern (bzw. solche, die ihrer Meinung nach so aussehen) und für Straftäter aus diesen Ländern« verwende.
Die Kölner Polizei, so Stefanowitsch weiter, habe den Begriff »zunächst geschaffen, weil sie eine Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe wiederholt straffälliger Menschen brauchte«. Die Bedeutungsentwicklung der Bezeichnung habe dann ein Eigenleben angenommen, das heißt: Es hat sich »schnell eine Doppeldeutigkeit zwischen Menschen und Straftätern aus einer bestimmten geografischen Region herausgebildet, die potenziell rassistische Denk- und Handlungsweisen auslösen bzw. verstärken kann«. Zu dieser Doppeldeutigkeit habe beigetragen, dass die Polizei mit Menschen grundsätzlich genau dann zu tun bekomme, wenn diese straffällig werden. Im Falle des Wortes »Nafris« komme hinzu, »dass ein sehr breiter und heterogener Personenkreis zusammengefasst wird, der sich vorrangig dadurch auszeichnet, nicht weiß zu sein«. Das sei zwar wahrscheinlich nicht a priori beabsichtigt gewesen, aber es sei eine Eigendynamik entstanden, wie die »zumindest etwas unreflektierten Personenkontrollen auf der Grundlage visueller ethnischer Merkmale in der Silvesternacht 2016« gezeigt hätten.
Die Debatten über den Silvesterabend in Köln werden mit einer Menge Getöse geführt, doch so verhärtet die Fronten teilweise auch sein mögen: Es wird deutlich, dass die Diskussion viele Aspekte enthält, die in gesellschaftspolitischer Hinsicht von Belang sind. Dazu gehört die Auseinandersetzung über Polizeitaktiken und -praktiken genauso wie die über das Thema Sicherheit und der Streit über Zuwanderung, Asyl, Migration, Integration und Rassismus genauso wie der über die Frage, wie die Gesellschaft, in der man lebt und leben will, eigentlich beschaffen sein soll. Außerordentlich wichtig wäre aber auch eine Reflexion in den migrantisch geprägten Communities selbst – allen voran in den islamischen. Denn so kritikwürdig eine polizeiliche Kategorisierung wie »nordafrikanisch« ist – vor allem, wenn mit ihr eine Ontologisierung einhergeht –, so problematisch sind auch die Selbstethnisierung von nicht geringen Teilen der in Deutschland lebenden Muslime und die daraus resultierenden Folgen.