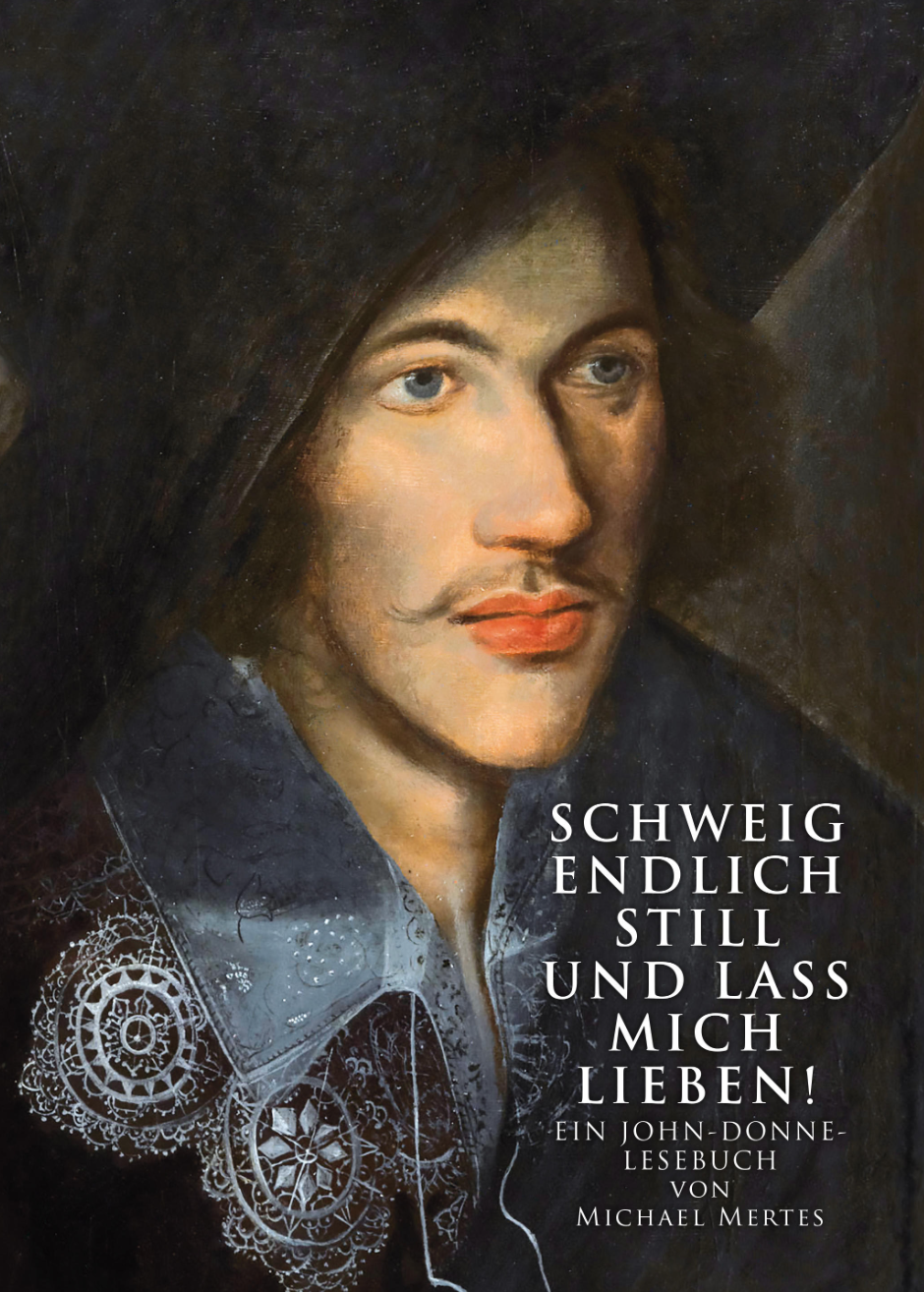Der Mythos vom weißen Messias
“Dune” ist in neuer Fassung von Denis Villeneuve erneut ins Kino gekommen. Hannes Stein hat den Film gesehen.
Gestern Abend habe ich endlich “Dune” gesehen. Der Roman von Frank Herbert erschien in meinem Geburtsjahr, also vor mehr als einem halben Jahrhundert, und gehört zu den wichtigsten Werken der Science Fiction. Ich war auf den Film also sehr gespannt. Der Roman setzte nämlich seinerzeit zwei große Maßstäbe, die heute noch gelten:
Es muss nicht immer Technik sein
1) Ein Werk der Science Fiction muss nicht in erster Reihe von futuristischem Dingsbums handeln. Das technische Dingsbums (überlichtschnelle Raumschiffe usw.) kann auch das weniger Wichtige sein, die Nebensache. Das Hauptaugenmerk darf ruhig auch auf gesellschaftlichen Entwicklungen liegen. In “Dune” etwa geht es im Kern um Fragen der Umwelt: die Ausbeutung von Ressourcen, um Grundwasser — der Roman handelt eigentlich von dem, was wir heute “Nachhaltigkeit” nennen.
Ungleichzeitiges hat seinen Reiz
2) Science-Fiction-Romane können, ohne dass es besonders stört, ein Gesellschaftsmodell schildern, das auf geradem Wege aus dem Mittelalter oder einer anderen vergangenen Epoche importiert wurde. So erinnert die galaktische Ordnung, die Herbert schildert, an das Heilige Römische Reich: Es gibt einen schwachen galaktischen Kaiser, ihm untergeben sind verschiedene Adelsgeschlechter, die miteinander mehr oder weniger offen Krieg führen (das Haus Atreides gegen das Haus Harkonnen), es gibt einen “Landsraad”, der im Roman tatsächlich so heißt, es gibt einen geheimen Nonnenorden, die “Bene Gesserit” (Beweis, dass Herbert definitiv kein Hebräisch konnte) etc.
Ist das Ganze literarisch wertvoll? Na ja. Die Sprache ist ordentlich. Der Plot hat ein paar gute Verwicklungen. Herbert weiß, wie man eine Geschichte spannend macht, auch 900 Seiten lang. (Er war ein hervorragender Journalist.) Das Wichtigste — Science Fiction ist Ideenliteratur — sind aber die Themen, die uns heute noch genauso beschäftigen wie damals den Autor. Kurzum, ich war auf den Film neugierig. An dieser Stelle wird eine kurze Abschweifung notwendig. Seit etwa den Siebzigerjahren, wahrscheinlich sogar noch länger, ist Hollywood in eine spezifische Erzählung verliebt: den Mythos vom weißen Heiland. Die Geschichte geht jedes Mal gleich: Es gibt eine Gruppe von dunkelhäutigen Eingeborenen, die ganz furchtbar unter Ausbeutung und Rassismus leiden. Aus eigener Kraft können sie sich nicht befreien. Darum kommt dann ein hellhäutiger Messias, der unter ihnen lebt, die Tochter des Häuptlings vögelt (kein zwingendes Handlungselement, aber ziemlich häufig), anschließend zum Comandante el Jefe aufsteigt und die Eingeborenen am Ende siegreich in die Befreiungsschlacht führt.
Unter weißer Führung in die Freiheit
Es ist beinahe peinlich, wie sehr “Dune” von Denis Villeneuve — ein Regisseur, dem wir auch den wirklich schönen Science-Fiction-Film “Arrival” verdanken — alle Erwartungen des Klischees erfüllt. Paul Atreides (Timothée Chalamet) ist ein dunkelhaariger Held mit seelenvollen Glutaugen. Die Eingeborenen heißen “Fremen” und leben in der Wüste; es handelt sich bei ihnen ziemlich eindeutig um Araber, auch wenn ich ihr kehliges Idiom nicht immer verstanden habe, und der Held wird ihr T.E. Lawrence; sogar sein Kostüm erinnert an einen Burnus. Man kann beim Zuschauen sämtliche Kästchen abhaken: Held wird in die Wüste verschlagen? Check. Held versteht auf Anhieb die Kultur der Eingeborenen? Check. Held besteht Zweikampf mit Eingeborenem? Check. Sogar die glutäugige Häuptlingstochter durften wir schon aus den Augenwinkeln erblicken. Eine Augenweide! Der Liebesszene im nächsten Teil des Films (denn dies ist nur der erste Teil) sehen wir mit Vorfreude entgegen. Ja, dieser Film ist ein Fest der Sinne. Vor allem dann, wenn man, wie ich, nur noch einen Rasiersitz in der ersten Reihe abbekommt, also dauernd mit gerecktem Kinn zum gigantischen Bildschirm im IMAX-Kino hochschauen muss. Alles in diesem Film ist übergroß: Es gibt tolle Schlachtszenen mit viel Kawumms und Heroismus. Es gibt tolle Riesensandwürmer, die durch die Wüste — genauer: unter der Wüste — heranrauschen. Ferner sind ein stolzer Herzog und ein herrlich monströser und gefräßiger Gegner zu melden, den Stellan Skarsgard mit offenkundiger Lust am Ekelhaft-Sein spielt. Ich musste mich zurückhalten, um nicht zwischendurch zu applaudieren. Dennoch fragte ich mich nachher, warum das moderne Kino einfach nicht vom weißen Heiland-Mythos loskommt. Natürlich ist dieser Mythos immer furchtbar gut gemeint: Die armen Eingeborenen! Die furchtbare Ausbeutung! Schluchz!
Ein Fest der Sinne
Gleichzeitig ist er immer paternalistisch. Deutsche dürfen hier getrost und gerührt an Old Shatterhand zurückdenken: Die Apatschen bleiben eine Statistentruppe — Rollenbild: edel, wenn auch wild. Inschu-tschuna und Nscho-tschi müssen gleich im ersten Band dran glauben, und am Ende wird Winnetou ein Christ. Warum erzählt uns das Kino wieder und wieder diesen alten Käse? In amerikanischen Serien wird der Mythos vom weißen Heiland unterdessen lustvoll auseinandergenommen. In der großartigen “Foundation”-Serie auf Apple TV etwa ist der weiße Prophet Hari Seldon (Jared Harris) überhaupt kein Held, sondern ein zutiefst zwielichtiger Mensch. Gerettet wird das Universum unterdessen von zwei schwarzen Frauen: von Gaal (Lou Llobell) und Salvor (Leah Harvey). Warum, meinetwegen zum Teufel, kam Denis Villeneuve nicht auf die Idee, das Haus Atreides von schwarzen Schauspielern darstellen zu lassen? Im Roman von Frank Herbert steht nichts, was dem widersprechen würde.