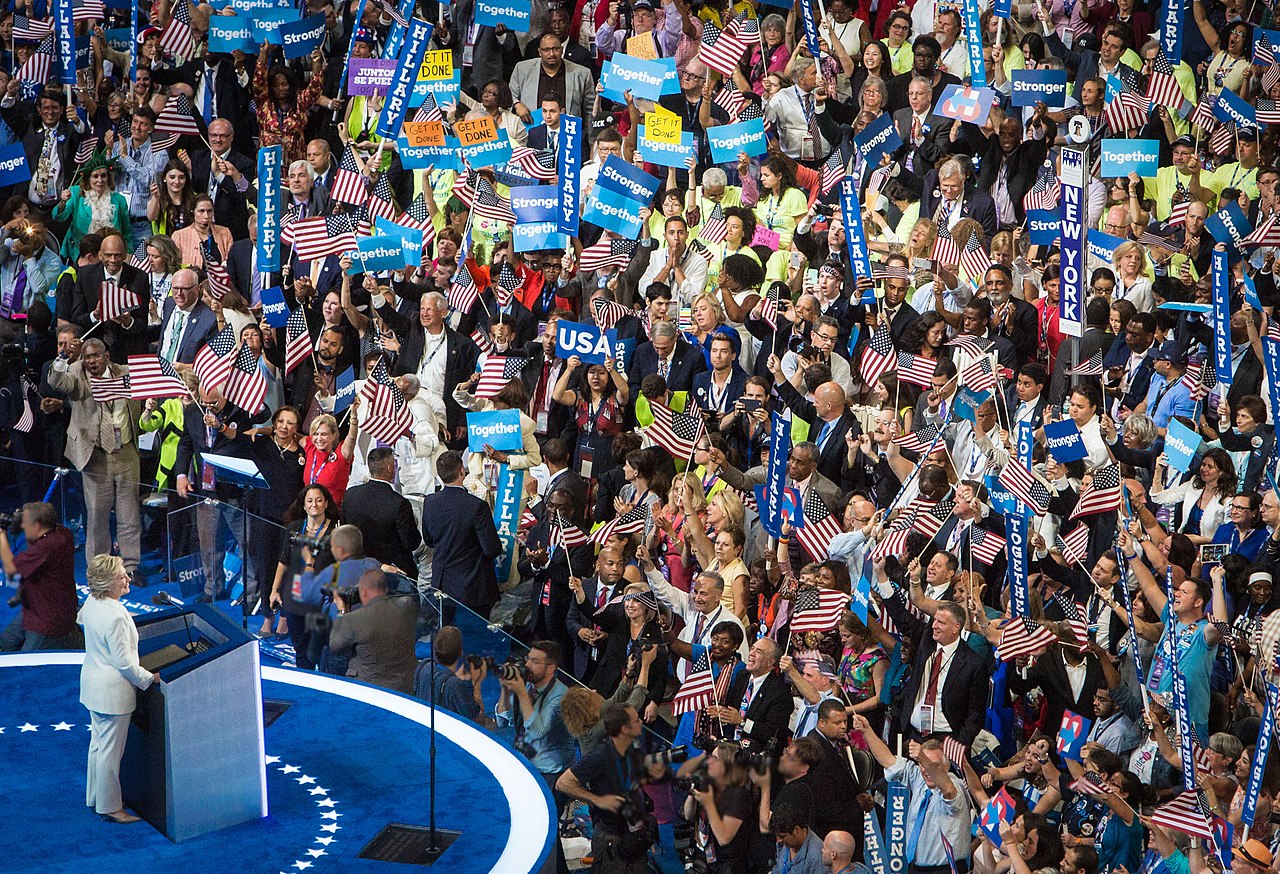Ein Bagel, ein General und ein Rabbiner
Colin Powell ist tot. Unser Gastautor, Rabbiner Andrew Steiman, hat ihn als warmherzigen und klugen Mann kennengelernt. Ein Nachruf
Mit einem Bagel in der Hand bestieg ich mittags den Paternoster, hinter mir ein Schatten. Als ich mich umdrehte, erkannte ich General Colin Powell, Chef des Hauses. Mit einem hurtigen Schritt stieg er in die Kabine zu mir ein. Ich nahm Haltung an und salutierte – mit dem Bagel. „A Bagel!“ bemerkte er mit einem breiten Grinsen, und: „I love Bagels!“ Daraufhin bot ich ihm den Bagel an. Man konnte den Paternoster langsam hochfahren hören, während er den Bagel anschaute, um ihn mir nach einer langen Sekunde endlich aus der Hand zu nehmen. Er biss einmal rein, schloss kurz die Augen, machte sie wieder auf und drückte mir den angebissenen Bagel mit einem anerkennenden Blick zurück in die Hand. Im Kauen drehte er sich wortlos um und stieg in aller Ruhe aus dem Paternoster aus.
So lief meine erste Begegnung mit Colin Powell ab – über ein halbes Leben ist das her. Damals war er Chef des fünften Armeekorps in Frankfurt, ich dort Übersetzer. Unser Arbeitsplatz war das „Abrams Complex“ mit dem langgezogenen ehemaligen IG-Farben-Haus in der Mitte.
Er kam danach regelmäßig in das Übersetzer-Büro – immer mit einem frischen Bagel, den wir miteinander teilten. Wo es welche auf dem weitläufigem Gelände gab, war nicht schwer herauszufinden: in der Jewish Chapel auf dem Gelände gleich hinter dem „Abrams Building“, wie das wuchtige Bürohaus aus den 1920er Jahren bei uns damals hieß. Wir unterhielten uns viel, auch über Politik, machten uns lustig über Rassisten und Antisemiten, tauschten uns aus über unsere gemeinsame Heimat New York – aber auch über die Zeichenbretter, an denen die Pläne zum KZ Auschwitz-Monowitz entstanden sind – in ebenjenem Gebäude, in dem wir gerade saßen.
Colin Powell war dafür bekannt, sich für sein Umfeld zu interessieren. Auch dafür, Berichte direkt beim Verfasser anzuschauen statt bei den Vorgesetzten, die sie in Auftrag gaben. So kam es, dass er auch bei uns Übersetzern öfter vorbeischaute, um unsere Berichte zu besprechen. Und immer mit einem zum Ritual gewordenen Bagel in der Hand.
Eine Einladung in die Chapel (damals war ich auch in der Militärseelsorge tätig) nahm er freudig an und wurde dort ein gern gesehener Gast. Einmal kam er zu den Hohen Feiertagen, setzte sich eine Kippa auf und nahm hinten Platz. Als die anwesenden Soldaten ihn erkannten, standen sie vor ihm auf. Einer von ihnen berichtete mir, wie der General reagiert hat: „Beim Gebet hat man sich nur vor Gott zu erheben“, bemerkte er, und so möge man bitte wieder Platz nehmen. Beim Kiddusch (jüdisch traditioneller Imbiss nach dem Beten) mischte er sich unters Volk und spielte mit den Kindern. Als geborener New Yorker waren ihm die jüdischen Feiertage bestens bekannt, und jiddische Ausdrücke gehörten für ihn zum Alltag. Man sah es ihm an, dass er sich in der Chapel wohlfühlte. Auch umgekehrt fühlte man sich in seiner Gegenwart wohl.
Einmal nahm er mich bei einem Kiddusch beiseite und lobte mich für meine Predigt. Ob ich nicht Rabbiner werden wollte? Übersetzer gäbe es schließlich genug; als Rabbiner könnte ich meinen Anteil zu einer besseren Welt beitragen. Dann nahm er ein Bagel vom Buffet, schaute mich beim genüsslichen Kauen freundlich an und salutierte zum Abschied, die Backen noch mit dem Bagel gefüllt.
Diesen Salut erwidere ich nun traurig. Er war ein Vorbild und prima Vorgesetzter. Mehr noch: eine Inspiration. Der Beweis: Ich bin Rabbiner. Einem Bagel und einem General sei Dank.
Rabbiner Steiman lebt in Frankfurt am Main