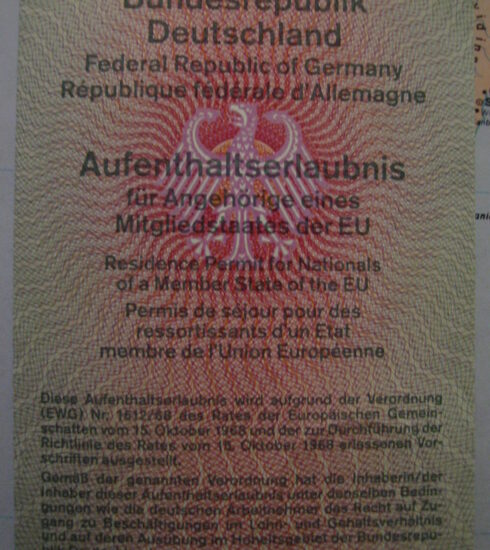Der Schwarm geht baden
Die TV-Serie „Der Schwarm“ ist zäh und schnulzig und bemüht sich mehr um Diversitätsquoten und moralische Botschaften als um spannende Unterhaltung.
Wie kann man eine solche Vorlage nur vergeigen? Frank Schätzings „Der Schwarm“ von 2004 war ein Weltbestseller – übersetzt in 27 Sprachen, sechs Millionen Mal verkauft. Zudem liest sich der Wissenschaftsthriller voller Actionszenen mit explodierenden Hubschraubern, spektakulärer Umweltkatastrophen und tragischer Liebesbeziehungen ohnehin schon wie das Buch zum Film. Um das Aussehen einiger der Figuren zu beschreiben, hat Schätzing sogar ganz dezent Vergleiche mit Schauspielern herangezogen.
Diversität und Proporz wichtiger als die Handlung
Und trotzdem geht die derzeit im ZDF laufende Miniserie zum Roman grandios baden. Das liegt nicht allein an der brachialen politischen Korrektheit, die wirkt, als habe man eine von Diversitätsaktivisten vorgelegte Checkliste abgearbeitet. Da gibt es einen schwulen muslimischen Meeresforscher. Aus dem grauhaarigen weißen Norweger Sigur Johanson, der eine Affäre mit einer deutlich jüngeren Frau hat (pfui!) und ein bisschen an den nicht ganz uneitlen Autor erinnert, wird ein schwarzer Mann im besten Alter. Aus dem real existierenden Meeresgeologen Gerhard Bohrmann wird die fiktive Katharina Lehmann. Auch der französische Molekularbiologe bekommt das Y-Chromosom entfernt. Und die schon im Buch weibliche Samantha Crowe, eine Verbeugung Schätzings vor der realen Astronomin Jill Tarter, wird schwarz – und lesbisch. Offenbar reicht es nicht, jahrelang das SETI-Institut zur Suche nach außerirdischem Leben zu leiten, zu einer der 50 bedeutendsten Frauen in der Wissenschaft gewählt zu werden und als Inspiration für eine ganze Generation von Astrophysikerinnen zu gelten, um sich einen Platz in einer Literaturverfilmung zu verdienen. Nicht erarbeitete Identitätsmerkmale sind wichtiger.
Das war in diesem Zeitalter der moralischen Erweckung zu erwarten. Um den Schwarm in den Tiefseesand zu setzen, musste man die Serie aber erst zu einem internationalen Vorzeigeprojekt unter deutscher Führung machen. Bei amerikanischen Serien beraten Showrunner und Drehbuchautoren gemeinsam im „Writer’s Room“, wie man eine unterhaltsame Show schreibt. Über die Arbeit mit den vielen Partnern beim „Schwarm“ hingegen sagte die Regisseurin Barbara Eder: „Besprechungen erinnern mitunter an eine Sitzung des Europäischen Parlaments.“ Das tut die Serie auch. France Télévisions gibt viel Geld, also wird die Rolle der französischen Protagonistin aufgewertet. Deutschland hat den Hut auf, also werden mehrere deutsche Figuren hinzuerfunden. Hulu Japan ist mit an Bord, also wird ein so sinnloser wie überflüssiger Japan-Plot dazugeschrieben.
Das passiert, wenn hinter der Förderung einer kreativen Unternehmung nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Motive stehen. Dann ist es eben wichtiger, den Proporz der Geldgeber auch bei den Darstellern zu erfüllen, als den Unterhaltungswert des Produkts zu steigern. Ähnlich ist es bei der staatlichen Filmförderung, wo darüber diskutiert wird, ob mit dem Geld nicht gleich auch eine Genderquote oder ein Verbot von Szenen, in denen geraucht wird, verbunden sein sollte.
Kein Humor, keine Wissenschaft, aber jede Menge schnulziges Drama
Im Schwarm raucht natürlich niemand. Dafür sind die Figuren viel zu achtsam, nüchtern und asketisch. Alles wirkt furchtbar getragen, bedeutungsschwer, stoßgeseufzert. Aus einem Roman, der von einem Höhepunkt zum nächsten hastet, wird ein zähes Rührstück mit apathischen Schauspielern, die ewig auf oder in Betten liegen und ins Nichts starren. Oder aber in kalten Räumen unter kaltem Deckenlicht verstört auf irgendwelche Monitore. Als Zuschauer wartet man dann auf das, was das Buch so besonders gemacht hat: die Wissenschaft, die faszinierenden Fakten über die Tiefsee, seltsame Meeresbewohner, die Geografie der Kontinentalschelfe. Aber da kommt nichts. „Aus den 1000 Seiten des Buches wurden erst alle komplizierten Wissenschaftsaspekte gestrichen (500 Seiten weniger), dann der Humor (100 Seiten weniger), dann die Action (300 Seiten weniger)“, heißt es in einer treffenden Rezension in der „Süddeutschen Zeitung“.
Stattdessen gibt es jede Menge persönliches Drama. Gleich bei ihrem ersten Besuch in einem Pub auf einer abgelegenen Shetland-Insel stößt die deutsche Meeresbiologin, die aus ökologischen Gründen keinen Fisch isst, einen jungen, gutaussehenden, ungebundenen einheimischen Fischer vor den Kopf – um anschließend mit ihm im Bett zu landen. Außerdem verkracht sie sich zu jeder Gelegenheit mit ihrer Doktormutter. Aus dem One-Night-Stand wird eine zarte Liebesbeziehung, die weder aus ihrer noch aus seiner Perspektive für den Zuschauer nachvollziehbar ist und selbstverständlich ein tragisches Ende nimmt.
Aus dem alternden, selbstverliebten und hedonistischen Lebemann Sigur Johanson ist ein sanfter, reservierter Mitvierziger geworden, der mit traurigen Augen zu seiner Affäre sagt: „Ich werde dich nicht bitten zu bleiben.“ Dann legt er sich, nachdem sie gegangen ist, ins Bett und starrt vor sich hin – während die Welt dem Untergang entgegenstürmt. Frank Schätzing kommentierte all dies enttäuscht: „Es pilchert mehr, als es schwärmt.“
Moral statt Unterhaltung
Hinzu kommt das penetrante Versenden einer moralischen Botschaft. Schon das Buch ist nicht frei von Moralismus, aber trotz der Kritik am Umgang der Menschheit mit den Meeren ist es zuallererst eine unterhaltsame Geschichte. Doch aus dem Drehbuch der Serie trieft mehr Moralin als mit Vibrio vulnificus infizierter Glibber aus den todbringenden Hummern im Fernsehen.
Der im Buch charismatische promovierte Walforscher Leon Anawak ist in der Serie ein Jüngling mit der Ausstrahlung eines toten Fischs, dem man den Status des Experten nicht eine Sekunde abnimmt. Während er auf einer Treppe sitzend mal wieder vor sich hinschmollt, weil er beim Einbrechen in ein Sperrgebiet erwischt und dabei grob behandelt wurde, gesellt sich sein Kollege dazu und fragt: „Was glaubst Du, haben die gesehen? Einen promovierten Walforscher oder einen First-Nation-Typ, der was klauen will?“ Was folgt, ist ein von Mainzer Redakteuren geschriebener Dialog zwischen einem Afroamerikaner und einem Native American über Rassismus in Kanada auf Basis von Klischees über die USA. Deutscher kann Fernsehen nicht werden.
Um dem Moralismus innerhalb der Geschichte auch ein angemessenes Gegenstück in der Realität zu verpassen, hat das ZDF die Serie übrigens in eine Kooperation mit der Unesco eingebunden und zum Teil eines Bildungspakets zur UN-Dekade für Ozeanforschung gemacht. Warum interessiert sich der Rest der Welt nicht sonderlich für deutsche Filme?“, fragt der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert und gibt selbst die Antwort: „Weil deutsche Drehbuchautoren in erster Linie ihren alten Sozialkundelehrer beeindrucken wollen. Man macht in unserem Land keine Unterhaltung, man macht ‚Kultur‘.“ Ja, dass sie gute Unterhaltung geschaffen hätten, kann man den Machern des TV-Schwarms wirklich nicht vorwerfen.
Dieser Artikel ist in einer anderen Fassung zuerst in der Kolumne „Kaufmanns Konter“ in der Braunschweiger Zeitung erschienen.