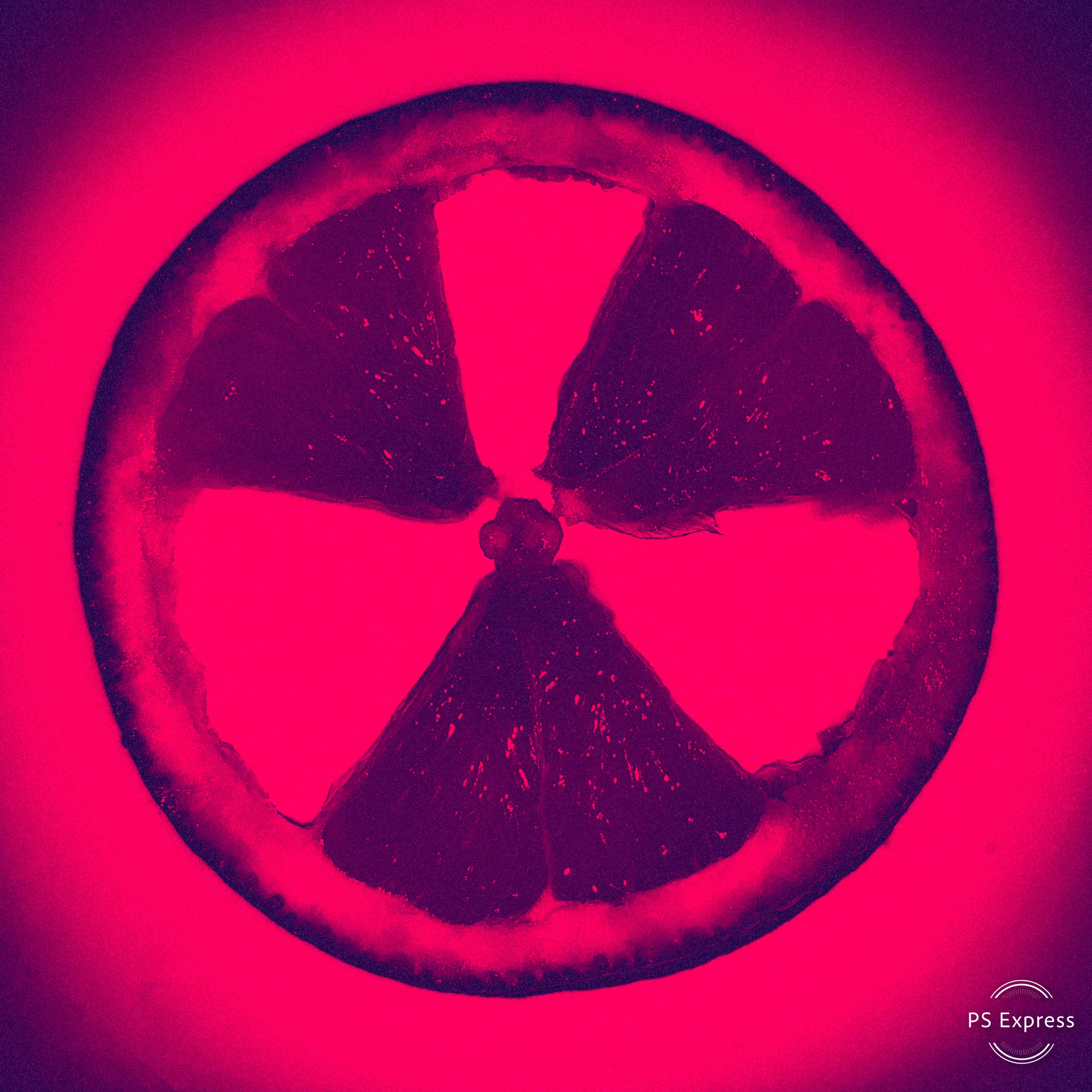„Ich bin Christ und liberaler Sozialdemokrat“
Am 4. März wird der renommierte französische Zeithistoriker Jacques Julliard 90 Jahre alt. Marko Martin und Harry Louiserre haben ihn in Paris getroffen – für ein Gespräch über Dekolonisierung, Immigration und die Linke, über Chancen und Scheitern moderater Politik, und über die (Un-)Verantwortlichkeit der Intellektuellen.
Monsieur Julliard, liest man Ihre zahlreichen Bücher, betrachtet Ihr Leben und Werk als Zeithistoriker, prominenter Publizist und ehemaliger Gewerkschafter, wird eine verblüffende Kontinuität sichtbar: Ihre Präferenz für eine liberale Linke bzw. für einen sozialen Liberalismus. Wie sind Sie zu dieser Position gekommen, die für Frankreich, einem Land des oft rigiden Manichäismus, doch einigermaßen atypisch ist?
In der Tat. Symbiosen und Hinzufügungen sind für mich von je her politisch ertragreicher und auch intellektuell spannender als Ausschließlichkeiten und der Kult „reiner“ Ideologien. Auch das Wort Kompromiss und die humanere Wirklichkeit, die dieser unter Umständen ermöglichen kann, scheint mir von großer Würde, ja sogar Schönheit. Hinzu kommt der bis heute fortdauernde Wunsch, die traditionelle Dichotomie zwischen den hohen – oder auch tiefen – Reflexionen und den konkreten Auswirkungen zu beleuchten und zu hinterfragen. Und nötigenfalls auch zu verkleinern helfen, beginnend bei einem selbst: Wie verhalte ich mich als Bürger und zoon politikon, welcher Art sind die Maximen, denen ich zu folgen versuche und für die ich auch andere gewinnen möchte?
Was eher nach den Moralisten des 18. Jahrhunderts als nach den Groß- und dann postmodernen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts oder unserer Tage klingt…
(lacht.) Vielleicht. Moralismus aber nicht etwa als großtönendes Missionieren, Mahnen und Ankündigen, sondern eher in jener Tradition der Neugierde auf die „moeurs“, auf die uns umgebenden und auch von uns gestalteten Sitten. Für mich ist Politik die Kunst und die Praxis des Konkreten. Ich habe immer zu vermeiden versucht, etwas zu bewerben und vorzuschlagen, was keine Chance gehabt hätte, Wirklichkeit zu werden.
Eine Art frühe Resignation?
Im Gegenteil – eine Hoffnung! Eine Hoffnung darauf, dass aus enttäuschten Träumen eben keine Resignation entsteht. Nichts ist reaktionärer als der desillusionierte Revolutionär. Stattdessen der lange Atem des menschenfreundlichen Reformierens…
Und das in einem Land, in dem im Mai 1968 der Slogan „Seid Realisten! Verlangt das Unmögliche“ berühmt geworden war…
Ja, aber das ist einer dieser politischen Schlagertexte, die schon beim zweiten, nachdenklicheren Anhören beginnen fad zu werden. Renitente Bourgeois-Kinder dichten so, ehe sie in den Schoß der Familie zurückkehren. Als Vertreter der Gewerkschaft CFDT hatte ich just im Mai 68 mit ihnen in der Sorbonne diskutiert – und selbstverständlich hielten sie mich für einen verstockten Reformisten, mit dem es unmöglich war, von einem „neuen Menschen“ zu träumen. (lacht)
Geboren 1933, aufgewachsen in einer antiklerikal-republikanischen Familie und Sohn eines Vaters, der 1940 unter Marschall Pétain seinen Posten verlor, waren Sie also 1968 womöglich schon zu erwachsen, um der Poetisierung des Revolutionären Glauben zu schenken?
Mag sein. Ich hatte jedoch schon zuvor in den Fünfzigerjahren erfahren, wie letztlich wirkungslos und kontraproduktiv das pathetische Schwadronieren ist, für das so viele französische Intellektuelle eine fatale Schwäche haben. Schon als ganz junger Mann fühlte ich mich deshalb Albert Camus und seinem Rekurs auf die Konsequenzen, auf die individuelle Verantwortlichkeit viel näher – obwohl oder gerade weil er von den Tonangebenden seiner Zeit, etwa von Sartre und Simone de Beauvoir, bespöttelt, ja verächtlich gemacht wurde. Das waren meine frühen Prägungen, auch im Umkreis der antitotalitären Zeitschrift „Esprit“. Gleichzeitig hatte ich begonnen, mich in der studentischen Gewerkschaft UNEF zu engagieren, die zu jener Zeit eine bedeutende Rolle spielte. Auf die damals zweihunderttausend eingeschriebenen Studenten in Frankreich kamen immerhin hunderttausend, die Mitglied dieser Gewerkschaft waren. Es ging hier um die praktischen studentischen Belange jener, die nicht aus wohlhabenden Familien kamen, etwa um Fragen der Unterkunft oder der Verpflegung. Parallel dazu waren da die großen Themen der Gegenwart, vor allem natürlich die Dekolonisierung. Man hatte damals den Blick auf beides, und weder die bodenständige Praxis noch die Diskussionen und das Ringen um theoretische Durchdringung kamen zu kurz. Das hat mich entscheidend geprägt. 1955 wurde ich mit 22 Jahren Vizepräsident der UNEF mit dem Aufgabengebiet der sogenannten überseeischen Gebiete Frankreichs, von denen damals viele noch Kolonien waren. Ich habe dadurch mit vielen Studenten aus dem Maghreb und der Subsahara zusammenarbeiten können. Darunter gab es brillante junge Theoretiker, sezierend scharf im Reich der Ideen, dafür in Alltagsfragen, etwa was die konkrete Lebenssituation ihrer Kommilitonen hier in Paris betraf, mitunter ziemlich vage, um nicht zu sagen ignorant. Ich habe mich nicht gescheut, dieses Missverhältnis anzusprechen – freundlich, aber vehement. Kein Zufall, schließlich fühlte ich mich den moderaten Sozialisten insoweit nahe, dass das Soziale von großer Bedeutung war; schon früh lernte ich dort jemand wie Michel Rocard kennen, der dann Jahrzehnte später als Premierminister unter Mitterrand mit Ähnlichem konfrontiert war: Sollte das Primat des Praktischen und der Suche nach Verbesserungen gelten oder stattdessen eine hochtönende Rhetorik, die dann allzu oft nur zynische Machtinteressen vertrat?
Stichwort Michel Rocard, einer der wenigen dezidiert sozialdemokratischen Spitzenpolitiker, die Frankreich je hatte. Auch Sie waren ja im Grunde in einer Außenseiter-Position: Antikolonialist und gleichzeitig schon frühzeitig Antikommunist aus linker Motivation…
Ja. Ich war niemals vom Kommunismus angezogen, weder von seinem grobschlächtigen Ideengebäude noch von der massenmörderischen Wirklichkeit in der Sowjetunion. Denn selbstverständlich konnte man auch schon in den Fünfzigern wissen, was dort seit 1917 vor sich ging. Wer dann später mitteilte – und das taten viele französische Intellektuelle – man wäre in Bezug auf die UdSSR blind gewesen, spricht also von einer freiwilligen Blindheit. Das Gleiche gilt natürlich auch heute in Hinblick auf Putin, über den ja nicht nur in Deutschland zahllose Ignoranten sagen, sie hätten ihn „unterschätzt“ und wären deshalb von seinem jüngsten Angriffskrieg „überrascht“. Schon 1950 hatte mich der damals viel bejubelte „Stockholmer Appell“ stutzig gemacht, den auch zahlreiche bürgerliche Intellektuelle, Künstler wie Picasso und ehemalige Résistance-Kämpfer von untadeligem Ruf unterzeichnet hatten in der berechtigten Sorge vor einem Atomkrieg und gleichzeitig im Nicht-Wissen-Wollen der sowjetischen Drahtzieherschaft des Ganzen. Denn selbstverständlich kam es dem Kreml und den zu Satelliten gemachten Ländern Osteuropas zugute, wenn man im Westen nur noch über „Frieden“ und die Gefahr der Atombombe diskutierte und nicht mehr über den fundamentalen Unterschied zwischen unvollkommenen Demokratien und einem nahezu perfekten Diktatur-System.
Zurück zur Kolonialfrage. Die algerischen Studenten wollten z.B. ihre eigene Assoziation gründen, wobei die Frage im Raum stand, ob diese dann als „muselman“ spezifiziert sein solle oder nicht. Es gab auch eine Konferenz, in der, wenn auch klandestin, Vertreter der Befreiungsbewegung FLN präsent waren. Auch da ging es um die letztlich ewige Streitfrage, ob das Engagement für die Verbesserung jetziger Lebensumstände im Klein-Klein verbleibe und vom „großen Ziel“ ablenke oder ob nicht im Gegenteil gerade jenes Ziel darin bestehen sollte, möglichst vielen Menschen ein besseres Leben zu erkämpfen. Die enttäuschende Entwicklung der nach einem blutigen Unabhängigkeitskrieg entstandenen Volksrepublik Algerien hat dann leider gezeigt, das eine solche Frage keineswegs akademisch, sondern von höchster politischer, ja existentieller Bedeutung ist. Im Unterschied zu reaktionären kolonial-nostalgischen Franzosen sehe ich das Scheitern Algeriens, pars pro toto für so viele Länder der damals sogenannten „Dritten Welt“, nicht mit Triumph, sondern mit Trauer und Schaudern. Und erkenne in vielen von ihnen auch eine ungute erzfranzösische Tradition wieder, dieses ewige Parlieren, dessen rhetorischer Maximalismus verlässlich im Nirgendwo endet.
Sie haben Michel Rocard erwähnt. Hatten Sie damals unter den algerischen Studenten in Paris ebenfalls solche getroffen, die dann nach der Unabhängigkeit zu politischem Einfluss gelangt waren?
Ich erinnere mich an zwei meiner damaligen Kommilitonen, die später in Algerien unter Präsident Boumedienne zu Ministern wurden. Wir saßen zusammen in meiner Studentenbude, denn sie waren gekommen um sich zu verabschieden. Schon am nächsten Tag würden sie untertauchen und in den Maquis gehen. Würde ich, sagten sie mir, eines Tages als Soldat für Frankreich mobilisiert, stünden wir uns dann als Feinde gegenüber und müssten aufeinander schießen – tragischerweise, da wir doch alle drei Sozialisten seien. Die Ehrlichkeit und die Verzweiflung, mit der wir an diesem Abend miteinander sprachen, werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich glaube, ganz unabhängig davon, dass wir uns später so unterschiedlich entwickelten, auch diese Erfahrung hat meinen Sinn für die Konsequenzen jedweden Redens und Handelns geschärft.
In Ihren Büchern und Zeitschriftenbeiträgen taucht neben Michel Rocard auch immer wieder der einstige Premierminister Pierre Mendés France auf, der mithalf, den Indochina-Krieg zu beenden, die Dekolonisierung von Tunesien und Marokko einigermaßen gewaltfrei zu realisieren und überdies – auch da gegen den Widerstand vieler anderer Politiker – die „Pariser Verträge“ von 1954 durch das Parlament zu bringen, in deren Folge die junge Bundesrepublik in die NATO aufgenommen werden konnte. Allerdings sind beide Politiker, die derart auf das Konkrete und Pragmatische rekurriert hatten, letztlich gescheitert, nicht zuletzt am mangelnden Rückhalt in ihren sozialistischen Parteien… Ein Symbol für die immensen Schwierigkeiten, in Frankreich eine moderne moderate Politik zu betreiben?
So weit würde ich nicht gehen. Obwohl natürlich Mitterrand ab 1988 alles versucht hatte, um seinen erfolgreichen und ungemein beliebten Premierminister Rocard auszubremsen. Oder jemand wie Jean-Marie Le Pen bereits Anfang der Fünfzigerjahre öffentlich gepöbelt hatte, der aus einer Familie portugiesischer Marranen, also im 16. Jahrhundert zwangskonvertierter Juden stammende Pierre Mendés France bereite ihm „geradezu physischen Abscheu“. Mendés France war ein früher Verfechter der europäischen Integration, um die sich dann trotz seines elitären Nationalismus und seines Hasses gegen den sozialdemokratischen Michel Rocard freilich auch Francois Mitterrand verdient gemacht hat; das ist fairerweise anzuerkennen. Aber Ihre Frage geht in die richtige Richtung: In Frankreich konnte die Sozialdemokratie, die doch in Belgien, in Österreich, Deutschland und in Skandinavien derart starke historische Wurzeln hat, nie wirklich Fuß fassen. Weder in den linken Parteien, die untereinander noch verbissener zerstritten waren als anderswo in Westeuropa, noch in der Gewerkschaftsbewegung, in der ebenfalls ungleich radikalere Visionen dominierten. Und dennoch: Frankreich im Inneren mit seinem umfangreichen Sozialstaat und der Einkommensstruktur der Bevölkerungsmehrheit unterscheidet sich bis heute nicht wirklich fundamental von denen der eher sozialdemokratisch beeinflussten Länder – wenn wir jetzt einmal die Frage weglassen, durch welche Staatsschulden das mitfinanziert wird. Das war zuvor noch anders, und deshalb glaube ich, dass Menschen wie Pierre Mendés France und Michel Rocard indirekt dennoch viel bewegt haben. Schließlich musste sich ja sogar jemand wie Mitterrand, der zuvor andauernd klassenkämpferische Töne von sich gegeben hatte, zum Prinzip der Marktwirtschaft bekennen. Und die bürgerliche Rechte, die immerhin über Jahrzehnte den Präsidenten stellte, musste ihren Frieden mit dem Sozialstaat machen.
Wobei etwa ein Intellektueller wie Sartres Gegenspieler Raymond Aron bereits frühzeitig stets beide Lager davor gewarnt hatte, unmäßig Staatskredite aufzunehmen und die Innovativkraft der Wirtschaft zu unterschätzen. Fühlten Sie sich ihm und seiner trotz aller medialen Präsenz doch eher marginalisierten Position nahe?
In manchem gewiss. Wenn auch nicht zuvörderst im Ökonomischen: Schließlich hat Frankreich in den sogenannten „trente glorieuses“, den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in Wirtschaft, Industrie und Forschung tatsächlich Bemerkenswertes zu leisten vermocht. Und obwohl ich Sozialdemokrat bin und Raymond Aron bis zu seinem Tod 1983 eher liberalkonservativ, verstanden wir uns intellektuell recht gut. Er war ja auch, was oft vergessen wird, ein Befürworter der Dekolonisierung gewesen, wenn auch ohne jene projizierende Schwärmerei für die „Dritte Welt“, wie sie sein ehemaliger Schulkamerad Sartre mit zu popularisieren half, unglücklicherweise. Unsere Divergenzen lagen woanders.
Auf seine Weise schien mir der kühle, rationale Analytiker Aron nämlich durchaus seltsam zu sein: Ein Intellektueller, der letztlich eine Sozialdemokratie wollte, aber bitte nicht mit allzu viel Kontakt zu den Arbeitern und „unteren Schichten“. Als könnte man eine Sozialdemokratie ausgerechnet mit der Leserschaft des konservativen „Figaro“ hervorzaubern! Seine Schüchternheit, die von manchen Zeitgenossen als Kälte missverstanden wurde, und seine tiefe Melancholie haben mich immer gerührt, und doch war vieles bei ihm geradezu das Spiegelbild der Malaise linker Intellektueller: ein Abstrahieren von den alltäglichen Gegebenheiten, ein Schreiben im nahezu luftleeren Raum.
Waren Sie deshalb viele Jahre in der Gewerkschaft aktiv, um diese Isolation zu vermeiden?
Auf jeden Fall, und zwar in der moderaten CFDT, der bis heute größten Gewerkschaft Frankreichs und nicht in der lauten, lange Zeit quasi mit der Kommunistischen Partei identischen CGT. Man vergisst im Ausland, aber auch auch in Frankreich selbst oftmals die Tatsache, dass die CGT vor allem Staatsangestellte vertritt, jedoch mit ihrer Mitgliederschaft keineswegs repräsentativ für die Gesellschaft ist. Genau um diese Repräsentanz war es der CFDT aber immer zu tun, was auch konfessionelle Neutralität mit einschloss. Das ist nicht ganz unwichtig, denn wie ich kamen viele aus der sozialistisch-christlichen Tradition, aus einem intellektuellen Linkskatholizismus. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr stolz und dankbar bin, in meiner Zeit als Mitglied im Nationalbüro dieser Gewerkschaft die Möglichkeit gehabt zu haben, mich zu engagieren, um die Mehrheit der französischen Arbeiter und Angestellten effizient und ehrlich zu vertreten. Dazu gehörte, den Beweis anzutreten, dass in den Verhandlungen mit Unternehmern bei genügend eigener Tatkraft und Willensstärke schließlich durchaus ein Kompromiss ausgehandelt werden kann, mit dem alle leben können. Für eine Weile, ehe es dann wieder von Neuem beginnt – selbstverständlich. Jetzt, am absehbaren Ende meines Lebens, wird mir klar, dass mir genau das, und nicht die Tätigkeit des Historikers und Publizisten, in meiner seit nunmehr beinahe sieben Jahrzehnten andauernden Arbeit am meisten Freude bereitet hat. Nennen wir es die ziemlich erfolgreiche Sozialdemokratisierung der größten Gewerkschaft Frankreichs…
Während heute in der Politik auf der linken Seite eher der Populist Mélenchon dominiert, der den ideologischen Manichäismus geradezu zum Kult erhebt. Ist die Welt der progressiven und gleichzeitig flexiblen Linken, wie Sie sie mitgeprägt haben, somit völlig verschwunden?
So könnte es scheinen. Wobei wir ohnehin in der Politik nie wirklich reüssiert hatten, denn auch zu seinen Glanzzeiten gab sich der Parti Socialiste meistens auf eine Weise autoritär und etatistisch, wie es zum Beispiel in der Bundesrepublik die SPD niemals war. Es gab Schaukämpfe statt wirklicher Programmdebatten, und so votiert heute ein Teil der einstigen Wählerschaft des PS für Melénchons Partei und der andere für Macron.
Könnte dann nicht Macrons Bewegung symbiotisch genug sein, um Liberale und Linke gemeinsam für progressive Politik zu gewinnen?
Das klingt sehr schön, aber ich glaube nicht daran. Präsident Macron regiert nicht schlecht, seine Covid-Strategie war erfolgreich, und auch angesichts von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine agiert er, trotz mancher für ihn so typischen Ambivalenzen, solidarisch im europäischen Rahmen. Dennoch wagt er sich nicht wirklich an die einschneidenden Reformen, die den drohenden Staatsbankrott verhindern und Frankreich zukunftssicher machen müssen. Auch die Situation des Bildungs- und Gesundheitswesens ist nicht gerade rosig, von der inneren Sicherheit und der Jugendarbeitslosigkeit ganz zu schweigen. Auch in der Industriepolitik gibt es keine wirklichen Impulse. Doch wie will man eine soziale linke Politik machen, wenn die Wirtschaftskraft des Landes dafür nicht die finanziellen Voraussetzungen schafft? Auch die Ära Macron wird also leider nicht eine der notwendigen Reformen gewesen sein.
Nun hat sich aber selbst die moderate CFDT den Protesten gegen die Rentenreform angeschlossen – ohne eine Antwort darauf zu geben, wie immer weniger Arbeitende immer mehr Pensionsberechtigte mit finanzieren könnten.
Hinter dem Einspruch gegen die Rentenreform steckt noch etwas Wichtigeres. Die Öffentlichkeit erhofft sich von den Gewerkschaften, was die politische Klasse nicht zu leisten vermag: einen nachhaltigen Ausweg aus der Krise zu weisen. Das betrifft mehr als die Frage, ob man mit 64 Jahren anstatt wie bis jetzt mit 62 Jahren in Rente gehen sollte. Das Unbehagen geht viel tiefer und betrifft natürlich auch die Frage nach der Zukunft der Arbeit in Zeiten von Gewinnmaximierung, Rationalisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Die Antworten dazu stehen noch völlig aus.
Aber wäre das wirklich allein „der Politik“ anzurechnen und nicht auch als Frage an die Wählerschaft zu richten, zumindest an jene Hälfte, die Melénchon und Le Pen wählt, deren protektionistische, autarkistisch-antieuropäische Vorstellungen doch nahezu identisch sind?
Das stimmt, aber gleichzeitig verbreitet sich in der Bevölkerung auch das, was „oben“ in der Politik besprochen wird – oder eben nicht angesprochen bzw. populistisch verkürzt wird. Dieses Wechselspiel ist nicht zu unterschätzen, weshalb sich verantwortungsvolle Politiker auch nicht hinter der Phrase verstecken sollten, ihnen seien leider die Hände gebunden, denn „die Menschen auf der Straße“… Das zeigt Feigheit und sogar Verachtung, vor allem aber die Fortdauer einer tiefsitzenden Faulheit, den Diskurs wirklich zu öffnen. Ich sehe zur Zeit keinen prominenten Politiker, der die Notwendigkeit von Reformen klar und glaubhaft erläutern könnte. Zwischen Straßengeschrei und Eliten-Selbstgespräch gibt es nämlich trotz aller möglichen, von den Parteien und Medien beinahe täglich ausgerufenen „débats“ keinen wirklichen Raum rationaler und respektvoller Kommunikation. Das ist das Dilemma, und ich muss hinzufügen: Auch daran tragen viele Intellektuelle eine Mitschuld. Ich würde sogar noch zuspitzen: Die hochfahrenden Gedanken-Gebäude, an denen man in dieser Gilde so gern baut, haben dem Land nicht gut getan.
Meinen Sie das mitunter Inkohärente, ja sogar Populistische in den Wortmeldungen gegenwärtiger intellektueller Medienstars wie Didier Eribon oder Michel Onfray?
Das ist jetzt lediglich das jüngste Kapitel, sozusagen le dérnier cri. In der Tat ist besonders bei Michel Onfray dieser Populismus ziemlich schrill und irrlichternd und bei aller Schlagwort-Produktion kaum je einem genauen Studium der komplexen Tatsachen entsprungen. Wenn ich all das mit der damaligen Bildungsarbeit unserer Gewerkschaft vergleiche, die heute von Großstadt-Intellektuellen so gern verspottet wird, werde ich beinahe nostalgisch. Wofür jedoch keine Zeit ist, denn die Lage wird immer ernster. Von Schweden bis nach Italien gewinnen Rechtspopulisten dramatisch hinzu, während die moderate Linke und die ihr verbliebenen Intellektuellen dem nichts entgegenzusetzen haben und in all ihren gutgemeinten moralistischen Appellen wie abgekoppelt wirken. Es gilt ohne Überspitzung oder gar Schadenfreude festzuhalten: Bis heute gibt es keinen wirklichen Diskurs der Sozialdemokraten zum Thema Immigration, die eben in manchen Aspekten durchaus Probleme der inneren Sicherheit verstärkt. Auch die Frage, was Arbeit – und Arbeitsverträge! – in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft bedeuten, wird jenseits des trügerischen Verweises auf einen angeblich notwendigen Protektionismus kaum je gestellt.
Obwohl doch ein links-grüner Visionär wie André Gorz sich bereits ab den siebziger Jahren genau damit beschäftigt hatte, mit dem langsamen Verschwinden des klassischen Proletariats ebenso wie mit der ökologischen Frage…
André Gorz war mir in der Tat sehr nahe. Wir sahen uns sehr häufig in der Redaktion der Zeitschrift „Nouvelle Observateur“ und diskutierten diese Fragen der Transformation der Arbeit, selbstverständlich ohne schnelle Antworten zu haben. Doch kommen wir noch einmal zur Einwanderung zurück. Es kann nicht sein, dass die Rechten oder gar Rechtsextremen für sich das Monopol beanspruchen, Immigration zu erklären – das heißt in ihrem Fall, sie rassistisch zu dämonisieren. Darauf mit Schweigen, empörten Wortblasen oder Schönreden zu antworten, ist dabei die dümmste Strategie überhaupt. Fragen wir doch Lehrer und Lehrerinnen, sehen wir uns mit kühlem Blick die Polizeistatistiken an. Menschen, die entwurzelt sind oder sich so fühlen, neigen oft zur Delinquenz, das ist ein Fakt und hat natürlich keine ethnischen, sondern soziale Ursachen. Aber man muss es doch zuerst einmal ansprechen, um Verbesserungen anzustoßen!
Freilich spielen mitunter auch kulturelle und machistische Prägungen eine Rolle. Immerhin ist in den von Ihnen erwähnten Polizeistatistiken über die zahlreichen Zuwanderer aus den postkolonialen Ländern Vietnam, Indien, Pakistan oder den muslimisch geprägten Staaten südlich der Sahara kaum etwas zu lesen.
Ja, auch das ist eine Tatsache, die nicht vergessen werden sollte, wenn – beschwichtigend oder aufhetzend – stets pauschal von „der“ Immigration die Rede ist. Ich glaube deshalb, dass in der Analyse beides nottut: Eine Empirie, die nicht nur das ihr jeweils ideologisch Genehme herauspickt, und dazu der Versuch, unsere gegenwärtige Epoche mit einem geweiteten Blick zu umfangen, ohne in dräuende Groß-Erzählungen, Kulturpessimismus oder Geschichtsdeterminismus abzudriften. Als Historiker wage ich deshalb ab und an einen vorsichtigen Vergleich mit dem Ende des Mittelalters.
Inwiefern?
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Renaissance eine ziemlich dunkle Zeit vorausgegangen war. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert hatte man nicht wirklich gewusst, wo man sich befindet; die alten Sicherheiten der Vergangenheit waren erodiert oder erwiesen sich als inkompatibel mit der Gegenwart. Wie war all das zu deuten? Wir dagegen befinden uns hier im Westen gerade am Ende der klassisch industriellen Epoche, die für eine ziemlich lange Zeitdauer auch die Versöhnung von ökonomischem und politischem Liberalismus bedeutet hatte. Jetzt, zu Beginn des Digitalzeitalters und mitten im Klimawandel, mit dem Heranbranden autoritärer und populistischer Wellen, mit der Immigration, der Auslagerung ganzer Wirtschaftszweige und dem Bedeutungsverlust der Gewerkschaften und anderer sozialer Verwerfungen, stehen wir vorerst vor einem riesigen Fragezeichen. Wie darauf reagieren, welche Antworten finden? Die Ratlosigkeit unserer demokratischen Spitzenpolitiker ist trotz aller weiterhin verbreiteten Machbarkeits- und Beruhigungs-Formeln oft geradezu habituell spürbar, und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar „Pokerface“ Xi Jinping mitunter unheimlich wird angesichts all der rasanten Veränderungen. Auch wenn er unverdrossen durch seine Staatsmedien verlautbaren lässt, der vermeintlich lasche liberale Westen wäre am Untergehen: Die desaströse chinesische Covid-Politik, für die er letztlich die Alleinverantwortung trägt, hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Autoritarismus noch nicht einmal effizient ist. Während in den Vereinigten Staaten jemand wie Trump immerhin abgewählt werden konnte und mit Joe Biden ein Präsident nachfolgte, der zwar kein Genie sein mag, aber doch ein erfahrener und ziemlich integrer Politiker. Ich will all die offensichtlichen Strukturprobleme nicht verschweigen, das Abdriften der Republikanischen Partei und alle anderen Menetekel, aber noch scheint es mir zu früh, einen schadenfrohen Abgesang auf die USA anzustimmen. Was der Diagnose allgemeiner Unsicherheit dennoch nicht widerspricht. Selbstverständlich können wir heute nicht wissen, wie man späterhin einmal unsere Zeit beurteilen wird: Als Agonie und deprimierende Endphase oder als schwierigen Beginn von etwas positiv Neuem. Um es für mich auszubuchstabieren: Ich bin Pessimist im Aktuellen, dagegen mit Blick auf Längerfristiges nicht ohne Optimismus. Die Einsicht in den ambivalenten Charakter des Menschen schließt ja nicht aus, auch die enorme Kraft humaner Neugier und Innovationsfreude immer mit auf der Rechnung zu haben.
Mit dem Alter käme also nicht zwangsläufig der Kulturpessimismus?
(lacht.) Zumindest nicht bei mir. Da ich in jungen Jahren nicht als blauäugiger Schwärmer begonnen hatte, weshalb sollte ich dann in der letzten Phase meines Lebens in die entgegengesetzte Eindeutigkeit einer Untergangsprophetie driften?
Nun lässt sich freilich nicht alles allein politisch herleiten. Ihre Sozialisation war ja nicht allein sozialistisch, sondern auch linkskatholisch. Falls die Frage nicht zu privat ist: Spielt womöglich auch der Glaube eine Rolle, dass Sie sich der Verzweiflung verweigern?
Auf jeden Fall. Obwohl ich damit öffentlich nicht hausieren gehe. Politik sollte niemals nach einer religiösen Begründung schielen, andernfalls landen wir wieder in Konfessionskriegen und im Integrismus. Was jedoch das Persönliche angeht, so gibt es da in der Tat tiefere Wurzeln als lediglich diese oder jene politische Position. Mein vorsichtiger Optimismus speist sich zwar auch aus meiner Sicht auf die Lehre Jesu Christi, aber es wäre fatal, daraus ein allgemeineres Modell machen zu wollen. Dennoch sage ich es ganz klar, und zwar weniger mit Stolz als mit Dankbarkeit Freude: Ja, ich bin Christ und liberaler Sozialdemokrat.
Monsieur Julliard, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Aus dem Französischen von Marko Martin und Harry Louiserre
Marko Martin, geb. 1970, lebt als Schriftsteller in Berlin. Dem literarischen Tagebuch „Die letzten Tage von Hongkong“ (2021) folgte im Frühjahr 2023 der Porträtband „Brauchen wir Ketzer? Stimmen gegen die Macht“.
Harry Louiserre, geb. 1970 auf Guadeloupe, arbeitet in Berlin als Consultant in der IT-
Branche.