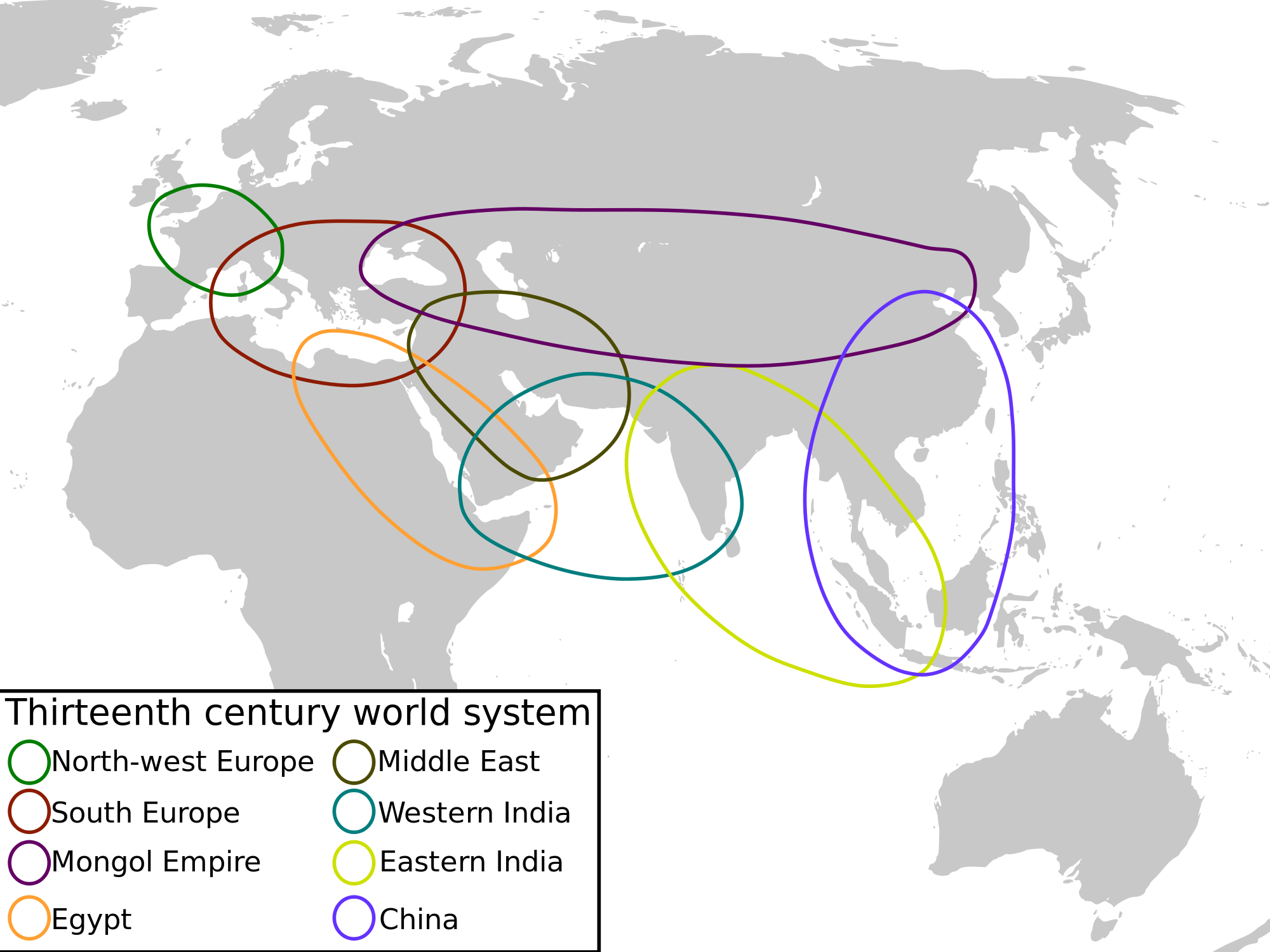CDU: Die Probleme beginnen erst
Die Union bekommt eine neue Führung. Damit beginnt der Richtungsstreit in der letzten verbliebenen Volkspartei. Und das Ringen um die Handlungsfähigkeit Deutschlands.
Es war einfach, damals vor 20 Jahren. Nach sechzehn Jahren hatten sich die Verschleißerscheinungen in der schwarz-gelben Regierung Helmut Kohls nicht mehr überspielen lassen. Der Mann hatte seine historische Rolle erfüllt, indem er die Chance der Wiedervereinigung beherzt angegangen war, während SPD und Grüne zauderten, weil sie ideologische Bedenken hatten und irgendwie ein Problem mit Deutschland. Doch die schwarz-gelbe Regierung besaß dann 1998 nicht mehr den Mumm, das Land für die Zukunft zu rüsten – der „kranke Mann Europas“, wie Deutschland wegen seines geringen Wachstums, der sinkenden Einkommen, der hohen Steuer- und Abgabenquote und der steigenden Arbeitslosigkeit hieß, ging am Stock, wichtige Projekte wurden auf die lange Band geschoben.
Und so drängte sich ein anderes Projekt nach vorne: die erste rot-grüne Bundesregierung. Was man heute kaum noch für möglich hält – aber unter Gerhard Schröder holte die SPD damals 40,9 Prozent der Stimmen, und das genügte mit den 6,7 Prozent der Grünen für den Machtwechsel und eine stabile Regierung.
Die Rede vom „kranken Mann Europas“ war nicht ohne Berechtigung, aber diese Bettlägerigkeit rührte zu einem großen Teil von den immensen Einheitskosten her, denn enorme Summen mussten ja nach Ostdeutschland gepumpt werden; gleichzeitig mangelte es Deutschland allgemein an Wettbewerbsfähigkeit im rauen Wind der Globalisierung. Bundeskanzler Schröder musste seiner Partei daher eine Liberalisierung der Arbeits- und Sozialpolitik abtrotzen, die manchen bis heute als der Sündenfall gilt, der den Niedergang der Sozialdemokraten initiiert hat. Die Grünen auf der anderen Seite verstanden das Projekt eher als eines der kulturellen und sozialen Modernisierung – und das bedeutete zum Beispiel verstärkte und neue Wege der Frauenförderung sowie ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Sie taten sich mit diesen Maßnahmen natürlich leichter, da es ihnen und ihrem Milieu kaum etwas abverlangte – im Gegenteil: Den ersten Atomausstieg gab es noch oben drauf. Der Kosovo-Konflikt war die einzige wirkliche Nagelprobe für die Grünen, durch die sie aber Joschka Fischer aus der Isolation des Pazifismus in die reale politische Verantwortung führte. Das Ergebnis: Zugewinne bei der Wiederwahl; Verluste bei der SPD.
PRAGMATISMUS DER RETTUNG
Solch ein Projekt aus überfälliger Liberalisierung und Modernisierung wird aktuell nicht gebraucht. Tatsächlich ist jede neue Regierung – und wir werden im kommenden Jahr auf die eine oder andere Art eine neue Regierung bekommen – eine Rettungsmission. Es geht um die Rettung der EU und des Euros, es geht um die Erderwärmung und ihre Folgen, den Schutz der liberalen Demokratie vor ihren Feinden und die zügige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Allerdings gibt es dafür keine wirklich verbindende und leitende Idee unter möglichen Partnern – außer der, keine andere Wahl zu haben. Zwei Parteien fallen von vorneherein für diese Mission aus: Die AfD als rechtsrevolutionäre und reaktionäre Gruppierung ist eine Partei, die sich kein Bild von der Zukunft machen kann und will; und die LINKE lebt fortgesetzt in einem ideologischen Zölibat, das seinen starren Katechismus noch in hundert Jahren unverändert runterbeten will. Bleiben im Moment vier Parteien: CDU/CSU, Grüne, SPD, FDP. Sie sind die neue Sammlungsbewegung der Mitte. Diese Parteien werden sich in gemischten „Komplementärkoalitionen“ mit in der Regel drei Parteien zusammenfinden müssen. Bislang hat vor allem die Lindner-FDP nicht den Eindruck vermittelt, dass sie das verstanden hätte. Und es wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen müssen, ob die CDU/CSU die verlorenen Wähler, die an die AfD gegangen sind, heimholen will oder die, die unter Merkel/Seehofer in den letzten Jahren an die Grünen gegangen sind.
Nur der unbedingte Wille zum Kompromiss wird in Zukunft die Handlungsfähigkeit ermöglichen, die dieses Land braucht. Den Geruch der Prinzipienlosigkeit beginnt der Kompromiss schon abzulegen. Es ist vor allem das Gift der Polarisierung durch Populisten, die den Kompromiss zum neuen Modus Vivendi machen könnte. (Und die Angst vor einer erstarkenden AfD, die sich etabliert hat.) Wenn die ideologischen Konturen verschwimmen, werden die Personen an der Spitze noch einmal wichtiger. Man kann Pläne machen, und Thesenpapiere schreiben. Aber der neue Modus des verschärften Kompromisses verlangt nach einem besonderen Politikertypus (m/w), der Integrität, Souveränität, Nachdenklichkeit, Schwung und Überzeugungskraft zusammenbringt, um Kompromisse schmieden und zugleich die eigene Anhängerschaft führen zu können. Wer sie bislang nicht – oder nicht mehr – hat an der Spitze der Partei, der sollte schnell eine entsprechende Stellenausschreibung formulieren. Die Zeiten und die Herausforderungen sind so. Und sie ändern sich auch so schnell nicht mehr.