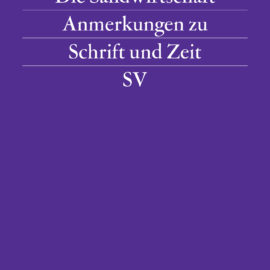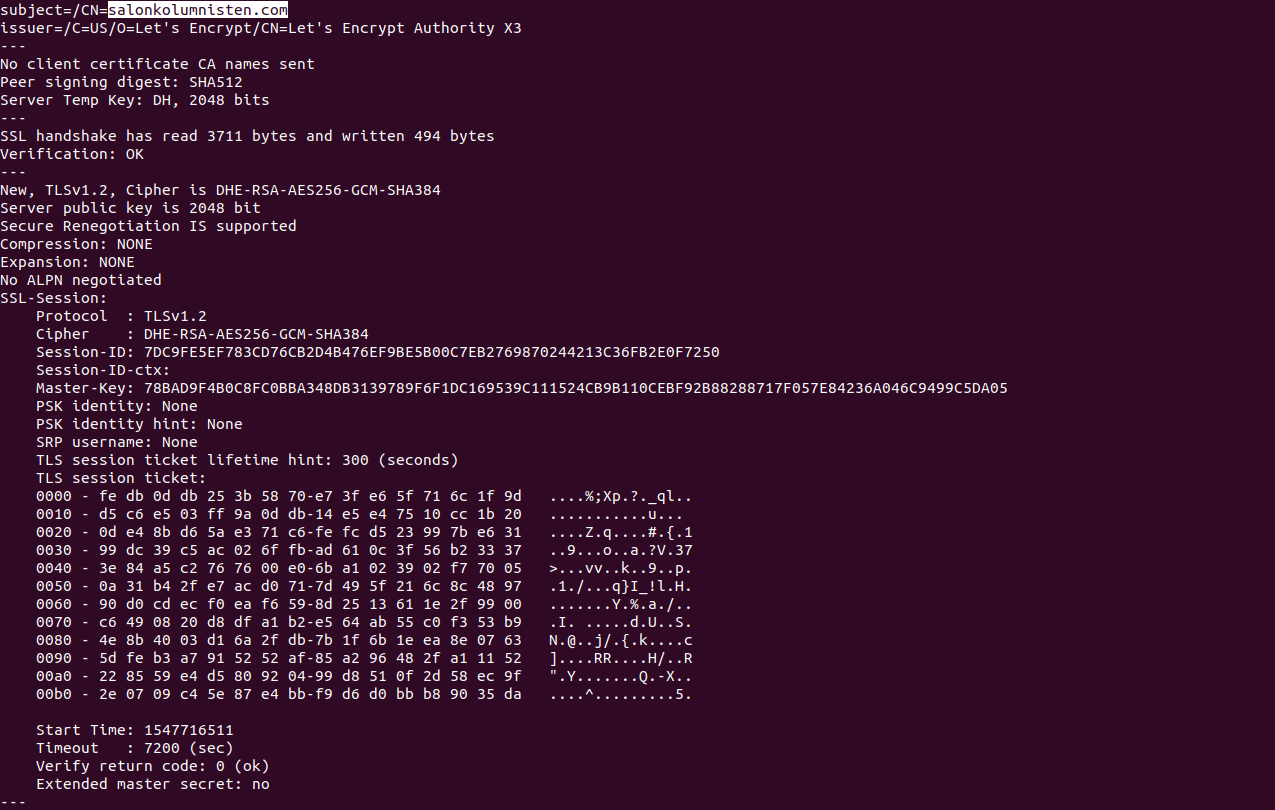Schlote müssen rauchen, auch wenn wir sie nicht brauchen
Donald Trump gibt dem Welthandel die Schuld für den Niedergang der Stahl- und Aluminiumindustrie in den Vereinigten Staaten. Eine Sicht, die populär sein mag, aber das enorme Produktivitätswachstum sträflich verkennt, meint Gastautor Albrecht Kolthoff.
Eine halbe Million Menschen fand noch vor fünfzig Jahren Arbeit und Brot in der amerikanischen Stahlindustrie, jetzt sind es gerade noch 140.000. Der amerikanische Rust Belt ist seit Jahrzehnten sprichwörtlich geworden; die einstige Elite der Industriearbeiterschaft fühlt sich als aussterbende Art und ruft – so wie ihre Arbeitgeber – nach protektionistischen Eingriffen. Zur Staffage seiner Strafzoll-Verkündung hatte Trump ein paar Stahlarbeiter in Arbeitskluft ins Weiße Haus geladen, einige davon mit Gewerkschaftsemblem der United Steelworkers auf dem Hemd, als deren Retter er sich nun inszeniert.
“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum into the United States”
Proclamation: https://t.co/aCaMtOUAl0
Remarks: https://t.co/nypErcqFSU pic.twitter.com/rcrkpvChkz— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. März 2018
Woran liegt es? Brauchen die Amerikaner weniger Stahl, produzieren sie weniger, liegt es an unfairem Handel, wie Trump unermüdlich intoniert?
Nichts davon trifft zu. In den USA ist einfach nur genau das Gleiche wie in so vielen anderen westlichen Industrieländern passiert.
Die Arbeitsplatzverluste in der amerikanischen Stahlindustrie liegen vor allem am technischen Fortschritt. Ich habe ein Vierteljahrhundert in Dortmund gelebt, einst einer der größten Stahl-Standorte (und nebenher Brauerei-Standorte, weil heiß bekanntermaßen durstig macht); der rote Himmel über Dortmund beim Abkippen der Schlacke auf Phoenix bleibt mir mir bis ans Ende meiner Tage im Gedächtnis. Im Ruhrgebiet ist ein Rust Belt zurückgeblieben, nur in Duisburg wird noch Stahl produziert. Ein paar Jahre habe ich in der Oberpfalz verbracht, neben stillgelegten Stahlwerken; in Bayern ist nur eine einzige kleinere Fabrik geblieben.
Gleichbleibende Produktion, sinkende Beschäftigung
Stahlwerke mit Zehntausenden Beschäftigten, die ganze Regionen ernährten – das ist alles Vergangenheit. Wenige hochmoderne Fabriken sind landesweit geblieben. Seit 1980 ist die Produktion etwa gleich geblieben, die Zahl der Beschäftigten hat dagegen über 70 Prozent abgenommen. Oder anders ausgedrückt: Die Produktivität pro Beschäftigten ist um 225 Prozent gestiegen. Deutschland ist nach wie vor größter Stahlerzeuger in der EU, mit gerade noch 85.000 Beschäftigten.
Diese Entwicklung sieht mehr oder weniger in allen modernen Industriestaaten so aus. Eine Ausnahme ist China, wo in den letzten Jahrzehnten und Jahren zunächst vor allem wegen des enormen Eigenbedarfs bei der Entwicklung aller möglichen Industrien gigantische Produktionskapazitäten aufgebaut wurden. China hat aber nur gut fünf Prozent an den Importen in die USA.
Wird denn nun in den USA so viel weniger Stahl erzeugt? Keinesfalls, denn seit 1980 ist die Produktion gerade mal um die 10 Prozent gesunken. Ab 2008 gab es in allen „alten“ westlichen Industriestaaten (inklusive USA, Japan und EU) einen Einbruch der Produktion, der durch die weltweite Finanzkrise bedingt war. Davon haben sich diese Länder wieder erholt.
Zusammengefasst: In den USA sieht es mit der Stahlproduktion genau so aus wie in anderen westlichen Industrieländern – Produktionsmengen etwa wie vor 35 Jahren, bei erheblich reduziertem Personal. Und weltweit sind neue Industriestaaten aufgestiegen und spielen im Weltmarkt mit – Indien, Brasilien, Iran und andere.
Stahl-Romantik
Trump beschwört eine dreckige, laute, mit schwerer menschlicher Plackerei verbundene Stahlindustrie herauf, wie sie in den 1950er-Jahren noch beherrschend war. Die Schlote müssen rauchen, sonst geht’s allen schlecht. Das Ideal ist eine Industrie des 19. Jahrhunderts, wie sie zuletzt nur noch in industriellen Entwicklungsländern anzutreffen war, wo man schnell und ohne große technischen Raffinessen auf Produktionszahlen kommen wollte. Nach diesem Muster hatte auch China vor Jahrzehnten seine Stahlindustrie hochgezogen, bis hin zu dem aberwitzigen Projekt, die stillgelegte Dortmunder Westfalenhütte komplett zu demontieren, nach China zu verschiffen und dort wieder aufzubauen.
Natürlich wird es in den USA keine derartige klassische Stahlindustrie mehr geben, da kann Trump Zölle und Strafen verhängen wie er will – und er wird wohl auch weltweit kaum noch ein Stahlwerk finden, das man irgendwo abbauen und in Pennsylvania wieder aufbauen könnte. Er geriert sich wie ein Arbeiterführer der 1980er, der die unausweichliche Transformation der Schwerindustrie mit aller Gewalt aufhalten will; den älteren Lesern ist vielleicht noch der britische Gewerkschaftsführer Arthur Scargill in Erinnerung, der 1984/85 den ein Jahr währenden Streik der Bergarbeiter anführte. Auch den amerikanischen Bergleuten hatte Trump ja schon mit Streichung von Umweltauflagen das Schwarze vom Flöz herunter versprochen; neue Arbeitsplätze und Aufschwung der heruntergekommenen Regionen sollten sich durch Reenactment der traditionellen Schwerindustrien einstellen. Passiert ist da natürlich so gut wie nichts.
Wirtschaftspolitischen Verstand darf man da natürlich nicht suchen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die populistisch-folkloristische Huldigung an Schwerindustrie und Protektionismus auf eine Wählerklientel zielt, die den selbstdeklarierten Milliardär Trump als Vorkämpfer des einfachen Mannes für bare Münze nimmt. Wie es der Zufall will, findet in der nächsten Woche in der Stahlmetropole Pittsburgh eine Nachwahl zum Repräsentantenhaus statt, wo laut Umfragen der junge Herausforderer von der Demokratischen Partei seinem republikanischen Konkurrenten bis auf wenige Prozente auf die Pelle gerückt ist und der GOP den Sitz abnehmen könnte.
Aber vielleicht hat Trump auch nur versehentlich das ikonische Lied von Bruce Springsteen über die vergangene Stahlindustrie in Youngstown gehört und ist von einer sentimentalen Gefühlswallung überwältigt worden.
Gastautor Albrecht Kolthoff ist freier Journalist. Folgen kann man ihm im Netz unter anderem auf Twitter und Facebook.