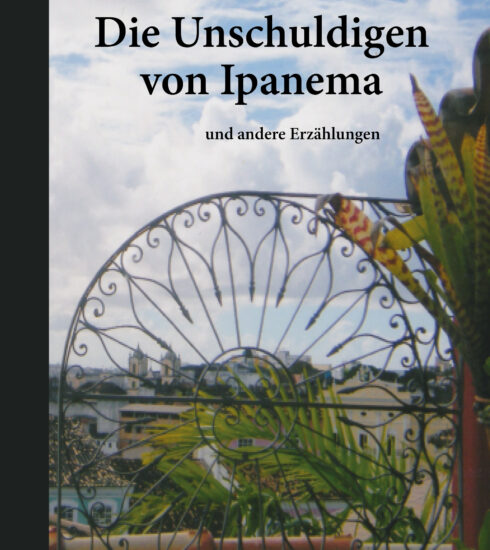Exportschlager Deutsches Kino
Könnte es sein, dass wir gerade jetzt eine große Zeit des deutschen Kinos erleben? Und könnte es sein, dass man das aus der Ferne viel besser begreift? Unser Autor aus Amerika ist jedenfalls begeistert.
Vor ein paar Jahren veranstaltete meine Frau mit ihren Schwestern und Schwägerinnen einen Damenabend, das heißt ich durfte mich für ein paar Stunden aus dem damaligen gemeinsamen Apartment in Manhattan hinausgeworfen fühlen. Es war ein schöner Sommerabend, ich ging ein bisschen auf dem Broadway spazieren und kam schließlich in der Nähe des Lincoln Center zu einem Programmkino, das heute nicht mehr existiert. Gespielt wurde dort ein deutscher Film, er hieß „Barbara“, der Regisseur war ein Christian Pätzold. In einem plötzlichen Anfall von Masochismus legte ich zehn Dollar auf den Zahlteller der Kinokasse und ging hinein. Schließlich wusste ich genau, was deutsches Kino ist: spannungsfreie Drehbücher, hölzerne Dialoge, hemmungslos chargierende Schauspieler und eine politische Botschaft, die völkisches Heimatgetue organisch mit nebulös-linksradikal-antikapitalistischen Phrasen verbindet.
Also kaufte ich mir Popcorn und setzte mich hin. Und dann staunte ich über einen ganz großen, einen ergreifenden Film. Nina Hoss als in die ostdeutsche Provinz strafversetzte Ärztin, die einen reichen Freund im Westen hat. Er organisiert für sie die Flucht aus der DDR über die Ostsee. Dann das Mädchen aus dem „Jugendwerkhof“, das dort im Sinne des real existierenden Sozialismus umerzogen werden soll, und die moralische Entscheidung: Flieht die Ärztin oder fädelt sie für dieses Mädchen die Flucht ein? Ich staunte über die genaue Milieuschilderung. Die große Schauspielkunst. Die schönen Landschaftsbilder. Am meisten mochte ich, dass Pätzold sich für seine Geschichte ganz viel Zeit nimmt. Nur nicht hudeln! Alles genau ausleuchten!
Neulich hatte ich ein vergleichbares Erlebnis. Wir besuchten Freunde in Manhattan, und hinterher hatte ich Lust, ein bisschen allein im Central Park spazieren zu gehen. Also küsste ich meine Frau und mein Kind, die sich ins Auto setzten, und flanierte durch den viel zu warmen Wintertag. Knapp unterhalb des Central Park liegt das „Paris Theater“, ein wunderbar altmodisches Kino, in dem fremdsprachige Filme gezeigt werden, meistens französische. „Le Concert“ von Radu Mihaeleanu habe ich dort gesehen, eine berührende russisch-französische jüdische Geschichte. Und jetzt spielte dort ein Film mit dem Titel „Never Look Away“ von Florian Henckel von Donnersmarck. Wie hatte das an mir vorbeigehen können? Schließlich mag ich diesen Mann mit dem Namen, der so klingt, als hätte Mark Twain ihn sich ausgemacht, seit er „Das Leben der Anderen“ gedreht hat. Manche mögem sich erinnern: Nach 1989 kamen lauter Filme ins Kino, die auf der Prämisse basierten, dass die DDR zum Brüllen komisch gewesen und im Übrigen alles halb so schlimm gewesen sei. Die Titel dieser Filmkunstwerke habe ich längst wieder vergessen. „Das Leben der Anderen“ hat sie allesamt aus meinem Gedächtnis gewischt. Denn dieser Film zeigte, dass die DDR gar nicht komisch war. Ich weiß, es gibt ehemalige Dissidenten, die diesen Film nicht mögen, denn in Wahrheit hat es ja leider keinen Stasi-Offizier gegeben, den die Kunst dazu verführte, ein Mensch zu werden. Pardon, mir gefiel der Film trotzdem. Sehr.
Wenig später wird sie tot sein
Nun also „Never Look Away“. Der deutsche Titel ist „Werk ohne Autor“. Es geht um Gerhard Richter (dessen Werk mir übrigens nichts bedeutet), aber im Kern geht es natürlich um etwas viel Größeres: Florian Henckel von Donnersmarck hat sich diesemal die deutsche Geschichte seit der Nazizeit vorgenommen. Und es geht um die Möglichkeit, dass Kunst es einem Menschen möglich macht, mit dem Horror der Geschichte, auch der eigenen Familiengeschichte, zu leben. „Never Look Away“ beginnt mit der berühmten Wanderausstellung über „entartete Kunst“, die 1937 in Deutschland zu sehen war. (Meine Großmutter sel. A. hat diese Ausstellung damals in München gesehen. Sie erzählte mir, wie sie all diese „herrlichen Bilder“ gesehen habe, die Bilder von Franz Marc und Kandinsky und Paul Klee – „herrlich, herrlich!“ –, alle versehen mit hasserfüllten Erklärungen, und wie sie hinterher nach Hause ging und die Tränen nicht mehr halten konnte.) In Henckel von Donnersmarcks Film ist es erst unscharf; dann sehen wir das Gesicht des Nazi mit der Mütze, der eine Gruppe durch die Ausstellung führt. Ganz subtil konzentriert die Kamera sich immer mehr auf einen kleinen Jungen und eine hübsche junge Frau in dieser Gruppe: den Helden des Films und seine Tante. Wenig später wird sie tot sein, vergast, weil bei ihr eine milde Form von Schizophrenie diagnostiziert wurde, und der Junge wird mit ansehen, wie Dresden verbrennt. Und da ist der Film noch nicht einmal bei der Hälfte angekommen.
Mehr als drei Stunden dauert das Ganze, und ich wollte nicht eine Minute, nicht eine Sekunde verpassen. Am nächsten Tag schleppte ich einen Freund mit in diesen Film, und am Sonntag möchte ich meine Frau mitnehmen. Das ist ganz großes Kino. Ganz große Kunst. Natürlich steht das, was Henckel von Donnersmarck da macht, in einer langen Tradition, nämlich der des Künstlerromans, in dem es darum geht, wie ein junger Mann mit seinem Stoff ringt, darüber beinahe verzweifelt, von dunklen Mächten an der Erfüllung gehindert wird und endlich – tadaa! – doch den Durchbruch schafft. Aber was Henckel von Donnersmarck mit dieser Schablone anstellt, ist etwas ganz und gar Eigenes. Denn die dunkle Macht, gegen die der Künstler (Tom Schilling) kämpft, ist sein eigener Schwiegervater, und der Schwiegervater war jener Euthanasiearzt, der seine Tante ins Gas geschickt hat. (Ich habe mittlerweile gegoogelt: Das stimmt alles wirklich. Vielleicht sollte ich mich doch mal mit dem Werk von Gerhard Richter beschäftigen.) Übrigens ist Florian Henckel von Donnersmarck ganz nebenbei etwas sehr Erstaunliches gelungen: Er hat ein Filmmonster geschaffen – gespielt von Sebastian Koch –, ein Ungeheuer, das ganz und gar realistisch wirkt.
Der Blick aus der Ferne
Der Film hat bei allem Ernst auch wunderbar heitere Momente. Etwa wenn (nach gelungenem künstlerischem Durchbruch) die Künstlerkollegen des jungen Genies mit ihm eine Treppe aufwischen, mit dem Waschwasser Kringel aufmalen, á la Jackson Pollock Seife auf den Boden verteilen. Gewiss, hier macht Florian Henckel von Donnersmarck sich über die zeitgenössische Kunst lustig, aber ohne alle Verbissenheit oder Boshaftigkeit. Im Zentrum dieses Films steht eine furchtbar altmodische, eigentlich romantische Idee: Der Künstler als Genie. Er bezieht diese Genialität aus seiner Lebensgeschichte versöhnt uns, weil er ein Genie ist, mit dem Universum – ohne auch nur einen Moment lang die Schrecken der Geschichte zu leugnen, im Gegenteil. Mit dieser altmodisch-romantischen Idee mögen manche ihre Schwierigkeiten haben. Ich nicht.
Mit alldem komme ich naturgemäß viel zu spät. Ihr in Deutschland wisst all dies längst, bei euch wurde dieser Film schon im Herbst 2018 gezeigt. Ich möchte hier aber eine gewagte These aufstellen: Gemeinhin gelten die Siebzigerjahre als die große Zeit des deutschen Kinos: Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders, Volker Schlöndorff etc. pp. Aber unter uns: Wer möchte dieses Zeug nochmal sehen? Wer will Herzogs „Nosferatu“ nochmal anschauen, oder Fassbinders „Angst essen Seele auf“ (oder gar sein Machwerk „Lily Marleen“, das Deutschland – ernsthaft, jetzt! – als Opfer der Nazis und jüdischer Plutokraten zeigt) oder Schlöndorffs glattgeleckte Literaturverfilmungen? Ein paar hartnäckige Cinéasten und Liebhaber vielleicht, sonst niemand.
Mich beschleicht aber der Verdacht, dass Filme wie „Barbara“ oder „Werk ohne Autor“ sich als ziemlich haltbar erweisen werden. Weil das groß erzählt und tief gefühlt und klar durchdacht und unvergesslich gefilmt ist. (Die Filmmusik in „Werk ohne Autor“ ist übrigens der Hammer.) Könnte es also sein, dass wir gerade jetzt eine große Zeit des deutschen Kinos erleben? Die erste große Zeit seit den Zwanzigerjahren, als in Deutschland noch solche Giganten wie Fritz Lang und Friedrich Murnau und Ernst Lubitsch wirkten? Und eine zweite Frage: Ich habe mittlerweile ziemlich viele nörgelige deutsche Besprechungen von „Werk ohne Autor“ gelesen, die mich allesamt nicht überzeugen, dass mein Kinoeindruck falsch war. Könnte es also sein, dass es leichter ist, diesen großen Moment des deutschen Films von außen wahrzunehmen als von innen?