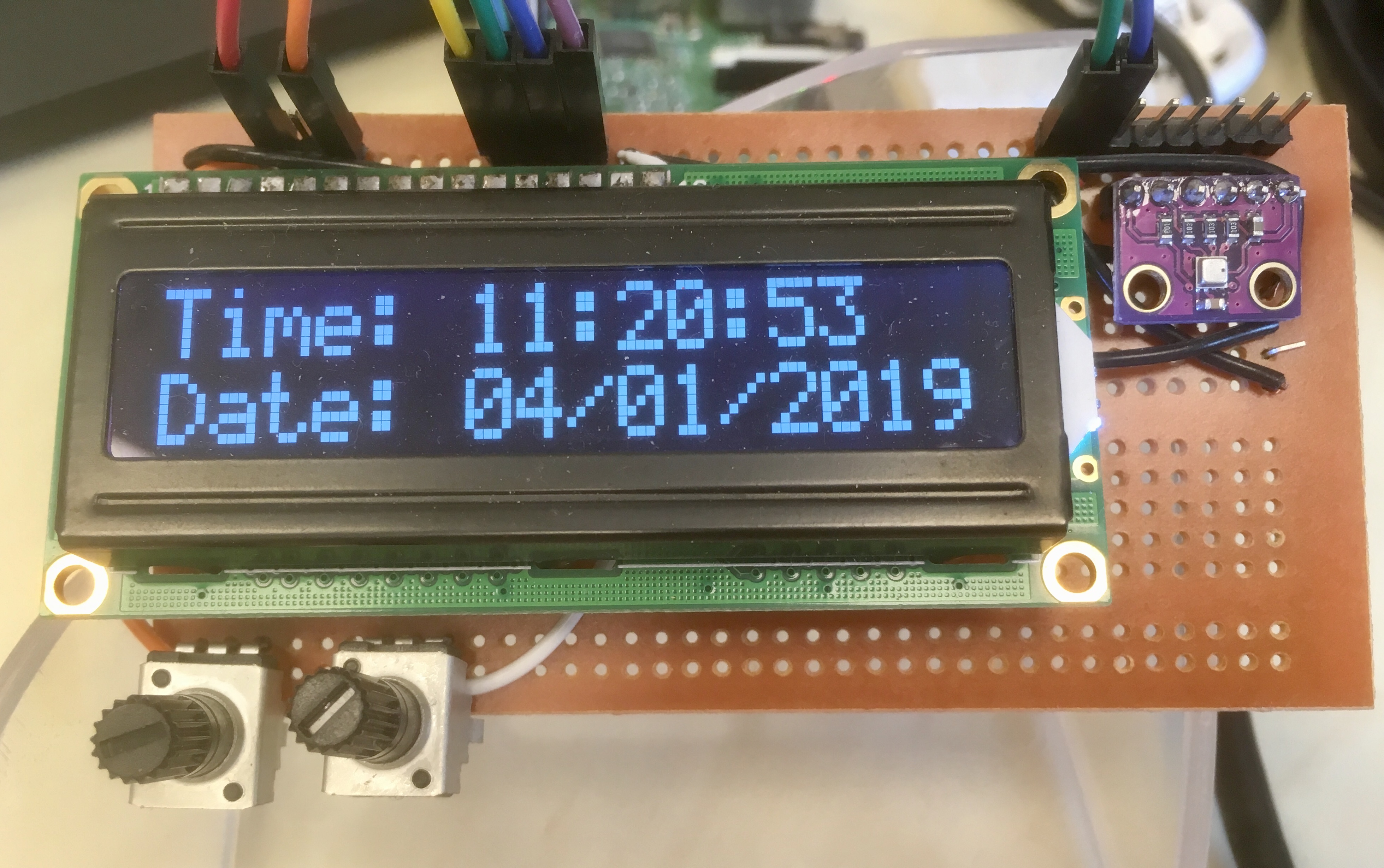Her mit dem schönen Leben!
Am Ende ist jedes Leben zu kurz. Über den unvermeidlichen Tod und das fröhlich-unbekümmerte „Du musst dein Leben rocken!“ von 12-jährigen Mädchen.
Es war im Sommer 2010 als ich wie so häufig dachte, dass das Leben doch eine wunderbare Sache sei. Ich saß auf einer Bank vor einem architektonisch imposanten Gebäude in Barcelona, trank viel zu teures Wasser, das die Menschen in U-Bahn-Gängen verkauften, während alle anderen Geschäfte Siesta machen, ich genoss die Hitze und Alltagssituationen dieses Augenblicks, als mein Handy klingelte. Es war mein Vater. Ich liebte stets diese Momente, wenn man selbst irgendwo an einem Örtchen der Welt saß, während sich eine familiäre Stimme von zu Hause meldete, aus der Welt in der man aufwuchs, wo die Dinge ihren gewohnten Gang gingen. So saß mein Vater bei seinem Mittagskaffee an einem gewöhnlichen Samstag und wollte nur von mir wissen, wo ich sei und was ich so mache. Eigentlich wie immer. Eigentlich. Doch als ich auflegte, meinen damaligen Freund ansah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Irgendwas spürte ich, sei anders, wenngleich ich es nicht in Worte fassen konnte.
Die Monate vergingen, es kam die Weihnachtszeit und so fuhr ich aus Berlin nach Süddeutschland zur Familie, wo ich auch jetzt bin und wo sich Erinnerungen in den Gedanken emporklimmen, die ich immer noch nicht vergessen habe, obwohl mein Gedächtnis sonst häufig ähnlich wie ein Sieb funktioniert. Mein Besuch heute und Geschehnisse der vergangenen Wochen sind Auslöser für diesen Text.
Wie immer ging auch 2010 meine gesamte Familie am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam essen. Da wir sehr international sind und wir unter anderem auch Chinesen in der Familie haben, gehen wir als Gruppe, die an eine United Colors of Benetton-Werbung erinnert, an diesem Tag stets Asiatisch essen. Das Gefühl, dass etwas nicht stimme, ließ mich auch in dieser Zeit nicht los. Ich beobachtete meinen Vater in diesen Tagen genau. Ich erinnere mich, mich ständig gefragt zu haben, was es sei, dass mich stört. Ich fand keine Antwort darauf. Auch als er mich vor Silvester morgens um 5 Uhr zum Flughafen brachte, hatte ich noch keine Lösung gefunden.
Die Unfairness des Lebens
Mein Vater starb am 21. März 2011. Nur zwei Monate zuvor hatten wir seine Krebsdiagnose erhalten. Nicht, dass es jemals eine Zeit gäbe, die lang genug wäre, um sich auf den Tod eines geliebten Menschen vorzubereiten, war diese Zeitspanne einfach zu kurz. Zu kurz, um zu verstehen, zu kurz, um zu leben, zu kurz, um zu akzeptieren, zu kurz, um sich zu verabschieden. Einfach zu kurz.
In der Nacht vor seinem Tod, erwachte ich wegen eines Albtraums in dem er verstorben war. Nur wenige Stunden danach erhielt ich den Anruf meiner Mutter. Ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Hierbei geht es nicht um Übersinnlichkeit, Esoterik, nicht um Glaube – schon gar nicht bei mir als Hardcore-Atheistin – sondern um besondere Bindungen zwischen Menschen. Ich war immer schon ein Papa-Kind gewesen. Er hatte diese warme Herzlichkeit in seinem Blick, die nur wenige Menschen besitzen, diese Güte in seiner Seele, die häufig nur Kinder wahrnehmen, weshalb sie ihn stets vergötterten, dieses Gute Wesen, dass es so oft nicht gibt. Und irgendwie wusste ich eben bereits vor ihm, dass es ihm nicht gut ging.
In den Monaten danach war das einzige, woran ich denken konnte, die Tatsache, wie unfair das Leben doch war. Warum er? Ich sah Menschen in Berlins U-Bahnen, die sich über Jahre hinweg mit sämtlichen Rauschmitteln zugrunde richteten – irgendwann kennt man viele von ihnen vom Sehen – und dennoch leben dürfen. Versteht mich nicht falsch: Ich gönne jedem das Leben, egal, was man selbst daraus macht, aber diese Gedanken waren stärker als meine Vernunft.
Die Zeit, die mein Vater und ich gemeinsam auf dem Planeten verbringen durften, war einfach zu kurz gewesen. Es ließ mir keine Ruhe, dass ich am Ende meines Lebens, falls ich die Lebenserwartung unserer Gefilde erreichen sollte, so viel mehr Zeit ohne als mit ihm verbracht haben würde. Ich war neidisch auf jeden, der einen lebenden Vater hatte und das waren einige. Ich dachte während der zwei Monate seiner Krankheit häufig darüber nach, wie es wäre ohne ihn. Ich dachte, dass mir der Boden unter den Fußen entgleisen würde, sobald diese Situation eintritt, die Luft zum Atmen zu dünn werden würde, um selbst weiterzuleben. Doch es passierte und ich lebte weiter. Weil wir Menschen so sind.
Leben wir genug?
Dies soll kein Text über den Tod sein. Sondern ein Text über das Leben. In den vergangenen Wochen gab es im engeren Freundeskreis Todes- und Krankheitsfälle. Ich habe gelernt, mit diesen Situationen umzugehen. Denn diese Dinge erden uns. Sie zeigen uns, wie man Wichtiges von Unwichtigem trennt. Sie zeigen, worauf es im Diesseits ankommt. Um das schöne Leben. Seit dem Tod meines Vaters denke ich bewusster über genau dieses nach. Ich versuche jeden Tag zum besten Tag meines bisherigen Lebens zu machen. So plump das auch klingen mag.
Als ich vor einigen Jahren für eine kurze Zeit in München lebte und abends auf dem Weg zu einer Party war, begegnete mir eine süße Mädchen-Gang bestehend aus fünf, sechs ungefähr 12-Jährigen. Sie fragten mich, ob ich ausgehen würde, was ich bejahte. Danach sagte die offensichtliche Anführerin der Bande: „Du musst dein Leben rocken!“ Das leuchtete mir ein und blieb haften. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt. Selbst wenn sie 100 Jahre lang sein sollte, wäre das nicht genug. Deshalb sollten wir das Leben feiern, unsere Tage mit uns sinnvoll erscheinen Dingen füllen, Zeit nur mit Menschen verbringen, die wir mögen, Jobs machen, die uns in erster Linie Spaß machen, sowieso größtenteils nur Dinge tun, die uns Spaß machen, im Jetzt leben und alles andere unser Future-Ichs Problem sein lassen, abends ins Bett gehen und denken: Heute war ein guter Tag. Es gibt keine Fairness im Leben, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wir sollten uns also nicht damit aufhalten, dies ändern zu wollen oder es zu hinterfragen. Stattdessen sollten wir einfach machen und uns nur die eine Frage stellen: Leben wir genug?
Ich habe in all den Jahren nur ein einziges Mal von meinem Vater geträumt. Das war einige Monate nach seinem Tod. Mein Handy klingelte, er rief an. Ich zögerte lange bevor ich mich meldete, weil ich in meinem Traum wusste, dass er nicht mehr lebte. Vorsichtig fragte ich ein schüchternes: „Ja?“ Er sagte: „Wie geht es dir?“ Ich antwortete zögerlich, dass ich nicht verstünde, wie er mich anrufen könne und dass das doch gar nicht möglich sei. Er sagte lachend: „Natürlich können wir immer miteinander sprechen.“
An Tagen wie diesen, wo man das Leben besinnlich mit der Familie feiert, fehlt er noch mehr. Doch es ist ok. Schließlich können wir immer miteinander reden. Und auch morgen wird wieder der beste Tag des bisherigen Lebens sein.