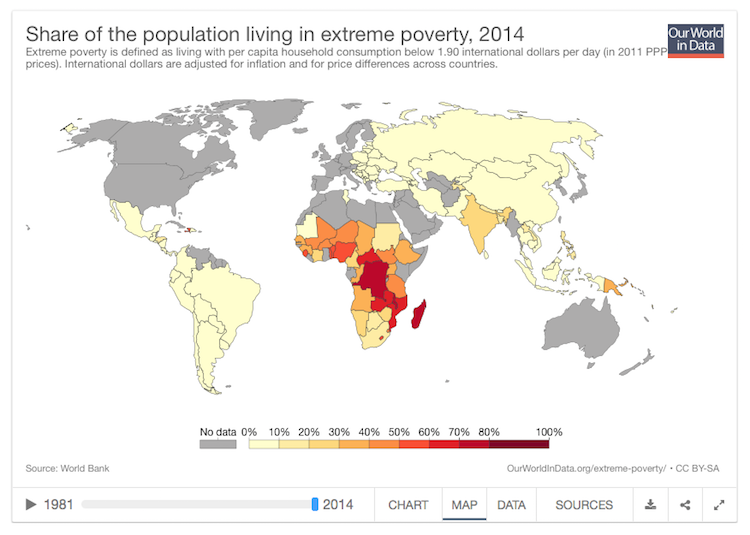„Hier wird nicht mehr berlinert“
Vor wenigen Tagen besuchte unsere Autorin Raquel Erdtmann das Viertel ihrer Jugend, das in den vergangenen Jahren mit Sagrotan behandelt wurde. Ihr Fazit: „Für uns ‚Zonenkinder‘ gibt es hier keine Heimat mehr.“
Die Oderberger vor drei Jahren wieder zu betreten, war ein Schock.
So hell und vor allem so farbenfroh war sie geworden. Ich kannte sie nur grau in allen Schattierungen. Über zwanzig Jahre hatte ich den Stadtbezirk, in dem ich zu DDR-Zeiten aufgewachsen war, nicht mehr aufgesucht. Ich war zum Studium nach Frankfurt am Main gezogen und blieb dort hängen. Wenn ich nach Berlin zurückkehrte, verbrachte ich die Zeit im Westteil, wo Freunde lebten, die ich kurz nach der Wiedervereinigung der Stadt kennengelernt hatte und die meine Zweitfamilie wurden. Von meinen alten DDR-Freunden und Bekannten wohnte fast keiner mehr im Prenzlauer Berg, die meisten waren eins weiter nach Pankow geflüchtet, wo ich zur Oberschule gegangen war. Es gab niemanden mehr zu besuchen für mich im alten Viertel, den nun alle »Kiez« nannten und »Prenzlberg«.
Unsere alten Nachbarn, die jahrzehntelang in den großen Altbauwohnungen mit Ofenheizung hinter den abgerockten Fassaden, mit Einschusslöchern aus dem Krieg und abgebrochenen Balkonen gewohnt hatten, mussten ihr Zuhause verlassen. Die Rente reichte nicht für »Schöner Wohnen« mit Badsanierung, Heizung und Lift, die ihre Mieten verdrei-, vervier-, verfünffacht hatten. Zu DDR-Zeiten waren es oft junge Familien gewesen, die in die Plattenbauten nach Lichtenberg oder Hohenschönhausen zogen. Heizung, fließend warmes Wasser und Dächer, durch die es nicht durchregnete, machten das Leben mit kleinen Kindern komfortabler, statt nach einem langen Arbeitstag erst Kohlen aus dem Keller zu holen, um für Wärme zu sorgen. Und Klo halbe Treppe, immer mit der Gefahr, dass die Wasserleitungen im Winter einfroren, kann nicht mal ein hartnäckiger Anfall von Nostalgie heute schön malen.
Die eiskalten Wohnungen im langen Berliner Winter, wenn man abends nach Hause zurückkehrte und die frühmorgens beheizten Öfen bereits schon wieder erkaltet waren, habe ich nicht vergessen, trotzdem hätte ich nie in einer Neubausiedlung wohnen wollen, wo die Wände so dünn waren, dass man den Nachbarn Knäckebrot essen hörte, wie wir sagten.
Die alten Dielen in unseren Wohnungen waren mit »Ochsenblut« gestrichen, wer den Anblick der rotbraunen Farbe nicht ertrug, legte Teppichware drauf (so er sie ergatterte) oder schliff den Anstrich selber ab.
Meine Heimat roch nach Kohleöfen und Zweitaktern. Beim Bäcker in der Wörther Straße gab es für ein paar Pfennige Kuchenränder nach der ekligen Schulspeisung, ganz so wie in den Kinderbüchern von Erich Kästner.
Fleischer Dufft in der Oderberger war der König des Viertels, die Leute standen Schlange vor seinem Laden, Stunden, bevor er öffnete. Der Fotograf Harald Hauswald hat es festgehalten.
Wohlstandskinder aus dem Westen
Harald Hauswald – im c/o Berlin ist jetzt eine Retrospektive seiner Arbeit zu sehen.
Als Telegrammbote verdiente er sein Geld und kam so in die hintersten Winkel des Viertels, die Kamera immer dabei. Ich kneife die Augen zu, wenn ich jetzt dort bin – täuschen mich meine Erinnerungen? Aber hier war doch…? Und dieser Hof hier? Ich finde mich oft nicht zurecht mit der Überlagerung der Bilder aus meiner Erinnerung und Hauswalds und dem, was ich jetzt sehe. Die Verwirrung entsteht nicht nur durch die jetzt so herrlichen Fassaden der Häuser, mir fehlen die Menschen, die dort lebten als ich klein war. Die Alten, die als Kinder Käthe Kollwitz noch kannten, die Arbeiter, die in irgendeinem VEB angestellt waren und nach Feierabend Bier und Korn im Prater und den unzähligen Kneipen des Viertels soffen, rauchend und mit Berliner Schnauze. Die aus dem System gefallenen Dissidenten, die mit ihren Texten und Liedern ihre Freiheit riskierten, tatsächlich. Heute sehe ich nur Leute dort, die sich laut »kritisch« gebärden, nichts riskierend, lächerliche persönliche Bedrohungsszenarien perpetuierend, in ihrer Blase lebend, Wohlstandskinder aus dem Westen.
Mir fehlen, obwohl ich zu jung war, dort reingelassen zu werden, die ollen Schwulenkneipen der Ecke, aus denen Schlager und Rauchwolken drangen und die geheimnisvoll schummrig beleuchtet waren. »Bermudadreieck« nannte man die Gegend um den U-Bahn-Hof Dimitroffstraße, der nun Eberswalder Straße heißt. Wir reden heute von Gender und Diversität, aber diese geschützten Treffs Gleichgesinnter haben die Zeit nicht überlebt in diesem komplett gentrifizierten Bezirk. Natürlich hat das nach der Wiedervereinigung mit simplen ökonomischen Gründen zu tun. Aber ich kriege dummerweise immer noch Herzschmerzen, wenn ich nun Yogastudios, vegane Imbisse oder Läden mit liebevoll handgefertigen Dingen dort finde, die schön sind, aber niemand braucht. Ich vermisse die alten trunken-tränennassen Augen dieser Männer, die kaum ein Wort über sich und ihre Existenz im Verborgenen verloren und so überaus höflich waren. Die dauergewellten älteren Damen in der Polyesterschürze, die uns ankeiften, wenn wir zu laut im Hof waren.
Der Prenzlauer Berg war ein Arbeiterbezirk wie der Wedding im Westen. Neben den vielen Proletariern, die seit Generationen dort lebten, minus der deportierten Juden, hatte sich am Charakter des Viertels zu DDR-Zeiten nicht viel verändert. Die jüdischen Mitbewohner fehlten, aber wohl den meisten nicht zu sehr, man sprach nicht über ihr Verschwinden, aber das war und ist an jedem Ort Deutschlands so, Ost wie West, nichts gewusst, nichts gesehen, „man konnte ja nichts tun“. Der alte jüdische Friedhof nahe des Kollwitzplatzes wurde als kurzer Durchgang zur Schönhauser Allee benutzt. Der »Judengang«. Mittlerweile ist der Zugang verschlossen.
Der Platz, an dem Kollwitz wohnte und ihr Mann seine Arztpraxis betrieb, ist immer noch ein Spielplatz, aber nun gibt es hier einen schicken Markt, man trifft sich dort, den Kinderwagen für den Preis einer Monatsmiete schiebend zum Holunderpunsch und in den ehemals heruntergekommenen, jetzt luxussanierten Wohnungen drumherum wird nicht mehr berlinert.
„Play dates“ statt Dachwanderungen
In der Oderberger gab es einen Durchgang zu einem Hof, der an die Kastanienallee grenzte. »Paradiesgarten« hieß der, bis er irgendwann durch eine Bürgerinitiative entrümpelt und begrünt wurde, eine drei Meter hohe Hirsch-Skulptur aus Schrottteilen dort aufgestellt und das Areal nun »Hirschhof« genannt wurde. Wir spielten dort, es gab Konzerte und Theateraufführungen, spontane Feste – die Stasi wahrscheinlich immer dabei. Hauswald hat es dokumentiert.
Um die Ecke in der Oderberger wohnten ein prominenter und verfemter Liedermacher und seine Frau, eine Regisseurin, beide bekamen Auftritts- und Berufsverbot. 1988 wies die DDR sie aus. Wir hörten seine Lieder heimlich, die Kassetten so oft kopiert und abgespielt, dass ein dumpfes Rauschen seine Stimme überzog, der Rekorder klackerte, bis das Band riss.
Nun bin ich plötzlich wieder öfter hier. Ein Freund wohnt dort. Ein merkwürdiger Zufall wollte es, dass er nach langen Jahren in New York genau in den Bezirk meiner Kindheit gezogen war. Muss ich dazu sagen, dass er gebürtiger Schwabe ist?
Ich stehe auf seiner Terrasse, einer phantastisch-schönen Terrasse, angrenzend an eine natürlich bezaubernde Wohnung, wo früher nur ein verstaubter Dachboden war, und schaue in den Hof, der nun Privateigentum und verschlossen ist.
Die Dächer, über die wir, damals war ich noch schwindelfrei, von Haus zu Haus wanderten, durch die Dachluken stiegen – wo es nicht weiterging zum nächsten Haus dann runter durch die Keller und wieder hinauf, tragen keine billige Dachpappe aus Teer mehr, die notdürftig ihre Löcher stopfte. Wat habtn ihr hier zu suchen, ab innen Hof, ihr Jörn. Een Krach machen die wieda!
Kinder gibt es wieder viele im Prenzlauer Berg, sie tragen jetzt Helme und pfeifen nicht die Clique zusammen zum Spielen, ihre Eltern vereinbaren »play dates« für sie. Sie essen keine Kohlsuppe mit undefinierbaren Fleischresten in der Schulspeisung, sondern Bio-Huhn und Tofuwürstchen. Die Dachböden sind keine dunklen, geheimen Versammlungsorte der Bande mehr, in die man nur mit der richtigen Parole reingelassen und Schätze versteckt wurden. Dort sind nun offene Designerküchen, die Bretterböden feinstes Parkett, die Fenster groß und Mama und Papa wachen über ihre Kinder jede Stunde des Tages. Die Höfe sind aufgeräumt, gepflastert, hell und grün, keine ollen Schuppen stehen mehr da, es wird nicht mehr geschraubt dort, höchstens an einem Kunstwerk.
Eine irritierende Aggression überkommt mich jedesmal in dieser schönen neuen Welt.
Haben wir, unsere Eltern, nicht den Verfall zu DDR-Zeiten so bedauert? Uns nach einem Bad mit fließend Warmwasser gesehnt, die verfallenen und abgeschlagenen Balkone betrauert, das Kohlenschippen und -schleppen verflucht? Und was haben wir gestaunt, als zur 750-Jahr-Feier Berlins die Husemannstraße verhübscht wurde, damit man ausländischen Gästen vorzeigen konnte wie schön es die Arbeiter nun im Sozialismus hatten im alten Arbeiterbezirk. Ein potemkinsches Dorf, die kurze Straße, den Rest der Fahrt der Staatskarossen müssen die Jalousien wohl zugezogen worden sein. Bei Spirituosen Wojatzke wurde weitergesoffen, trotz der schönen Fassade und hintenraus war sowieso alles so rottig wie zuvor. Schick war damals am Kollwitzplatz nur die Kneipe »1900«, in der Schauspieler vom Deutschen Theater verkehrten.
Passé.
Den alten grau-bunten Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, diese Mischung aus einfachen Leuten und subversiven Künstlern gibt es nicht mehr. Als hätte man nach der Restauration der Häuser eine Flut von Sagrotan über das Viertel gespült, nachdem die alten Bewohner es verlassen mussten, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen konnten.
Aber ist es nicht großartig, nun Restaurants und Bistros mit den Küchen der Welt dort zu finden? Was vermisse ich? Und was geht es mich an, lebe ich doch schon so lange nicht mehr in der Stadt. Ich führ‘ mich auf wie eine Verstoßende, wenn ich nun dort bin, finde mich albern und seltsam gekränkt. Was wollt ihr alle hier, möchte ich jedesmal rufen, das ist mein Zuhause.
Was ist schlecht an »handcrafted« Gin oder daran, dass das Schnitzel im Prater nun aus Kalbfleisch ist, wie es sich gehört und jeden Tag serviert wird, statt »Schnitzel is aus!« Es nun dazu guten Weißwein aus der Pfalz gibt und keiner mehr aus Verzweiflung süßlichen bulgarischen Rotwein trinken muss?
Gentrifizierung, in Berlin nicht anders als in New York, Paris, London, die Anziehung einer Großstadt und die Verdrängung der Alteinwohner, nichts Besonderes, eine Entwicklung wie überall. Und auch vor hundert Jahren strömten Leute vom Land in die wachsende Stadt.
Also was?
Suche ich Heimat?
Ich höre das Stöhnen und Seufzen von Leuten aus der Provinz, die nach einem Besuch bei den Eltern resigniert vermelden, nichts habe sich geändert, die einen Stillstand im Denken und Leben beklagen, vor dem sie flohen und von denen viele genau das, wenn sie zu Besuch sind, genießen. Sei es, weil es ihnen ermöglicht, sich dort weltläufig und auf der Höhe der Zeit zu fühlen oder weil sie insgeheim die vertraute, übersichtliche heimische Umgebung vermissen, von der sie am liebsten ein Stück nach Berlin verpflanzten. Und es auch tun.
Eitle westdeutsche Selbstinszenierung
Restriktionen des sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaats gegen Bürgerinitiativen, die uns Grünflächen erstritten und den Abriss der heruntergekommenen Gründerzeitbauten verhinderten, sind nun ersetzt durch Lärmbeschwerden und Rauchverbote der zugewanderten Provinzler, die zum Feiern kamen, das anything goes der Neunziger genossen und nun um ihren und den Schlaf ihrer spätgeborenen Kinder fürchten. Für uns »Zonenkinder« gibt es hier keine Heimat mehr.
Nach dem Bau der Mauer wurde im Westteil eine Aussichtsplattform errichtet, auf der zuerst Angehörige auseinandergerissener Familien in die Oderberger winkten, später Touristen aus aller Welt sich die Ostler anguckten, wie Affen im Zoo. Jetzt sind die Touristen in der Straße, der schönen Straße. Viele der nun luxussanierten Wohnungen sind Airbnbs.
Aber ist es nicht wunderbar, nun alle Sprachen der Welt dort zu hören? Haben wir uns nicht so sehr nach einer grenzenlos offenen Welt gesehnt?
Diskussionen, bei denen man sich tatsächlich um Kopf und Kragen reden konnte, finden im Prenzlauer Berg nicht mehr statt, die vermeintliche persönliche Bedrohung der Diskutanten im Schwarzsauer ist eine eitle westdeutsche Selbstinszenierung, die nichts als das eigene Ego kennt und vor der die Nachkommen der Alteinwohner aus dem Viertel ihrer Kindheit angewidert flohen. Man ist dort jetzt unter sich und einig, was die richtige Weltanschauung ist. Berlinert wird dabei nicht, von den neuen Bewohnern ist kaum jemand in der Stadt aufgewachsen. Der Prenzlauer Berg ist jetzt sauber und ordentlich, Krawalle veranstalten nicht mehr Stasi und Volkspolizei, sondern besoffene Touristen, vom Angebot im Späti überwältigt.
In den Fotos von Harald Hauswald begegnet mir mein Prenzlauer Berg, ich meine die Menschen wiederzuerkennen, die ich ja doch nicht kannte, oder doch? Bin – wie in eine Zeitmaschine versetzt – wieder in meinem Zuhause, das es nicht mehr gibt.
Harald Hauswald
Voll das Leben! . Retrospektive
bis zum 23. Januar 2021
C/O Berlin Foundation . Amerika Haus . Hardenbergstraße 22–24 . 10623 Berlin
Öffnungszeiten

Über die Autorin Raquel Erdtmann: Aufgewachsen in (Ost)Berlin. Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Seit 2016 freie Autorin. Berichtet aus dem Gericht für die F.A.Z. (F.A.S.) Aktuelles Buch: »Und ich würde es wieder tun« Wahre Fälle vor Gericht (S.Fischer). Lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.