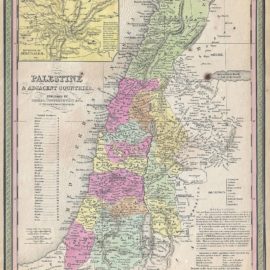In Bonn und um Bonn herum: Der Abschied der SPD vom Westen
Große Erfolge feierte die SPD, nachdem sie die Westbindung akzeptiert hatte. Heute sieht sie ihren Weg zur Macht in deren Ablehnung.
Heute um die 30 zu sein, macht nur bedingt Spaß. Klar, es ist nicht alles schlecht, immerhin haben sich zu Drogen und billigen Urlauben als zeitlosen Ergötzungen der Jugend in unserer Zeit die Smartphones gesellt, dazu sprechen wir heute alle eine Handvoll Sprachen und waren schon in zwei Dutzend europäischen Hauptstädten. Entfernungen spielen für uns keine Rolle mehr, Geld ist relativ, allem Gejammer zum Trotz. Uns geht es gut.
Dass das so ist, ist zum Gutteil eine Folge jener Friedensperiode, die Europa mit Ausnahme des Balkans seit dem Krieg erlebt hat und die historisch betrachtet schon atemberaubend lange anhält. Diesen langlebigen Frieden ermöglicht hat uns Europäern und ganz besonders uns Deutschen der atomare Schutzschirm, den die Amerikaner über ihre NATO-Partner aufgespannt haben und dem es zu verdanken ist, dass sowjetische Expansionsgelüste nie über Planspiele und Militärmanöver hinauskamen. Diese Abwesenheit von Krieg beeinflusste auch die Debatten, mit denen die heutige Entscheidergeneration sozialisiert wurde. Für viele ihrer Mitglieder waren die Straßenkämpfe der Achtundsechziger längst zum Mythos geronnen, als sie ihre eigenen Schlachten schlugen: gegen das Waldsterben, gegen die Startbahn West oder gleich gegen Grundstücksspekulanten im Westend; mancher allerdings auch nur gegen die West-Berliner Sperrstunde.
Kämpfe von gestern
Wenige Themen aber dürften einen nachhaltigeren Eindruck auf die Generation der zwischen ca. 1960 und 1970 Geborenen gemacht haben als der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. Der Widerstand gegen die zur Erhaltung der Bedrohungsparität zwischen den Machtblöcken beschlossene NATO-Aufrüstung wurde für alle in der Bundesrepublik, die sich in irgendeiner Form als links verstanden, zum generationsbildenden Erlebnis und für die Friedensbewegung sowie die gerade erst gegründeten Grünen zur Stunde Null.
Der Groll der etwa 400.000 Demonstranten, die sich am 10. Juni 1982 zum Protest gegen den Doppelbeschluss auf den Bonner Rheinauen einfanden, richtete sich neben dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan vor allem gegen die Bundesregierung unter Helmut Schmidt. Für all diejenigen unter uns, die wie der Autor dieses Textes zu jung sind, um sich an Helmut Schmidt anders zu erinnern als an den Ohrensesselopa, der weise ergraut und blau umwölkt in Polittalkshows herumsaß und die Welt erklärte: Schmidt war als Sozialdemokrat damals Bundeskanzler und trug, trotz gewissem Lavieren, den Doppelbeschluss grundsätzlich mit.
Bündnistreue in Zeiten des Friedens
Heute mutet das alles wie sphärische Klänge aus einer lange versunkenen Welt an. Die deutsche Parteienlandschaft, natürlich auch die SPD, hatte es sich nach 1991 in der Überzeugung bequem gemacht, dass das Konzept „Krieg“ in Mitteleuropa keine Relevanz mehr haben würde. Wenn es in Deutschland trotzdem noch einer eigenen Armee bedurfte, dann nur aufgrund geopolitisch bedingter moralischer Verpflichtungen – irgendjemand musste schließlich in Afghanistan die Brunnen bohren, während wir die Amerikaner dafür kritisierten, dass sie gegen die Taliban die Drecksarbeit für uns erledigten. Die Worte des bis heute letzten SPD-Verteidigungsministers Peter Struck, Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt, trafen damals nur auf Hohn und Spott.
Nur vor diesem Hintergrund wird das absurde Theater halbwegs erklärlich, das die Politik des Jahres 2017 bisher vor uns aufführt. Die SPD verliert soeben über die Frage der NATO ihren moralischen Kompass. Zugegeben: Es sind auch so bereits schwere Zeiten für das nordatlantische Bündnis. Russland versteht die NATO seit Jahren als Eingrenzung seines gottgegebenen Herrschaftsbereichs in Osteuropa, und im Weißen Haus sitzt ein Mann, für den es bereits ein großer Erfolg wäre, das Wort „NATO“ fehlerfrei am Stück zu buchstabieren. Sein Verteidigungsminister goss dafür am Mittwoch in Brüssel konsequent Wahlkampfversprechungen in harte politische Forderungen: Wer amerikanischen Schutz bekommen wolle, der solle auch seinen finanziellen Anteil leisten. Zwar ist diese Forderung für sich genommen absolut berechtigt – schließlich sollten NATO-Staaten zwei Prozent ihres BIP in Verteidigung investieren, und davon ist nicht nur Deutschland meilenweit entfernt. Allein, in der gegenwärtigen Lage Europas zwischen Putin und Trump bekommt Mattis‘ freundliche Erinnerung den Charakter einer kaum verhohlenen Drohung. Unionspolitiker wie Wolfgang Schäuble und Ursula von der Leyen signalisierten auch zügig Verhandlungsbereitschaft.
Westen? Welcher Westen?
Damit beginnt jetzt in der deutschen Politik das von Jan-Philipp Hein prophezeite große Geschacher um die NATO. Nicht nur die immer schamloser moskauhörige Linkspartei würde das Bündnis sowieso lieber heute als morgen beerdigt sehen. Auch die SPD, beflügelt vom Prozentpush ihres profillosen Ausmalkandidaten und prospektiven Gottkanzlers Martin Schulz, beherrscht genug Mathematik, um zu verstehen, dass Schulz nur dann Hausherr am Spreebogen werden kann, wenn auch Sahra Wagenknecht mit am Kabinettstisch sitzt. Vor diesem Hintergrund dürfte der armdicke Forderungskatalog der SPD-Parteilinken um Hilde Mattheis zu verstehen sein, der neben allerlei Steuererhöhungen „langfristig eine inklusive Sicherheitsarchitektur für ganz Europa an[strebt], die die Nato perspektivisch überflüssig macht“. (Frau Wagenknecht dürfte ganz blümerant geworden sein vor Verzückung angesichts solch plumper Anbiederung.) Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold, erklärte das Zwei-Prozent-Ziel nonchalant zur unverbindlichen, weil „abenteuerlichen“ Richtgröße, und auch Außenminister Gabriel, eigentlich als strikter Pragmatiker bekannt, verlor über eine Erhöhung der Rüstungsausgaben kein Wort und verwies stattdessen darauf, dass Deutschland unter anderem durch den Klimaschutz bereits viel zur Stabilisierung beitrage.
Nun ist Sigmar Gabriel natürlich nicht dumm genug, derart baren Unsinn wirklich zu glauben. Man muss darin und auch in den sonstigen Verlautbarungen der Partei vielmehr ausgedehnte Lockerungsübungen nach links sehen. Die SPD macht damit gerade aus der Not eine Tugend: Wer will schließlich noch Geld für ein Militärbündnis in die Hand nehmen, dessen Besicherung in Washington ohnehin mehr als fraglich ist und dessen Aufgabe dem #Schulzzug elegant den Weg ins Kanzleramt bahnt?
Die Einbindung in westliche Bündnissysteme, die mitzutragen die SPD in ihrem Godesberger Programm im gleichnamigen Bonner Stadtteil 1959 beschlossen und die der SPD-Kanzler Schmidt wiederum in Bonn gegen wütende Proteste verteidigt hatte, gerät nun vor dem G20-Gipfel in – richtig – Bonn wieder ins Wanken.
Rückzug nach links
Nicht nur geographisch schließt sich damit ein Kreis: Mit ihrer rückwirkenden Inkorporation der linksökologischen Friedensbewegung schließt die SPD damit auch die Vergrünung ab, die sie unter allmählicher Entsorgung alter sozialdemokratischer Haudegen wie Franz Müntefering mit Projekten wie EEG, der Energiewende und zuletzt Barbara Hendricks‘ Klimaschutzplan schon seit Längerem vorangetrieben hatte. Die Ablehnung der NATO und die offene Negierung jeder militärischen Option beenden den Zyklus, die SPD hat sich selbst – das berühmte „Fleisch von ihrem Fleische“ – eingeholt. Das war’s, die Sozialdemokratie ist zu Ende, wir können alle nach Hause gehen. Es gibt nichts zu sehen, zumindest nichts, was wir nicht schon von Linken und Grünen kennen würden.
Womit wir zum Eingangsstatement zurückkehren dürfen: Heute um die 30 zu sein, macht nur bedingt Spaß. Wir Mitglieder dieser Generation sind in einem freien, vereinten Deutschland aufgewachsen und weder auf Krieg noch auf politische Hybridautokratie im Stile Russlands wirklich vorbereitet. Wenn die Netze zusammenbrechen, nützen uns die Smartphones nichts, und bei den fünf Sprachen, die wir sprechen, ist Russisch nicht dabei. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Flughäfen und sauren Regen, er hat, leider, mit der Bewahrung unseres liberalen und demokratischen Staatswesens ein viel hehreres Ziel. Deswegen erlaube ich mir im Namen vieler den Wunsch zu formulieren, dass die SPD sich moralisch wieder fangen möge.
Von ihr hängt gerade die Zukunft Europas ab.