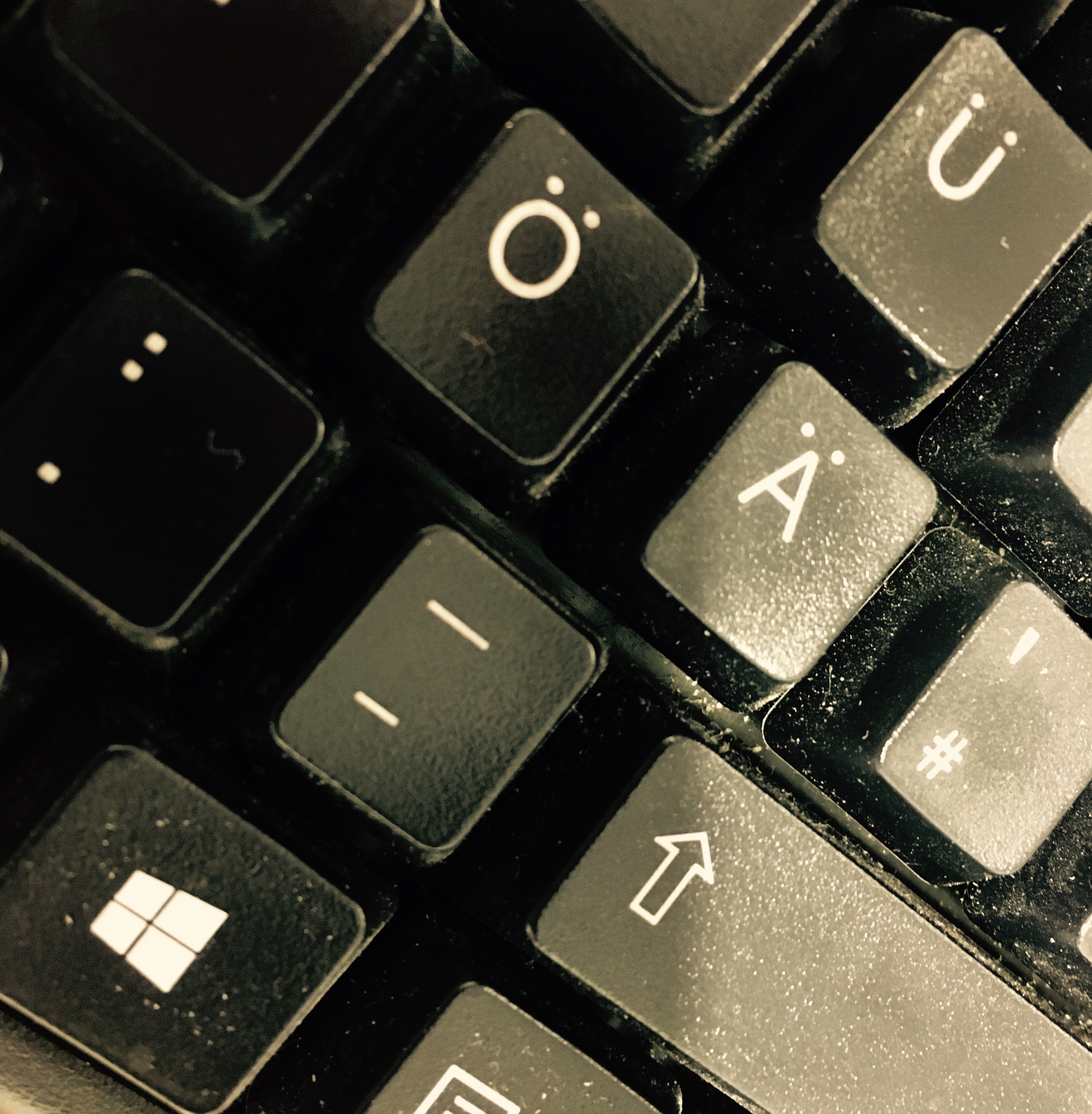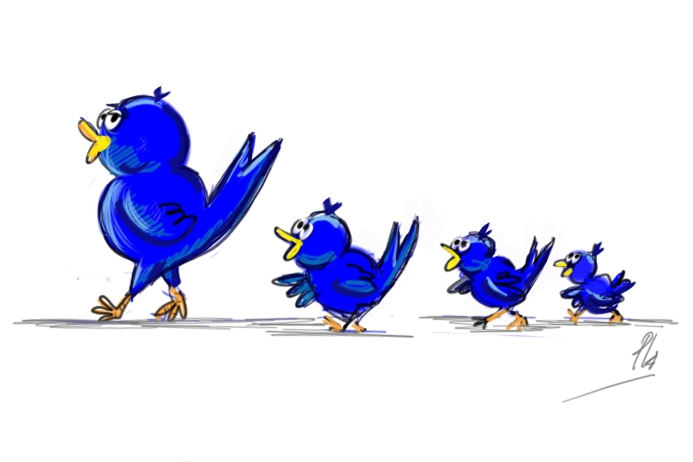Unsere Südstaaten
Die Südstaaten nehmen in den USA mit ihrer Illiberalität eine besondere Stellung ein. Unsere Südstaaten liegen im Osten. Wir müssen uns vielleicht daran gewöhnen.
Charlottesville – das ist der Ort im Süden der USA, an dem vor rund einem Jahr Neonazis aufmarschierten, um – wie es heute gemeinhin heißt – ein Zeichen zu setzen: „Die Straße gehört uns, wir wollen durch martialisches Auftreten Furcht einflößen, und wir sind viele.“ So viele waren es dann nicht, aber es reichte, um eine Gegendemonstrantin mit Absicht zu überfahren und zu töten. Der Schock über dieses Ereignis sitzt tief in den USA. Er reichte, gemischt mit Empörung, bis nach Deutschland, unter anderem weil sich der amtierende US-Präsident weigerte, das zu tun, was man von einem US-Präsidenten erwarten muss: den Nazi-Aufmarsch und den Mord an der Gegendemonstrantin wie sein Justizminister ohne Wenn und Aber zu verurteilen. So war das vor rund einem Jahr.
Heute haben wir hier in Deutschland Chemnitz. Wir sehen Nazis, die die Straße beherrschen, auch Bürger, die sich mit ihnen gemein machen, sehen Feuer und Menschenjagden, also Proben zu größeren Pogromen. Der Hass zeigt selbstbewusst seine Gesichter, der Hass auf Fremde, Andersdenkende, auf die Demokratie, den Rechtsstaat. Und der Innenminister unserer Republik, der sehr allgemein Law und Order gerne Geltung verschaffen würde – er schweigt bislang.
Doch denken wir einen Moment über den Osten nach: Was ist los mit ihm? Natürlich gibt es auch im Westen der Republik Nazis und andere Feinde der Demokratie. Aber nirgendwo sind die Zahlen rechtsextremistischer Straftaten so hoch (siehe hier die Übersicht bei: Statista). Und vor einer Woche konnte man sich noch empören über die Behandlung eines Fernsehteams auf einer Pegida-Demo in Dresden, das von der Polizei an der Arbeit gehindert wurde. In der Hauptstadt ist schon das mulmige Gefühl zu spüren, quasi wie das berühmte Gallier-Dorf umzingelt zu sein von Rückständigkeit, Anti-Intellektualismus und latenter wie offener Gewalt. Tatsächlich ähnelt unser Blick auf den Osten Deutschlands wie das der Ostküstenamerikaner auf die Südstaaten: „Das ist eine ganz schöne Landschaft da unten, aber letztlich leben da nur Rechte und Rassisten. Haben es die Wahl von Donald Trump und der Nazi-Aufmarsch in Charlottesville nicht bewiesen?“ Und auf Deutschland übertragen: „Haben die Werte der AfD und die Pegida-Aufmärsche und die Reichsbürger und die Nazis und die Anschläge und Gewalttaten gegen Asylsuchende nicht den wahren Charakter des Ostens gezeigt?“
Solche politisch-kulturellen Zuordnungen sind immer grob und nah am Klischee. Und wenn da trotzdem etwas dran ist: Sind die ostdeutschen Länder unsere Südstaaten? Sind „Ossis“ wie Maik G. unsere „Rednecks“? Liegt William Faulkners fiktives Yoknaatawpha County in Sachsen?
OPFER OST?
Schauen wir auf die Symbole: Wenn man die Pegida-Demonstrationen betrachtet, dann fällt einem immer wieder eine Flagge auf, die mit der Deutschland-Flagge nichts gemein hat – es ist die sogenannte Wirmer-Flagge, die aus der Widerstandsgruppe des 20. Juli stammt und nach dem erhofften gelungenen Attentat gegen Hitler die Reichsfahne ablösen sollte. Nun ist diese Wirmer-Flagge von der Reichsbürgerbewegung und Pegida annektiert worden und symbolisiert die Ablehnung der hoheitlichen Macht der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institutionen. Natürlich nur, bis man die Macht in Deutschland selbst übernommen hat. Diese Flagge ist damit Symbol eines Anspruchs wie auch pseudofreiheitliches Identitätszeichen einer Gruppe, die den Widerstand gegen Hitler missbraucht, um das heutige demokratische Deutschland und die Regierung von Angela Merkel in die Nähe der Nazi-Diktatur zu setzen. Dieses Vorgehen und das dahinterstehende Motiv ähnelt im Prinzip jenen Kräften in den Südstaaten, die die alte Konföderierten-Flagge aus der Zeit des Sklavenhandels, der nie aufgearbeitet wurde, und des amerikanischen Bürgerkriegs heute noch nutzen, um eine Südstaaten-Identität gegen das liberale Amerika in Stellung zu bringen. Es ist eine Trotzreaktion, die eine vor 150 Jahren erlittene militärische Niederlage in einen ideologischen Sieg ummünzen soll und die misslungene Sezession mittlerweile in einen kulturellen und politischen Erfolg umwandelte: Demokraten bringen in den Südstaaten kaum noch einen Fuß auf die Erde. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, und ähnliches schwebt der AfD in Ostdeutschland vor: die Schaffung einer regionalen, rückwärtsgewandten Identität, ein Beharren auf einem trüben Eigensinn voll Ressentiment und Hass. Hinzu kommt eine Selbstviktimisierung, die allerdings mit den Erfolgen, die Ostdeutschland, bei allen Rückschlägen, vorzuweisen hat, nicht in Einklang zu bringen ist. Sie wird zusätzlich genährt und zementiert von manch arrogantem Spott aus dem Westen und solch intellektuellen Kuriosa wie denen der Migrationsforscherin Naika Foroutan: Mit ihrem am Postkolonialismus geschärften Auge für Opfererkennung hat sie die Ostdeutschen als Migranten identifiziert, schließlich würden auch sie „Heimatverlust, vergangene Sehnsuchtsorte, Fremdheitsgefühle und Abwertungserfahrungen“ erleben.
Es würde vielleicht helfen, wenn man einfach nur akzeptierte, dass die Ostdeutschen eine sehr viel kürzere Erfahrung mit Demokratie, gesellschaftlicher Vielfalt und kulturellem Wandel haben. In einer sich beschleunigenden Welt hat man ihnen enorme Anpassungsleistungen abverlangt; und tatsächlich hatten sie nicht die gleichen sozio-ökonomischen Startbedingungen nach 1990 wie Westdeutsche, schließlich mussten sie Jahrzehnte in einer sozialistischen Diktatur leben, die eine Aufarbeitung des Faschismus ablehnte, weil durch den Sozialismus die Aufarbeitung quasi gelebt würde.
Die meisten Ostdeutschen erkennen aber auch, dass sie als Gegenleistung Freiheit und Wohlstand bekommen haben, dass sie der heimatliche Enge entfliehen konnten, Sehnsuchtsorte endlich besuchen und Abwertungserfahrungen auch in einem beliebigen ostdeutschen Restaurant erleben können – und dass heute viele westdeutsche Städte in der Attraktivität den ostdeutschen hinterherhinken. Das ist auch im amerikanischen Pendant ähnlich: Die beißende Armut findet sich in den alten Industriegebieten des Nordens; man vergleiche nur einmal Atlanta und Detroit, um sich die Entwicklungen deutlich zu machen. Sozioökonomisch ist die prekäre Identitätssuche mancher Ostdeutscher jedenfalls nicht zu begründen. Und wer ständig von ostdeutschen Opfern redet, wird es morgen mit Märtyrern zu tun haben, die gerächt werden sollen.
Was der Republik besondere Sorge bereiten müsste: dass rechtsstaatliche Standards bei der Exekutive gerade im Osten – aber nicht nur da – zu schwinden scheinen. Das Versagen und die gelegentliche Einäugigkeit gerade der Polizei wie auch der verantwortlichen Politiker wird in Zukunft einen Zugriff durch die Bundesebene notwendig werden lassen. Der Auf- bzw. Umbau der Bundespolizei zu einem deutschen FBI macht es schon deutlich. Denn es ist nicht ausgemacht, dass die innere Abkehr von den Grundlagen unserer Demokratie und die offene Feindseligkeit gegenüber Fremden und unseren rechtsstaatlichen Institutionen bzw. gewählten Repräsentanten im Osten nicht noch zunehmen wird. Diese Haltung hat sich – das lässt sich nach bald dreißig Jahren deutscher Einheit sagen –zumindest verhärtet. Die Republik hat sich verändert, sie wird sich verändern. Wir müssen realistisch sein.