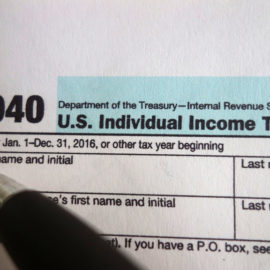Kreuzbandriss (1): Der Gau und was dann geschah
Was gibt es Schlimmeres für einen Sportler als sich zu verletzen? Genau, nichts! Egal, ob im Profisport oder als Hobby-Sportler – die Bewegung ist wie eine Droge, von der man sich nicht lossagen kann. Wie läuft also so ein kalter Entzug nach einer Verletzung ab? Hier kommt Deana Mrkajas Tagebuch des Kreuzbandrisses Teil 1.
Der Ball fliegt nach rechtsaußen. Ich hatte nicht damit gerechnet, ihn gestellt zu bekommen und bin mit meinem Anlauf viel zu spät dran. In der Rotationsphase unserer Aufstellung ist diese Position als Außenangreiferin für mich sowieso die verwirrendste – selbst nach 20 Jahren Volleyball. Ich sprinte also dem Ball hinterher, der schon an Flughöhe verliert, um ihn doch noch semi-gekonnt übers Netz zu bringen. Vor dem Absprung drehe ich mich bereits nach links, um Zeit zu sparen, springe ab und während ich in der Luft bin, merke ich, dass etwas in meinem Knie passiert ist. Ich „spür-höre“ etwas reißen, etwas kaputt gehen oder zumindest etwas, was sich nicht normal anfühlt. Es ist, als leitete mein Knie ein Geräusch an mein Gehirn weiter – vielleicht wäre es sogar für andere hörbar gewesen, wenn in der Halle kein Stimmengewirr zu hören wäre. Zumindest bilde ich mir das ein. Die Zeit in der Luft fühlt sich ewig an – so wie früher zu Zeiten von „Mila Superstar“, einer japanischen Zeichentrickserie über Volleyball, in der die Protagonistinnen zehn Saltos in der Luft machten, bevor sie auf den Ball schlugen. Eine Serie, die Mitte der Neunziger Jahre zu einem Boom im Volleyballsport führte, weil alle Mädchen so sein wollten wie Mila Ayuhara und Midori Hayakawa – auch ich. Während mein Bruder Super Mario auf dem Gameboy zockte, träumte ich von einem Länderspiel gegen die Russen als mein Endgegner.
Für etwas Ernstes sind die Schmerzen zu gering
Als ich lande, spüre ich einen starken Druck in meinem rechten Knie. War die Kniescheibe rein- und rausgesprungen? Die Bänder zu stark gedehnt? Ich trete langsam auf und ignoriere, was mit dem Ball passiert. Mein Trainer steht am Spielfeldrand und fragt: „Knie oder Fuß?“ „Knie.“ Ich trete erneut auf und beschließe weiterzuspielen. Zwei Schritte später rufe ich meinem Trainer zu: „Nimm mich raus!“ Glücklicherweise haben wir eine Physiotherapeutin in der Mannschaft, die sofort weiß, was zu tun ist. Ich setze mich an den Spielfeldrand, bekomme Eisspray gesprüht, das Bein hochgelagert und komme erst einmal runter. Als ich den Knieschoner ausziehe, sehe ich, dass das Knie bereits angeschwollen ist. Ich versuche aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen – schließlich will ich wieder aufs Feld. Doch bei jedem dritten Schritt rutscht mir die Kniescheibe weg, das Gelenk fühlt sich instabil an und ich beschließe, dass dieser Spieltag für mich gelaufen ist. Die nächsten Stunden ärgere ich mich in erster Linie über mich selbst, fluche und bin höchstgradig genervt – aber ich rechne felsenfest mit einer einfachen Überdehnung der Bänder.
Als ich an diesem Samstagabend nach Hause komme, lagere ich mein Bein hoch, kühle es, doch kann nicht verhindern, dass das Knie immer dicker und blauer wird. Ich telefoniere mit befreundeten Ärzten und wir beschließen per Ferndiagnose, dass es nichts Schlimmes ist. Nicht einmal als ich am nächsten Tag gar nicht mehr auftreten kann, glaube ich, es sei wirklich etwas passiert. Dazu waren die Schmerzen zu gering, bildete ich mir ein. Eine Mannschaftskollegin brachte mir dennoch ihre Krücken vorbei, damit ich mich wenigstens ein wenig bewegen kann. Ich konnte es kaum abwarten, am Montag endlich zum Arzt zu gehen, um mir bestätigen zu lassen, was ich sowieso glaubte: Kleine Überdehnung, zwei Wochen Pause, dann wieder loslegen.
Wenn der Arzt dich in den Arm nimmt und tröstet
„Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen (ja, der behandelnde Arzt duzt mich tatsächlich und ich frage mich immer noch, warum), aber du hast dir das Kreuzband gerissen.“ Ich schaue den Arzt an, der mir über das Knie streichelt (nein, kein #MeToo, sondern eher ein #IchFühleMitDir), ich spüre, wie sich Tränen in meinen Augen sammeln und wäre ich in diesem Moment Mila gewesen, dann wären diese Tränen wie Fontänen links und rechts aus meinen Augen geschossen und hätten unter mir eine riesige Pfütze gebildet. Der Arzt, nennen wir ihn Dr. Sportmediziner, nimmt mich tatsächlich in den Arm und sagt: „Ich würde an deiner Stelle auch weinen. Das ist echt beschissen. Lass es einfach raus!“ Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich teilweise emotional verkorkst bin und eher dann weine, wenn andere vollkommen kalt bleiben, wie beispielsweise, wenn ich einen Hund sehe und mir einbilde, er sei traurig, dann weine ich, aber selten, wenn es um mich geht. Aber jetzt weine ich. Ich weine, weil ich weiß, was so ein Kreuzbandriss bedeutet: Wochenlanges „Laufen“ auf Krücken, Schmerzen, Operation, Physio, Krankengymnastik, monatelanger Muskelaufbau, vor allem aber bedeutet es ein Sportverbot. Kein Volleyball, kein Boxen, kein Seelenheil. In diesem Moment denke ich nur an den Sport und nicht daran, inwieweit dieses Knie mein ganzes Leben verändern würde. Ich denke daran, dass ich nicht dieselbe bin, wenn ich kein Sport machen kann. Der Gedanke daran mich nicht bewegen zu können, macht mich nervös, fast schon panisch. Ich bin nicht ich, wenn mein Körper keinen Ausgleich bekommt. Ich besitze Energie für fünf Menschen und weiß gerade nicht, wie ich diese nun einsetzen soll, ohne anzufangen, Teller in der Wohnung zu zerschlagen oder meine Fahrräder umzuwerfen.
„Ich schreibe dich erst einmal sechs Wochen krank“, sagt Dr. Sportmediziner. Ich reiße meine Augen auf und sage: „Auf keinen Fall! Ich gehe morgen wieder arbeiten.“ Wir einigen uns am Ende auf zumindest drei Wochen und verabreden uns bald wiederzusehen, um noch einmal über meinen Ausfall zu reden.
Keine netten Sprüche mehr!
„Du wirst stärker zurückkommen, als du gegangen bist.“ Diesen Satz höre ich in den nächsten 24 Stunden gefühlt im Minutentakt. „Kobe Bryant hat sich die Achillessehne gerissen und kam wieder als Profi zurück“, „Sami Khedira hat nach einer Knieverletzung noch eine WM gespielt“ und „Felix Neureuther ist das jetzt auch passiert“. Ich höre nur Rhabarber und Gelaber, auch wenn ich weiß, dass all diese Vergleiche motivierend gemeint sind. Doch als ich mich an diesem Tag auf Krücken auf den Weg nach Hause mache, die Berliner U-Bahn mehrfach verfluche, auch laut, so dass es jeder hören kann, obwohl ich alleine bin, ich bereits nach wenigen Stufen Schweißausbrüche habe und realisiere, dass ich im vierten Stock wohne und mein Leben einfach hasse, will ich all diese netten Sprüche nicht hören. Ich will einfach nur Selbstmitleid empfinden, mein Knie hochlegen und es dabei beschimpfen. Die einzige Person, die sich fast ein wenig über meine Verletzung freut, ist meine Mutter: „Ich bin froh, dass du dich endlich mal ausruhst!“ Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

In den nächsten Tagen habe ich ununterbrochen Besuch. Blumen, Schokolade, manch einer kocht sogar für mich oder bringt Pizza mit. Ein Freund beschließt, die Party in meine Küche zu bringen, wenn ich nicht zur Party kommen kann und schleppt seine gesamte Anlage zu mir – selbst das Diskolicht packt er ein. „Die Nebelmaschine habe ich zu Hause gelassen, bringe sie aber das nächste Mal mit.“ Wir tanzen zusammen – er energisch, ich hüpfend auf einem Bein. Aber nur kurz, da es bereits nach wenigen Sekunden zu anstrengend wird. Nicht erst in den Tagen nach dieser nervigen Verletzung, doch besonders da, merke ich, dass gute Freunde und eine Schwester als Mitbewohnerin selbst über ein dickes Knie hinwegtrösten können. Wenn du plötzlich einen Rucksack in der Wohnung trägst, damit du dir in der Küche etwas zu essen darin einpacken kannst, um es zum Verspeisen mit ins Wohnzimmer zu tragen, wenn das Einsteigen in die Badewanne zum Duschen zu einer Herausforderung wird, das Überwinden von vier Stockwerken einen Aufwand von mindestens 20 Minuten und schweißnasse Hände bedeutet und die Lieferanten von Rewe Online deine neuen besten Freunde werden, dann bist du dankbar für all die lieben Menschen in deinem Leben, die einfach da sind. Für die ersten Tage nach einer solchen Verletzung empfehle ich somit starke Betäubungsmittel, ab und zu mal laut schreien und gute Freunde.
Im nächsten Beitrag: Ein neues Berlin-Gefühl und schleppende Genesung
[hr gap=“3″]
Sämtliche Beiträge aus Deana Mrkajas Tagebuch des Kreuzbandrisses finden Sie hier.