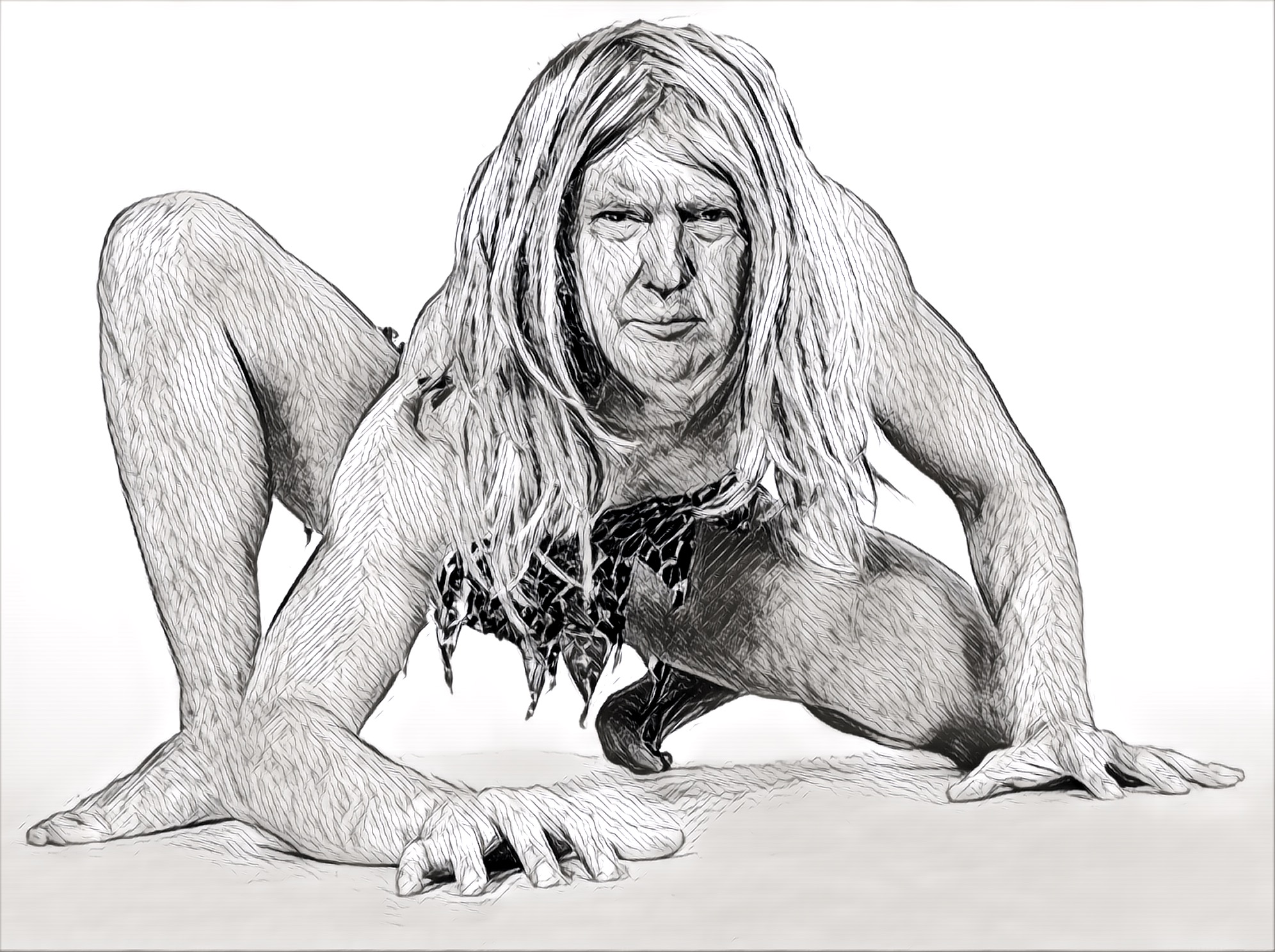Die Schwerarbeiter vom Verwaltungsgericht
Wie Don Quichotte gegen die Windmühlen kämpfen deutsche Richter gegen einen riesigen Asyl-Klageberg. 320.000 waren es zum Jahreswechsel, mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahr.
Kanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna F., wie wichtig es in Zukunft sei, dass Asylverfahren schneller abgeschlossen und abgelehnte Bewerber wie Täter Ali Bashar (20) auch abgeschoben werden.
Ein Tag, den wir im April am Berliner Verwaltungsgericht in Moabit verbrachten, zeigt, wie wahr das ist.
Frederic Kahrl (36) ist seit 8 Uhr da. Der Richter liest Akten. Denn an diesem Montag im April hat er fünf Fälle zu verhandeln. Fünf Fälle, bei denen er entscheiden muss, ob afghanische Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Seine Kammer mit drei Richtern wurde mit vier weiteren im vergangenen Jahr gegründet. Alle seit 2017 gegründeten Kammern befassen sich ausschließlich mit Asylverfahren, Kahrls Spezialgebiet: Afghanistan. Die deutschen Verwaltungsgerichte ächzen unter der Last der unerledigten Verfahren. 320.000 waren es zum Jahreswechsel, mehr als vier Mal so viel wie im Vorjahr. In Berlin sind Zurzeit rund 21.000 Fälle unerledigt, 63 Prozent davon Asylverfahren.
Der Grund: Eigentlich jeder Asylbewerber, dessen Antrag vom Bundesamt für Migration und Flucht (BaMF) abgelehnt wird und damit die Aufforderung bekommt, Deutschland innerhalb von 30 Tagen zu verlassen, klagt dagegen. Da es nach Einreichung der Klage bis zum Gerichtstermin oft über ein Jahr dauert, ist das für die nach Deutschland gekommenen Menschen wertvolle Zeit. Da Syrer in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, sind die meisten Kläger Afghanen, Iraner, Iraker oder aus afrikanischen Ländern.
Bei abertausenden unerledigten Fällen ist so ein Arbeitstag von Richter Kahrl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und er ist ein juristischer Schwerarbeiter. Es gibt auch Richter, die bei den schwierigen Verhandlungen zum Flüchtlingsstatus nur ein oder zwei Termine pro Woche ansetzen.
Das liegt nicht in Faulheit begründet: Da meist schriftliche Beweise fehlen, müssen Richter die Kläger sorgsam befragen, auf Nuancen achten, um letztendlich entscheiden zu können, ob sie ihren Fluchtgeschichten Glauben schenken. „Ich sehe die Person, um die es geht, in der Regel das erste Mal und das einzige Mal“, sagt Richter Kahrl.
Die Kläger hoffen darauf, dass sie entweder als Asylanten oder Flüchtlinge anerkannt werden – das bedeutet, dass sie von bestimmten Gruppen aus bestimmten Gründen in ihrer Heimat verfolgt werden. Dass sie „subsidiären Schutz“ bekommen – dabei fragt sich der Richter: Droht ihnen in der Heimat unmenschliche Behandlung? Könnten sie zivile Opfer von bewaffneten Konflikten werden?
Oder gibt es andere, humanitäre Gründe, sie nicht in die Heimat zurückzuschicken? Wäre davon auszugehen, dass sie in der Heimat kein Existenzminimum erwirtschaften können? Dann käme ein Abschiebeverbot in Betracht.
Wenn all das nicht zutrifft, weißt der Richter die Klage ab. Das Absurde an der Klagewut und ihrer scheinbar aussichtslosen Bewältigung: Sogar für den Fall, dass der Richter die Klage ablehnt, gibt es aktuell aus Berlin und Brandenburg keine Abschiebungen in Länder wie Afghanistan, den Iran und den Irak. Nur aus Bayern werden vereinzelt straffällig gewordene Asylbewerber abgeschoben. Heißt: Die Menschen bleiben in Deutschland und werden vom Staat durchgebracht.
Aus Richterkreisen heißt es dazu: „Das ist für viele von uns schwierig auszuhalten, dass Entscheidungen, für die wir grünes Licht geben, nicht umgesetzt werden.“
Für die Kläger ist die Entscheidung trotzdem sehr wichtig. Schließlich könnten sich rechtliche Verfahrensweisen und politische Gegebenheiten ändern.
Richter Kahrl trägt trotz sommerlichen Temperaturen an diesem Apriltag einen Anzug und darüber seine schwere Richterrobe, während Journalisten bei der öffentlichen Verhandlung im unklimatisierten Verhandlungsraum im T-Shirt sitzen.
Der hoffnungslose Fall
Um 9 Uhr kommt Shams B. (28) zu seiner Verhandlung, seit drei Jahren in Deutschland. Für ihn dolmetscht ein etwa 60-jähriger Iraner, Herr Ashkapour, der auch afghanische Dialekte spricht und den ganzen Tag bei Richter Kahrl schwer beschäftigt sein wird.
B., klein, drahtig, freundlich, ist ohne seine Anwältin erschienen. Anfang 2017 bekam er vom BaMF einen Bescheid, dass sein Asylantrag abgelehnt wurde. Dagegen klagt er.
Offenbar hatte er nicht wie fast alle anderen Kläger erfolgreich Prozesskostenhilfe vom deutschen Staat beantragt, so dass seine Anwältin den Termin sausen ließ.
Zunächst erklärt B., dass sein Pass vor einer Woche aus Afghanistan geschickt wurde und er eigentlich mit Vornamen Ezzatollah heiße. Auch sein Geburtsdatum sei ein Anderes.
Dann erzählt er, er habe in Afghanistan am Flughafen in Kunduz als Polizist und als Informant für „die Engländer“ gearbeitet. Deshalb drohe ihm ein gewaltsamer Tod durch die Taliban, wenn er in seine Heimat zurückkehre, er habe auch einen Drohbrief eines Taliban namens „Noghibollah“ erhalten, den er aber nicht zeigen kann.
Richter Kahrl hat vor sich eine Aufzeichnung der Befragung liegen, die das BaMF im November 2016 mit B. durchführte. Damals hatte B. von seinem angeblichen Polizistenjob nichts berichtet, merkt Kahrl an. Es ist also denkbar, dass er sich die Geschichte ausgedacht hat. Im Laufe der langwierigen Befragung stellt sich außerdem heraus, das B.s Familie in Kunduz noch ein Haus besitzt.
Da kein Anwalt da ist, hält B. sein Schlussplädoyer selbst: „Das ganze Leben hatte ich nur Sorgen. Man kommt aber nur einmal auf die Welt. Ich musste mein Schicksal in die Hand nehmen.“ Deshalb sei er nach Deutschland gekommen.
Nach mehr als zwei Stunden Verhandlung und abschließendem Diktat sagt Kahrl: „Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich nicht sehe, dass sie in Afghanistan verfolgt wurden oder werden. Was humanitäre Gründe betrifft: Ihre Familie hat dort noch ein Haus. In jedem Fall wünsche ich Ihnen persönlich alles Gute.“
Traurig verlässt B. das Gericht. Er wird in seine Unterkunft zurückkehren und in wenigen Tagen per Post vom Urteil erfahren. Manchmal entscheidet Kahrl noch am gleichen Tag, manchmal nimmt er sich einige Tage Zeit für seine Urteile.
Familie A. und der angebliche Kontaktabbruch zur Heimat
Nach einer kurzen Pause ist mit einstündiger Verspätung gegen 11.30 Uhr Familie A. an der Reihe. Da Vater Farzad (34) und Mutter Mohjad (24), seit drei Jahren in Deutschland, vor einem Jahr ihren Sohn Komeil bekamen, hat er neben dem gemeinsam verhandelten Fall seiner Eltern einen eigenen Fall: „Komeil A. gegen die Bundesrepublik Deutschland.“ Fälle zwei und drei für Richter Kahrl an diesem Tag.
Der Anwalt Christopher Lingnau (37), fast ausschließlich mit Asylfällen beschäftigt, vertritt alle drei. „Wenn es eine Verhandlung gibt, sollte ein Anwalt dabei sein“, sagt er. Da seine Mutter Iranerin ist, spricht er fließend Farsi und somit auch verwandte afghanische Dialekte.
Bei der Anfangsbefragung sagen die Eltern, dass sie Schiiten seien. Bei der Einreise nach Deutschland sagten sie noch, sie seien Sunniten. Ein möglicher Grund für diesen wundersamen Konfessionswechsel: Als Schiiten wären sie in Afghanistan von der sunnitischen Taliban bedroht.
Trotzdem beschränkt Anwalt Lingnau die Klage gleich zu Anfang der Verhandlung auf ein zu erreichendes Abschiebeverbot. Er glaube, dass die Familie aus zu erörternden Gründen in ihrer Heimatstaft Herat in Afghanistan nicht ihre Existenz sichern könnte.
Richter Kahrl befragt die Eltern getrennt, um besser einschätzen zu können, ob ihre Geschichten wahr sind. Zunächst erzählt Vater Farzad, er hätte in Afghanistan zwei Mal epileptische Anfälle gehabt. Eine Untersuchung in einem Spezial-Krankenhaus in Pakistan hätte ergeben, dass seine „Nervenadern im Kopf sehr schwach“ seien. Der Stress durch Krieg und Selbstmordattentate habe dann zu den Anfällen geführt.
Seiner Arbeit als selbstständiger Goldschmied habe er deshalb nicht mehr nachgehen können. Auch das sei ein Grund für die Flucht nach Deutschland gewesen.
Seine Eltern seien ebenfalls nach Deutschland geflohen. Die Eltern seiner Frau seien seit einem Jahr nicht zu erreichen, die Handynummer funktioniere nicht mehr. In Deutschland habe er seine Erkrankung nicht mehr behandelt, wegen Verständigungsproblemen. Sein Deutsch ist nach drei Jahren in Deutschland immer noch schlecht. Ärztliche Atteste hat er nicht.
Richter Kahrl schaut kritisch. Er ist freundlich, aber in der Sache hart. Der Grund: Viele Kläger berichten von schweren Krankheiten. Wohl auch in der Hoffnung, dass eine in Afghanistan schlecht zu behandelnde Krankheit zu einem Abschiebeverbot führen könnte.
Und viele Kläger berichten, dass alle Kontakte zur Familie in der Heimat abgebrochen seien. Die Hoffnung: Der Richter würde dadurch nach einer Rückkehr das Erreichen eines Existenzminimums anzweifeln. „Ich habe nichts, um dorthin zurückzukehren. Ich kann da nicht arbeiten, habe keine Ruhe, keine Möglichkeit das Leben meiner Familie zu finanzieren“, sagt Farzad A.
Als seine Frau alleine befragt wird, sagt sie, ihr Mann habe sieben, acht Mal epileptische Anfälle gehabt. Warum dieser Unterschied zu den Angaben des Mannes: „Einige Male haben wir ihm nicht davon erzählt, dass er einen Anfall hatte.“
Besonders hart befragt der Richter sie zum angeblich abgebrochenen Kontakt zu den Eltern. Mohgan A. besuchte in Herat zwölf Jahre die Schule. „Sie hatten Nachbarn, Freunde, Bekannte. Und Sie können in Herat niemanden erreichen?“ Er zitiert aus einer norwegischen Studie, für die zwölf auseinandergerissene afghanischen Familien auf der Flucht untersucht wurden. „Die haben alle Kontakt untereinander gehalten.“
Zum Schluss der Verhandlung, es ist schon 13.30 Uhr, der Richter schwitzt bei 22 Grad Außentemperatur in seiner schweren Robe, hält Anwalt Lingnau ein Schlussplädoyer: „Es geht hier um eine Familie mit einem Kleinkind, die in Afghanistan nicht überlebensfähig wäre.“ Sein „Kläger zu eins“ habe eine „erhebliche psychische Erkrankung“.
Richter Kahrl: „Es geht hier um die Frage der Gesamtglaubwürdigkeit. Darum, ob jemand, der schon lange in Afghanistan selbständig war, nicht in der Lage wäre, seine Familie zu ernähren. Aber das Kind wird auch in diese Waagschale gelegt.“ Er will sich einige Tage Zeit für sein Urteil nehmen.
Der Konvertit
Gegen 14 Uhr tritt Ebrahim A. (33) aus Afghanistan vor den Richter. Er, seit drei Jahren in Deutschland, ist bei Pfarrer Gottfried Martens (54) in der evangelischen Berlin-Steglitzer Dreieinigkeitskirche wie schon über 1000 Afghanen und Iraner zum Christentum konvertiert. Seinen Asylantrag vom März 2016 lehnte das BaMF ein Jahr später ab.
Richter Kahrl sagt: „Grundsätzlich ist die Kammer der Ansicht, dass bei einer glaubhaft gemachten Konversion internationaler Schutz gewährt wird.“ Das will er nun prüfen.
Ahmadi, ebenfalls vertreten durch Anwalt Lingnau, hat eine pfarramtliche Bescheinigung von Pfarrer Martens mitgebracht, der selbst nicht erscheinen konnte. Der Pfarrer weiß: Seine Schäfchen haben es schwer. Vor zwei Jahren wurden seine Konvertiten noch fast automatisch als Flüchtlinge anerkannt. Daraus wurde eine „Anerkennungsquote“ von etwa 50 Prozent.
„Jetzt sind es noch fünf bis zehn Prozent, die Asyl bekommen. Das ist eindeutig politisch gewollt“, sagte Martens schon im Februar dieses Jahres zu BILD.
Nun fühlt Richter Kahrl, offenbar bibelfest, dem Konvertiten auf den Zahn. Er will ausschließen, dass A. aus – wenn auch verständlichen – asyltaktischen Gründen konvertierte. A. hat sich vorbereitet. Er gehe jeden Sonntag und jeden Mittwoch zur Kirche, sagt er.
„Der Gott legte sich zur Jungfrau Maria, daraus ist Jesus Christus geboren“, sagt er.
Beim BaMF hatte A. angegeben, er hätte „den Geist Gottes“ gefunden. Was meinte er damit? „Wenn wir die Kirche betreten mit dem Geist Gottes, dann öffnet sich auch unser Geist.“
Der Richter befragt A. zur Lehre der Dreieinigkeit von Gott, Sohn und dem Heiligen Geist, um herauszufinden, wie weit sich seine Vorstellung von der Behandlung der Dreieinigkeit im Koran (Sure 4, Vers 171) unterscheidet.
Der Richter fragt, wo A. all das gelesen hat. „In den Büchern, die eckig sind.“ Was bedeutet es, für A. Christ zu sein? „Ich verlies die Dunkelheit und begab mich ins Licht.“ Die zehn Gebote, habe Jesus selbst gesagt, die stünden im Heiligen Buch. Stehen da nur Sachen, die Jesus selbst gesagt hat? „Ja“. Das Alte und das Neue Testament zusammen hätten 66 Bücher. Kann er sich an einen Namen dieser Bücher erinnern? „Nein, ich bin nicht geistesgegenwärtig.“
Nach etwa zwei Stunden Befragung wird offenbar, warum Richter Kahrl so skeptisch ist: Ebrahim A. war 2007 aus Afghanistan nach Schweden gezogen und von dort 2014 nach einem erfolglosen Asylverfahren in die Heimat abgeschoben worden. Während seiner ganzen Zeit in Schweden war er nur einmal in einer Kirche bei einem Besuch mit seinem Sprachkurs.
Nach einem Jahr in der Heimat kam er nach Deutschland und wurde auf einmal Christ. Er sagt, er würde nach einer Rückkehr nach Afghanistan seinen neuen Glauben nicht leugnen. „Jesus Christus hat gesagt, wer mich leugnet, den werde ich bei Gott leugnen“, erklärt A.
Zurück in der Heimat sei er mit einer Schere angegriffen worden, weil er schlecht über den Islam gesprochen habe. „Mohammed hat Menschen getötet, um den Islam zu schaffen“, sagt er.
Da A. nach seiner Rückkehr nach Afghanistan 15.000 Dollar für seine und die Flucht seiner Mutter aufbringen konnte, scheint es nicht so, als könne er sich dort nicht ernähren, das lässt der Richter in seiner Befragung durchscheinen.
In seinem Schlussplädoyer sagt Anwalt Lingnau: „In seiner pfarramtlichen Bescheinigung hat Dr. Martens deutlich gemacht, dass dem Kläger taktische Überlegungen fremd sind. Ich glaube, A. hat deutlich gemacht, warum er sich vom Islam abgewendet hat.“
Richter Kahrl: „Ich mache mir das nicht leicht. Es gibt ein paar Defizite, die eigentlich groß sind. Ich werde in ein paar Tagen entscheiden, ob ich die Konversion in verfestigter, identitätsprägender Form sehe. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute.“
Nach mehr als zwei Stunden Befragung dauert alleine die Aufnahme und Übersetzung des Diktats für die Akte rund 40 Minuten. In der kurzen Pause vor dem nächsten und letzten Fall an diesem Tag trinkt Kahrl einen Espresso und isst einen Proteinriegel. Er will an so einem Verhandlungs-Marathontag nicht zu viel essen, dann wird er müde und unaufmerksam, sagt er.
Vielleicht würde er auch gnädiger werden: Eine Studie aus Großbritannien ergab kürzlich, dass Richter nach einem Mittagessen durchschnittlich milder urteilen als vor dem Mittagessen.
Familie K. in der Heimat bedroht?
Gegen 17.30 Uhr, mit eineinhalb Stunden Verspätung, kommt wieder eine Kleinfamilie aus dem afghanischen Herat: Alireza (28) und Sahar K. (24) und Sahars Tochter aus erster Ehe, Khatereh (10). Auch ihr Asylantrag wurde durch das BaMF im Mai 2017 abgelehnt. Anwalt Angelo Petzold (58), der früher Polizist an der deutschen Botschaft in Teheran war und da seine iranische Ehefrau kennenlernte, will ihnen helfen.
Bei der getrennten Befragung erzählen die Eheleute wieder, dass sie Schiiten und nicht wie bei der Erstbefragung im Jahr 2015 angegeben Sunniten seien. Wieder erzählen sie von angeblichen Krankheiten und angeblich seit einem Jahr nicht mehr funktionierenden Handynummern von Familienmitgliedern in der Heimat. Und angeblich auf der Flucht abhanden gekommenen Ausweisen.
Aber eine Geschichte können sie in Teilen belegen. Nachdem Sahars erster Ehemann verstorben war, forderte seine Familie nach islamischem Recht, dass Tochter Khatereh im Alter von sieben Jahren zur Familie des Vaters kommen und der Mutter weggenommen werden sollte, da sie sich weigerte ein anderes Familienmitglied zu heiraten.
Nachdem Sahar von einem Frauenrat in Herat feststellen lies, dass dies nicht rechtens sei (das Dokument des Frauenrats legt sie vor), hätten die Brüder ihres verstorbenen Mannes sie und ihren neuen Ehemann Alireza bedroht, in einem Fall sogar überfallen.
Deshalb sei sie mit ihrem neuen Mann nach Deutschland geflohen. Und deshalb wäre eine Rückkehr in die Heimatstadt Herat gefährlich.
Im Schlussplädoyer sagt Anwalt Petzold: „Die Brüder des verstorbenen Ehemanns begehren das Kind. Es ist auch die Diskriminierung einer Frau, einem Vater würde das Kind nicht weggenommen werden.“ Er sagt, nach Herat könnten seine Mandanten nicht zurückkehren. Der Richter müsse entscheiden, inwieweit der Aufbau einer Existenz in einer anderen afghanischen Großstadt möglich wäre.
Petzold nimmt deshalb die Klage hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes zurück und beantragt Abschiebeschutz.
Richter Kahrl: „Einerseits haben wir eine vergleichsweise hohe Schutzwilligkeit des afghanischen Staats. Immerhin befasste sich der Frauenrat in Herat mit dem Fall. Andererseits könnte der Umzug in einen anderen Ort die Existenzsicherung erschweren. Ich werde ernsthaft darüber nachdenken.“
Wie Don Quichotte gegen Windmühlen
Um 19.30 Uhr ist Kahrls Arbeitstag fast vorbei. Mehr als zehn Stunden hat er fast ohne Pause durchverhandelt, wie Don Quichotte gegen die Windmühlen gegen den riesigen Klageberg gekämpft. Er wird jetzt noch etwas Post lesen und den Rest der Woche nutzen, um Urteile zu schreiben und Akten zu studieren. Immerhin haben die Urteile durchschnittlich 40 Seiten Text.
Die meisten seiner Kollegen haben schon Feierabend gemacht. Da für den ersten Fall, dem jungen, gesunden Afghanen B., bereits zu einem Urteil gekommen ist, verkündet er um 19.35 Uhr per Lautsprecher im fast leeren Gerichtgebäude: „In der Verwaltungsstreitsache Shams B. gegen die Bunderepublik Deutschland“ werde die Klage „im Namen des Volkes“ abgewiesen. „Der Träger trägt die Kosten des Verfahrens“.
Da Asylverfahren „gerichtskostenfrei“ sind, bedeutet das: Der Steuerzahler trägt die Kosten des Verfahrens genauso wie für die durch Prozesskostenhilfe bezahlten Anwälte.
Gegen Ende der Woche hat Richter Kahrl in allen Fällen Urteile gefunden. Auch die Klagen der ersten Kleinfamilie und des Konvertiten weist er ab. Er schenkte den Argumenten der Kläger und ihres Anwaltes nicht genügend Glauben. Nur im letzten Fall beschließt er ein Abschiebeverbot. Eine ganz normale Richter-Arbeitswoche an einem deutschen Verwaltungsgericht im Jahr 2018 ist vorbei.
Dieser Artikel erschien in gekürzter Form zuerst in „Bild“ und „B.Z.“