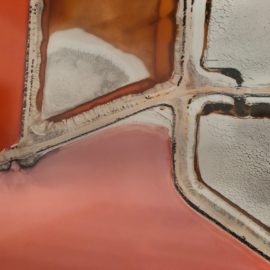Tschernobyl im Kino
Unsere Autorin war als technikhistorische Expertin bei der Presse-Premiere eines Seriendramas über den Reaktorunfall von 1986. Ein Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung einer Atomkatastrophe auf der Leinwand.
Man soll besser nie „nie“ sagen. Als ich vor einiger Zeit den Trailer der neuen „Chernobyl“-Serie auf Sky sah, habe ich abgewinkt und gesagt: „Das tu ich mir nicht an.“ Ich rege mich bei diesen Tschernobyl-Filmen nämlich immer nur auf: dieses Gebäude stimmt nicht und jene Armatur, diese Klamotte und jener Alltagsgegenstand, und die historischen Personen erst recht nicht.
Doch dann stöberte mich Sky im Kernkraftwerk Grohnde auf, wo ich gerade dabei war, als Strahlenschutz-Praktikantin Druckhalter-Armaturen und Dampferzeugerzu betreuen. Vorschlag: ob ich als Expertin beim Presse-Screening für den Tschernobyl-Film am 8. Mai im Münchner Arri-Kino sprechen wolle. Ich sagte Ja.
Tschernobyl erklären
Und so stieg das Event, mit allem Drum und Dran der Münchner Bussi-Bussi-Medienszene, Aperol und Häppchen, aber mit gastfreundlichen und offenen Menschen, die mir voller Wissbegierde Löcher in den Bauch fragten: Wie kommt eine Historikerin dazu, in Kernkraftwerken zu arbeiten? Nun, unter anderem deswegen, weil ich die Arbeit mit dem Atom besser verstehen will, über die ich forsche. Also nehme ich an ihr teil. Im Ergebnis kann ich nun auch anderen Menschen die Kernkraftwerke besser erklären, als es unsere größtenteils antinuklearen Trockenschwimmer tun.
Meine Aufgabe war gar nicht so einfach: einem technisch nicht vorgebildeten Publikum eine kurze Einleitung darüber zu geben, wie und warum es zu dem Unfall kam, und was meine persönliche Beziehung dazu ist. Letzteres war einfacher als ersteres, denn bei ersterem geht es um Reaktorphysik und fehlkonstruierte Steuerstäbe. Bei letzterem geht es um Tschernobyl als Teil unserer Familienerinnerung, denn mein ukrainischer Mann hat den Unfall als Neunzehnjähriger in Kiew erlebt. Ich war als Studentin 1991 einen Tag lang zu Gast im Block 3 des ukrainischen KKW, das damals noch lief – Wand an Wand mit der eingesargten Unfallstelle.
Das gemeinsame Anschauen der ersten beiden Folgen auf einem Kritiker-Preview-Link mit Mann und Söhnen brachte also auch jede Menge Déja-vu-Erlebnisse und persönliche Erinnerungen wieder nach oben. Kopfkino: Wie sich die Millionenstadt Kiew spontan selber evakuierte und die Befehle der Partei unterlief; die schlimmen Szenen am Bahnhof; wieviel Dosis mein Schwieger-Opa, pensionierter Ingenieur, mit einem alten Militärdosimeter an den Turnschuhen meines Mannes maß. Wie man den Frühlingsregen mied und wochenlang bei verschlossenen Fenstern lebte. Wie die Gerüchte umliefen, es stünde noch eine weit schlimmere Explosion bevor.
Großes Kino
Der Film ist atmosphärisch ungeheuer dicht und authentisch, was die Ausstattung angeht. Kostüme und Interieurs: top. Die Serie wurde teilweise im litauischen KKW Ignalina und in dessen Trainingszentrum gedreht. Dort stehen Reaktoren vom Tschernobyl-Typ, daher die wirklich original-nahen Treppenhäuser, Armaturenräume, Korridore und die Kraftwerkswarte. Tschernobyl 3 und 4 von 1986 wurden computergrafiktechnisch wieder zum Leben erweckt; sie sind heute unter einem futuristisch anmutenden Hangar namens „new safe confinement“ verborgen, in dem nun der Rückbau stattfindet.
Auch die Atomstadt Pripjat, offensichtlich in einem Kiewer Vorort gedreht, sieht sehr echt aus. Ich habe längere Zeit in solch einer Stadt, Pripjats Schwesterstadt Varaš, gelebt, in einem ukrainischen Kernkraftwerk gearbeitet, und wie die Filmhelden die weiße Kontrollbereichs-Kluft der osteuropäischen Atomarbeiter mit diesem typischen weißen Käppchen getragen (siehe Bild). Mir zitterte das Herz, sozusagen, so greifbar und nah war das alles.

In einer Szene tritt einer der Ingenieure, beauftragt, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, am frühen Morgen des 26. April hinaus aufs Dach des Kraftwerks. Auf der großen Leinwand im Arri-Kino erzeugt das den Eindruck, man stünde mit ihm da oben. In diesem Bild ist eigentlich alles enthalten: das Entsetzen und Nichtverstehen im Gesicht des winzigen Menschen auf den Trümmern der gigantischen Maschine, dahinter der Horizont einer arkadischen Wald- und Wasserlandschaft, in der dieser Unfall stattfand, und die dieser Unfall irreversibel zeichnen sollte, und über die die Kamera im Laufe der Serie immer wieder fährt: das ist großes Kino.
Legasovs Vermächtnis
Die auf den Physiker Valerij Legasov als stillen Helden konzentrierte Rahmenhandlung ist klug gewählt. Legasov, einer der Direktoren des Kurčatov-Kernforschungs-Instituts, war Mitglied der Regierungskommission, welche am Abend des Unfalltags im Kraftwerk eintraf. Er beging am Jahrestag der Katastrophe 1988 Suizid, weil er die Vertuschungspolitik und die eilige Präsentation falscher Schuldiger aus der Kraftwerks-Belegschaft nicht mehr mitttragen wollte. Erst nach seinem Tod, 1990, räumte eine neu einberufene Untersuchungskommission mit dieser Interpretation auf und bezifferte den Anteil eines mit Mängeln behafteten Reaktorkonzepts an dem Unfall.
Mit der Suizid-Szene beginnt der Film auch; er folgt eigentlich Legasovs Vermächtnis, denn er zeichnet das Erleben dieser tragischen Figuren nach, ohne sie zu denunzieren – mit ihren Fehleinschätzungen, ihrem anfänglichen Nicht-Wahrhaben-Wollen, ihren Ängsten, ihren Tränen und ihrem Opfermut. Wir werden nicht geschont und sehen auch, worüber damals nicht berichtet wurde: wie an akuter Strahlenkrankheit leidende Menschen aussehen. Die Zerstörung ihrer Haut, das ständige Erbrechen, die Halluzinationen und Schreie.
Legasov sah allerdings nicht, wie im Film, das havarierte KKW zum ersten Mal vom Hubschrauber aus, sondern kam wesentlich unspektakulärer im Auto an, und erinnerte sich später in einem Interview: „Und als wir so zwei Kilometer vom Kraftwerk waren, da dachte ich, ich komme da nicht in ein Atomkraftwerk. Denn das ist ja das Merkmal einer Atomanlage, dass da Schornsteine stehen, aus denen nichts herauskommt…Und da kommen wir in dieses Atomkraftwerk, und da war so ein himberroter Schein am Himmel, und da kam so ein weißer, weißer Rauch aus diesem Reaktor. Da dachte ich, das ist kein Atomkraftwerk.“
Bilder, die nicht stimmen
Tatsächlich war der „Rauch“ größtenteils ausdampfendes Kühlmittel, Speisewasser und Löschwasser, das aus der Ruine aufstieg. Das Unheimliche an diesem Unfall war ja gerade, dass nichts groß brannte oder qualmte im Block 4; anders als im Film dargestellt, rannten auch keine Schaulustigen noch in der Nacht mit Kind und Kegel los, um sich das Feuer anzusehen. Die Stadt Pripjat verschlief die Explosion. Doch die irrsinnigen Strahlenfelder machten den Unfallort zu etwas weit Entsetzlicherem als Feuer und Rauch es hätten machen können. Die Zeitzeugen, die in jenen Tagen am Block arbeiteten, erinnern sich an den stechenden Geruch, den die ionisierende Strahlung in der Luft erzeugte: sie sorgte für den Zusammenschluss von Sauerstoff-Atomen zu Ozon.
Kokolores ist daher der Kino-Pyro-Zauber und die fette schwarze Rauchfahne über Block 4 im Film, am meisten aber der nächtliche Flak-Scheinwerfer aus „Čerenkov-Strahlung“ direkt aus dem Reaktor. Da der Physiker Legasov im Film dem Funktionär Ščerbina, dem Leiter der Regierungskommission, erklärt, wie ein Kernreaktor funktioniert, hätte er den Regisseuren gleich auch auseinandersetzen können, dass Čerenkov-Strahlung nur in Wasser funktioniert.
Aber anders geht‘s wohl nicht im großen Kino, wenn man sagen will, dass es jetzt ganz dicke kommt. Es ist und bleibt eben Erzählung, Mythos, Ausstattungsfilm – aber ein gut gemachter.