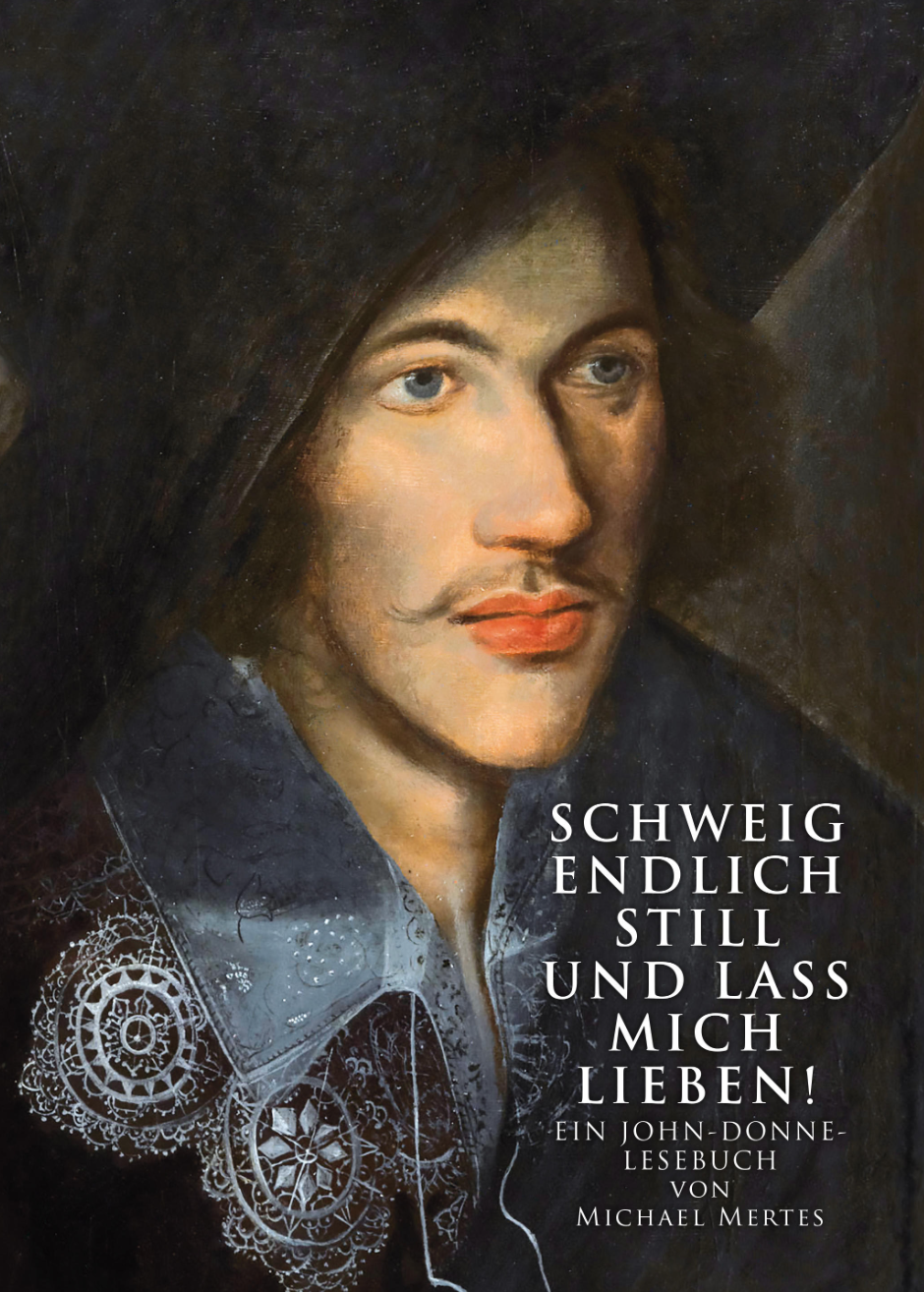Das Ende vom Anfang
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, und Afghanistan wird nach dem Rückzug der NATO wieder in die Hände der Taliban fallen. Das wird Konsequenzen weit über das Land hinaus haben.
Kaum etwas fürchtet der Westen mehr als gefährliche Bilder. Der Vietnamkrieg zum Beispiel hat dergleichen einige hervorgebracht. Und auch wenn sie nicht immer zeigten, was man in ihnen sah, so war doch eines unabweisbar deutlich und in seiner Aussage unwiderlegbar: wie ein Helikopter am 29. April 1975 vom Dach eines CIA-Gebäudes in Saigon Amerikaner und Vietnamesen ausflog und das Ende des Vietnamkriegs jedem klarmachte. Es war ein, ach was, es war das Bild der Niederlage und der Demütigung für die USA.
Solch ein symbolträchtiges Bild wollte man diesmal, beim Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, unter allen Umständen vermeiden. Vermutlich unter anderem deshalb verließen die US-Truppen des Nachts und ohne klare Ankündigung den zentralen Stützpunkt Bagram, die afghanischen Partner sind verdutzt, die der NATO schon zuhause. So auch die Deutschen, die nur von ihren Familien begrüßt wurden, als kämen sie von den olympischen Sommerspielen. Alles ganz inoffiziell, man will kein großes Tamtam, schließlich war man nur zwanzig Jahre im Einsatz, also soviel wie Trojanischer Krieg und die Heimkehr des Odysseus zusammengerechnet.
Aber die Stille, die nun weitgehend herrscht über diesen Einsatz hat etwas Verdruckstes und vor allem – Trügerisches. Denn von einem Scheitern müsste man sprechen – nur wer will das schon? In Deutschland vor einer Bundestagswahl ohnehin niemand aus der Politik. Denn wenn man genau hinguckt, dann gibt es nur Unangenehmes zu besprechen: Der Rückzug aus Afghanistan ist kein Scheitern, weil die letzten zwei Jahrzehnte sinnlos gewesen wären, sondern durch den jetzigen Rückzug sinnlos werden.
Falsche Erwartungen
Als der Verteidigungsminister der rot-grünen Koalition, Peter Struck, im Jahr 2002 die neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien mit dem Satz skizzierte „Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“ erntete er viel Spott. Eigentlich wollte Struck nur der neuen Gefahrenlage Rechnung tragen und die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands sichern sowie „einen Beitrag zur Stabilität im europäischen und globalen Rahmen leisten“. Ein normaler Vorgang angesichts der Anschläge vom 11. September und der fortgesetzten Bedrohung durch den Islamismus bzw. weltumspannenden Dschihadismus. Doch die Phantasie großer Teile der medialen Öffentlichkeit reichte nicht über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, und jedwede Unterstützung für einen Krieg der Bush-Regierung war unpopulär, selbst wenn es sich um einen gemeinsamen NATO-Einsatz handelte. Noch etwas kam hinzu: Die Daseinsberechtigung der Bundeswehr hatte im pazifistisch veranlagten Deutschland nach dem Fall der Mauer noch weiter gelitten. Sparen war angesagt, Panzer konnten eingemottet und verscherbelt werden. Und dann kam Struck und sprach vom Hindukusch. Was sogleich Assoziationen vom „Great Game“ und den britischen Strafexpeditionen in den Anglo-Afghanischen Kriegen im 19. Jahrhundert heraufbeschwor – sprich: Man sah überdeutlich das Ungeheuer eines Neokolonialismus sein Haupt erheben. Strucks neue Sicherheitsdoktrin brauchte also eine philanthropische Aufhübschung, um auch das Murren in der eigenen Koalition runterzuregeln. Fortan sollte gelten: „Deutsche Sicherheitspolitik ist umfassend angelegt und berücksichtigt politische, ökonomische, ökologische, gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen und Entwicklungen. Sicherheit kann weder vorrangig noch allein durch militärische Maßnahmen gewährleistet werden. Präventive Sicherheitspolitik umfasst politische und diplomatische Initiativen sowie den Einsatz wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer, rechtsstaatlicher, humanitärer und sozialer Maßnahmen.“
Das klingt gut, ist auch per se keine schlechte Idee – es hieß aber für den Einsatz in Afghanistan, dass das Land nicht nur befriedet und von Al Qaida und Taliban befreit werden sollte, damit von ihm keine Gefahr mehr für die Nachbarstaaten und den Westen ausgehen möge, sondern dass es einen großen Sprung ins 21. Jahrhundert zu vollziehen habe: Demokratie, Zivilgesellschaft, Gender Mainstreaming – das volle Programm. So ging man dann auch mit Truppen ans Werk und NGOs im Schlepptau. Das Problem: Genau das haben bestimmte Kräfte als Missachtung von Traditionen und Verletzung der Souveränität, also als Neokolonialismus verstanden, den es zu hintertreiben bzw. zu bekämpfen galt. Der Vorteil: Das westliche Engagement hat einer ganzen Generation (vor allem Frauen und Mädchen) wenigstens in einigen Regionen Afghanistans Bildung und ein halbwegs selbstbestimmtes, sicheres Leben ermöglicht. Die Realität: Man kann in eine Stammesgesellschaft keine liberale Gesellschaft per Schnellkursus einführen, auch ein nachhaltiges State Building ist in einem solchen Zeitraum nicht möglich. Da sind zwanzig Jahre nichts. Was Militär vermag, das ist Sicherheit herzustellen. Aber im Umfeld Afghanistans mussten die NATO-Truppen darauf bedacht sein, zunächst ihre eigene Sicherheit zu gewähren und afghanische Sicherheitskräfte in der Hoffnung auszubilden, dass sie das Land in Zukunft selbst stabilisieren, d.h. befrieden könnten. So waren die tatsächlichen Interessen – und Möglichkeiten – Deutschlands von vorneherein überspannt durch einen humanitären Auftrag, für den weder der Rückhalt, die Mittel noch die Zeit zur Verfügung standen (und wenn es darum geht, die afghanischen Helfer nach Deutschland zu holen, ist alle Humanität sowieso vergessen). Also agierte die deutsche Truppe – doch nicht nur sie, sondern auch die USA – im diffusen Licht eines „Clash of Doctrines“: zumindest in ihrem Sprengel der Verantwortlichkeit Ordnungsmacht zu sein und ziviler Aufbauhelfer für Menschenrechte und Demokratie. Gleichzeitig schwand das Interesse in der Heimat, da die meisten NGOs wegen des sinkenden Enthusiasmus’ und der gestiegenen Gefahrenlage das Land wieder verlassen hatten und die Regierung gar nicht interessiert war, sonderlich viele Worte zu dieser Entwicklung und dem Einsatz zu verlieren.
Falscher Zeitpunkt
Der amtierende amerikanische Präsident Joe Biden hat dann die Sache für sich und die USA vereinfacht. Er begründet das Ende des Einsatzes mit dem Erreichen der amerikanischen Ziele: Osama bin Laden „an die Pforte der Hölle zu bringen“ (man könnte auch weniger bibelbildlich sagen: zu töten) und Al Qaida die Fähigkeit zu nehmen, die USA anzugreifen. Allerdings sind diese beiden Ziele schon lange erfüllt: Bin Laden starb bereits vor zehn Jahren im Kugelhagel einer US-Spezialeinheit, und Al Qaida hat sich im gleichen Zeitraum auf andere Weltregionen wie z.B. Afrika konzentriert und durch den Aufstieg anderer populärer Terrororganisationen wie den IS gleichzeitig an Schlagkraft verloren. Da ist Bidens zusätzliche Begründung für den Abzug, er wolle nicht eine weitere Generation in den Krieg nach Afghanistan schicken, auf den ersten Blick nachvollziehbarer. Beim zweiten Blick kommt man aber um die Erkenntnis nicht herum, dass der Zeitpunkt des Rückzugs für die von Biden genannten Ziele Jahre zu spät kommt, Mittel und Menschenleben somit sinnlos verschwendet wurden. Schauen wir aber auf die mutmaßlichen Folgen des Rückzugs, dann kommt er zu früh. Und das könnte erst recht fatal sein.
Falsche Einschätzung
Biden hat die Hoffnung geäußert, die afghanischen Streitkräfte könnten nun, nach zwanzig Jahren Training durch die NATO, selbst in der Lage sein, das Land gegen die Taliban zu verteidigen. Das kann nicht mehr als eine Schutzhoffnung gewesen sein angesichts der Tatsache, dass die Taliban täglich neue Landgewinne erzielen, einen höheren Grad an Disziplin und Entschlossenheit besitzen und ihre Gegner im gleichen, nur umgekehrten Maße Unentschlossenheit, einen Mangel an Disziplin und wachsende Verzweiflung, da Verhandlungen, die die Taliban mit Absicht und Raffinesse in die Länge gezogen haben, nur noch auf eine Kapitulation der gewählten Regierung hinauslaufen können.
Schon jetzt versichern die Islamisten, sie würden die Integrität der Nachbarländer anerkennen – was soviel wie das Gegenteil bedeutet. Ein Sieg wird den Taliban erst recht Auftrieb geben – mehr als sie durch ihre vielen Koranschulen an Glaube und Eifer für die große Sache jemals produzieren konnten. Das gilt auch für die militanten islamistischen Bewegungen in den Nachbarländern und selbst in fernen Weltgegenden. Den globalen Dschihadismus wird es wie eine Blutzufuhr erfrischen.
Ob ein afghanischer Gottesstaat nur sich selbst genügt und – direkt oder indirekt – keinen Missionseifer entwickeln wird, darf angesichts der Erfahrungen mit dem Iran bezweifelt werden. Aber zunächst einmal wird der Exodus an Afghanen die Nachbarländer beschäftigen – wer will es jedem einzelnen Flüchtling verdenken, dass er nur noch das Weite suchen will? –, danach auch die EU. Man darf gespannt sein, wie besorgt sie sich geben wird, wie unfähig eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Derweil wird der alte Terror wieder vermehrt seinen Blutzoll fordern: in den afrikanischen Metropolen, den asiatischen, den europäischen, den amerikanischen. Der Westen wird sich dabei mit besonderen Schuldzuweisungen schmücken – er wird sich wie immer selbst die Schuld geben: seinem Kolonialismus, Imperialismus, Kapitalismus etc. pp. Seine Blindheit, seine Ignoranz werden nicht darunter sein. Natürlich kommt das alles überraschend. Man ist mit anderem mehr beschäftigt. Aber der Dschihadismus kümmert sich nicht um den Klimawandel, Corona oder eine neue Modemarke aus dem Hause Kardashian. Er macht einfach weiter. Können wir nicht doch einmal, wenigstens etwas, darauf vorbereitet sein?