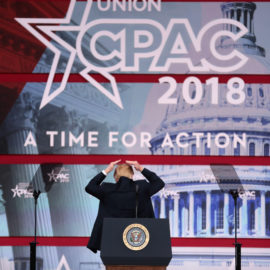Tagebuch eines Digitalnomaden (3): Redundanz, Redundanz, Redundanz!
Ich lernte vor zehn bis zwanzig Jahren, dass es unbedingt empfehlenswert ist, möglichst leicht zu reisen, aber diese Regel eine Ausnahme kennt: Die Brieftasche. In meiner finden sich: Eine Amex, eine Visa und Mastercard von Barclays, eine Amazon-Visa der LBB und eine EC-Karte der Volksbank. Der Grund hierfür (und für mein Interesse am Nahen Osten) ist der Libanon.
[Zurück zu Teil 2] Und das kommt so: Mit Neunzehn verbrachte ich mit einer Gruppe von Freunden eine Woche im türkischen Bodrum. Auch damals war der Ort schon sehr ballermannesc, aber mit dramatisch besserer Partymusik. Es ergab sich, dass mich eine bildhübsche Libanesin ansprach – ich wäre viel zu schüchtern gewesen – und daraus ergab sich eine Urlaubsromanze. Ich wusste über den Libanon nur, dass dort ewig Bürgerkrieg herrschte und sich die teilnehmenden Gruppen unter anderem durch Geiselnahmen finanzierten, was das Land nicht ganz oben auf der Liste meiner Wunschreiseziele platzierte. Das sollte sich bald ändern, doch zunächst wollten wir uns ein paar Monate später in London wiedersehen. Sie hatte dort geschäftlich zu tun und damals flog die Crossair von Basel aus London City an, dank des an Bord großzügig ausgeschenkten Champagners war der eigentliche Flug rein rechnerisch gratis. Ich stellte vor Abflug sicher, dass ich genügend Geld auf dem Konto habe und nach zwei Tagen in London fest, dass ich nicht dran komme. Weil meine EC-Karte ein Wochenlimit hatte, von dem ich nichts wusste.
Ich schilderte meine Situation dem gar nicht genug zu lobpreisenden Rezeptionisten des Cheshire Hotels, der mir, statt mich wegen erwiesener Zahlungsunfähigkeit rauszuwerfen, für den Abend hundert Pfund aus der Hotelkasse lieh: „Well, I guess we have your luggage as collateral.“
Am nächsten Tag ließ ich mir von meinem WG-Mitbewohner per Western Union Bargeld in eine benachbarte Apotheke kabeln und sofort nach Rückkehr nach Deutschland beantragte ich zwei Kreditkarten bei meiner Hausbank.
„That’s not our Air Force, that’s the Israeli Air Force“
Zehn Jahre und etliche Nahostreisen später musste ich von Tel Aviv aus nach Beirut. Direkt fliegt diese Route nur die Israelische Luftwaffe regelmäßig. Einfach um zu zeigen, dass sie es kann, denn beide Länder sind schließlich formell noch im Kriegszustand. (Ich bin in Beirut mal vor Schreck fast in den Pool auf dem Dach des Hotels Palm Beach gefallen, weil eine F15 ziemlich tief fliegend die Schallmauer durchbrochen hatte. Ich fragte den Kellner, ob denn die libanesische Luftwaffe völlig irre sei, worauf er lachend antwortete: „That’s not our Air Force, that’s the Israeli Air Force.“ Und dann zehn Minuten später auf einen altersschwachen Helikopter zeigte, der die Corniche in entgegengesetzter Richtung abflog in einem unbeholfenen Versuch, Präsenz zu zeigen: „That’s our Air Force. All of it.“ Was nur geringfügig untertrieben war.)
Zivilisten fliegen über Amman, was eine interessante Erfahrung war. Man darf in den Libanon nicht mit israelischem Visum im Pass einreisen, weshalb ich meinen Pass für zivilisierte Länder mit den US- und israelischen Visa schön weit unten im Handgepäck platzierte und den für Arschlochländer griffbereit hielt. Royal Jordanian entfernte beim Durchchecken des Aufgabegepäcks in Amman sämtliche Aufkleber, die die israelischen Sicherheitsmitarbeiter großzügig darauf verteilt hatten und ersetzte sogar meinen El-Al-Gepäckanhänger durch einen eigenen, auf den irgendein fleißiger Mitarbeiter von Hand meinen Namen und Telefonnummer abschrieb. Von solchen Servicestandards war der damalige Flughafen in Amman allerdings weit entfernt. Über ihn braucht man nur zu wissen, dass es im gesamten Gebäude eine einzige abschließbare Herrentoilette gab. (Inzwischen gibt es ein neues Terminal, das weit zivilisierter ist als das der Hauptstadt der DDR.) Der mit Abstand erträglichste Ort im Flughafen war der von Aldeasa betriebene Duty Free Shop, wo ich ein wunderschönes Paar Lederhandschuhe von Boss für nur 40 USD schoss, das ich bis heute gerne trage. Vor dem Boarding war noch eine weitere Handgepäckkontrolle nötig, derentwegen mir der zweite Reisepass Sorgen bereitete. Ich hatte allerdings vergessen, dass ich ein Bündel Schekelscheine ziemlich schlecht versteckt in der Aussentasche meines Rucksacks aufbewahrte. Als der Sicherheitsbeamte dieses Geld innerhalb weniger Sekunden fand, brach er die Kontrolle umgehend ab. Lächelte, gab mir meinen Rucksack zurück und wünschte mir einen guten Flug. Immer schön, wenn man zufällig an den Mossad gerät!
Der Rafic-Hariri-Flughafen in Beirut ist super. Die Renovierung wurde in den Neunzigern in Auftrag gegeben, als Rafic Hariri Ministerpräsident und Bauunternehmer war, und der Flughafen nach ihm benannt, nachdem er 2005 ziemlich genau vor meinem Stammhotel zusammen mit 22 weiteren Opfern mit einer Sprengladung von einer Tonne TNT ermordet wurde. (Der deutsche UN-Sonderermittler Detlev Mehlis bescheinigte später syrischen und libanesischen Geheimdienstkreisen die Verantwortung.) Merke: Wenn eine bis ins Mark korrupte, eben dem Bürgerkrieg entsprungene Kleptokratie, deren Regierungschef Teilhaber an einer halbstaatlichen Baugesellschaft mit Enteignungsrechten ist, einen Flughafen bauen will, dann landen vermutlich mindestens 50% des Budgets in schwarzen Kassen. Aber: Anschließend steht da ein Flughafen, fertiggestellt innerhalb der avisierten Frist und im verabschiedeten Budget. Ich will Korruption nicht kleinreden, wenn ich darauf hinweise, dass Korruption nicht das Hauptproblem am BER ist, und dass Beirut und Amman 2018 dramatisch bessere Flughäfen haben als die Hauptstadt der führenden Industrienation Europas.
Ayatollah Adolf
Leider ist der Flughafen an Beirut auf exakt dieselbe Weise angebunden wie Tegel an Berlin: Busse, die irgendwann oder gar nicht kommen sind die einzige Alternative zu stinkenden, uralten aber unkaputtbaren Gammeltaxen von Mercedes, deren ungeduschte arabische Chauffeure einen gerne mal mit „Heil Hitler“ begrüßen, um dann zu erklären, dass dessen Holocaust ein prima Versuch einer Problemlösung war, aber ja auch nie stattgefunden hätte, sondern eine Propagandalüge der allmächtigen Juden sei. Auf den Widerspruch angesprochen, wurde mir erklärt, dass eine der beiden Versionen ja wohl sicher stimmen würde. Ich öffnete das Fenster, da Lärm und Smog der Metropole Äußerungen und Körpergeruch meines Fahrers eindeutig vorzuziehen waren.
Ayatollah Adolf entließ mich am Radisson Blue aus seiner Gaskammer made in Sindelfingen und die Magie globaler Hotelketten entfaltete sofort ihre Wirkung: Egal, wie gnadenlos hässlich, hoffnungslos und brutal die Umgebung ist, egal, ob Gelsenkirchen, Beirut oder Halle – kaum betritt man ein Radisson, Hilton oder Mercure, ist man zurück in der Zivilisation. Mein Gepäck würde schonmal aufs Zimmer gebracht, ich hätte Glück und ein Upgrade auf eine Junior Suite, ich möge doch erstmal einen Drink aufs Haus an der Bar genießen, bis die Rezeption die Reisegruppe abgearbeitet hat und sich um meinen Checkin kümmern kann – fein, läuft!
Bis es nicht mehr lief. Die VISA der Deutschen Bank, mit der ich vorhin noch die Handschuhe in Amman bezahlt hatte, verweigerte die Zahlung der Zimmerrechnung. Die Mastercard der DB, die ich seit Wochen nicht verwendet hatte, ebenfalls. Obwohl beide Limits weit davon entfernt waren, ausgeschöpft zu sein. Ich fragte nach einem Geldautomaten und versuchte dort trotz Haben auf dem Girokonto mein Glück erfolglos. Wenn ich nicht zu zahlen in der Lage wäre, würde Radisson sich nicht an die Reservierung gebunden sehen, ich müsse gegebenenfalls eine andere Bleibe suchen. Von meinen libanesischen Freunden war an diesem Samstag niemand in der Stadt. Es würde nicht ganz einfach sein, ein Hostel zu finden, das Barzahlung akzeptiert. Ich hatte ja das Äquivalent zu etwa zweihundert Euro dabei. Nur sind israelische Schekel kein populäres Zahlungsmittel im Libanon und in Euro hatte ich ein paar Münzen übrig. Ich erklärte, dass es sich um einen Bankirrtum handeln müsse und bat den Rezeptionisten, mit mir zu einem PC im Business Center zu kommen, wo ich ihm per Online-Banking zeigte, dass alle Zahlen grün gefärbt waren. (Viel mehr dürfte er mangels Deutschkenntnissen nicht verstanden haben.)
Damit durfte ich auf mein Zimmer und das Hoteltelefon für ein klärendes Telefonat mit der Bank verwenden. Für nur 1,75 USD pro Minute. Schon nach 50 Minuten in der Warteschleife der Kreditkartenhotline der Deutschen Bank hatte ich eine freundliche Kundenbetreuerin an der Strippe: „Wir sind am Wochenende nur zu zweit.“ Auf meine Frage, wieso ich denn trotz Guthaben unmittelbar von der Obdachlosigkeit in Beirut bedroht sei, erhielt ich die originelle Antwort: „Zu Ihrer eigenen Sicherheit haben wir Ihre Karten gesperrt.“ „In wieweit dient es meiner Sicherheit, ein Wochenende nachts auf den Straßen Beiruts zu verbringen?“ „Wir haben hier ein hochverdächtiges Muster analysiert: Heute vormittag wurden auf der Visa 190 Euro in Tel Aviv belastet?“ „Ja, mein Hotel.“ „Genau. Aber dann nur wenige Stunden später 40 USD in Amman! Da hat unser System erkannt, dass vermutlich jemand eine Kopie der Kartendaten angefertigt hat, um damit illegal Geld abzuziehen.“ „Nö. Ich habe mir im Duty Free Handschuhe gekauft. Wieso haben Sie denn die Mastercard und die EC-Karte gleich mitgesperrt?“ „Zu Ihrer Sicherheit.“ „Aber die kann man doch gar nicht kopieren, wenn man nur die VISA vorliegen hat.“ „Es hätte ja auch Ihr ganzes Portemonnaie gestohlen oder verloren worden sein können.“ „Wären Sie so nett, mal kurz in meinen Kundendatensatz zu gucken?“ „Selbstverständlich.“ „Haben Sie da die 0171 XX XX XXX als Handynummer?“ „Ja, die liegt vor.“ „Wäre es nicht zielführender, Sie würden einfach mal anrufen und sich nach der verdächtigen Buchung erkundigen, als mir alle Karten dicht zu machen?“ „Das ist nicht vorgesehen, aber ich nehme die Anregung gerne auf.“ Da die Karten nicht vor dem folgenden Montag entsperrbar waren, ließ ich dem Hotel eine Bestätigung hierzu faxen (ja, das waren noch Zeiten) und verbrachte den Sonntag mit einem Budget von siebeneinhalb Euro. Immerhin hat die Bank mir die Telefonrechnung des Hotels ohne Diskussion gutgeschrieben.
Gelernt: Man kann gar nicht so reich sein, dass man auf Reisen nicht doch pleite ist, wenn man nicht genügend Kreditkarten hat.
Gelernt zweitens: Der nächste Engel arbeitet nicht zwingend in einem Krankenhaus, sondern ist oft unter der Nummer 9 vom Hotelzimmer aus telefonisch erreichbar.
Gelernt drittens: Man kann gar nicht so arm sein, dass man auf Reisen nicht trotzdem flüssig ist, wenn man fünf verschiedenen Kredit- und Debitkarten von vier verschiedenen Anbietern mit sich führt und außerdem nie weniger als 50 Euro Barreserve in unverdächtiger Währung.
Im nächsten Beitrag: Nahverkehrshindernisse.
Wie lebt es sich als digitaler Nomade, unterwegs nur mit Freundin, Hund „Rania“ und Auto „Susi“? Im Tagebuch eines Digitalnomaden erzählt David Harnasch von den Vorteilen dieses Lebensstils – und von den teils extrem kostspieligen Fehlern, die ihm bereits unterlaufen sind.