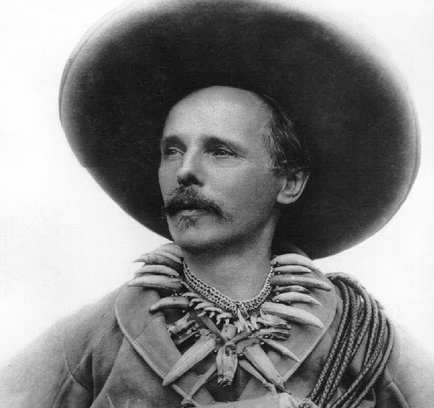Endziel Regime Change
Das vergangene Jahrzehnt hat gezeigt, dass Multilateralismus und Dialog in ihrer bisherigen Form keine Probleme lösen. Der Westen muss zu einer robusten und wertegebundenen Außenpolitik zurückfinden. Doch davon ist leider nichts zu sehen.
Manchmal, in einem irren Moment und wenn der Herbst eine melancholische Stimmung befördert, kann man sich zurücklehnen und darüber sinnieren, in was für einer Welt wir heute leben würden, hätte 2008 John McCain die Präsidentschaftswahl gewonnen.
Was nach einem trivialen Gedankenexperiment klingt, zeigt in Wirklichkeit nur deutlich, wie scheinbar eindeutige Ereignisse im historischen Rückblick eine neue Dimension gewinnen können. Obamas Wahl, besonders in Europa frenetisch bejubelt, war so ein Moment: Der Umbruch war mit Händen zu greifen, change was coming to America.
[hr gap=“3″] Zu faul zum Lesen? Dann lassen Sie sich diesen Artikel einfach vorlesen von David Harnasch:
Musik: Rocket Power Kevin MacLeod (incompetech.com); Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License; http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ [hr gap=“3″]
Heute wirkt das alles wie aus einem früheren Leben. Mindestens in außenpolitischer Hinsicht war Obamas Regierungszeit eine Geisterbahnfahrt aus ziellosem Aktionismus, deplatziertem Schweigen und beschämender Untätigkeit. Vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an wollte Obama vor allem das Gegenteil seines Vorgängers George W. Bush sein, der in progressiven Kreisen spätestens seit dem Irakkrieg 2003 als geistig minderbemittelter Kriegstreiber galt. Dafür warb Obama in Kairo für einen Neustart der Beziehungen zur arabischen Welt und in Prag für eine Welt ohne Atomwaffen, er warb zuhause (erfolglos) für eine Schließung von Guantánamo und in Moskau (noch erfolgloser) für eine neue Ära amerikanisch-russischer Zusammenarbeit, und er warb in Israel mit Nachdruck für einen nachgiebigeren Kurs gegenüber den Palästinensern. Obama wollte ein Präsident der bedachten Außenpolitik sein, einer, der zuhörte und Schluss machte mit Schnellschüssen und Alleingängen. Dem neokonservativen Ideal des Democracy Building setzte er eine Politik der abwartenden Äquidistanz entgegen, die es u.a. erlaubte, den Iranern im Frühjahr 2009 erst ein fröhliches Nowruz zu wünschen und die Beglückwünschten im Sommer desselben Jahres bei ihrem großen, mutigen Aufstand gegen die Wahlfälschungen dann gnadenlos hängenzulassen.
Nach Obama war die Welt gefährlicher
Dieses Vorgehen mag man nach der polarisierenden Erfahrung der polarisierenden Bush-Jahre verständlich finden, eine historische Entschuldigung für Obama ist es nicht. Zum Ende seiner Amtszeit war die Welt eine wesentlich gefährlichere und unsicherere als noch 2009: Russland, Syrien, Iran, Nordkorea, kaum eine Krise, die sich unter seiner Präsidentschaft nicht entscheidend zugespitzt hätte. Obama hatte viel zugehört, er hatte viel abgewartet, er hatte viel auf tatsächliche und potenzielle Partner in aller Welt gewartet, und in den entscheidenden Momenten blieb er oft genug untätig.
Vor diesem Hintergrund kann und muss ein ehrlicher Vergleich der zurückliegenden beiden Präsidentschaften eigentlich das Ergebnis zeitigen, dass der hierzulande so vielgerühmte multilaterale Ansatz nicht nur keine bessere, sondern tatsächlich sogar eine wesentlich schlechtere Lösung für viele politische Fragen darstellt als der Kurs der von vielen mit Verve verachteten Riege Bush-Rumsfeld-Rove. Trotz Obamas furchtbarer außenpolitischer Bilanz ist hierzulande aber das Urteil schon gefallen: Statt das Geschehene realistisch einzusortieren, müht man sich lieber, die noch erratischere Politik von Obamas Nachfolger Trump in bekannte Kritikschablonen zu pressen. So geschehen bei der taz, die den Rückzug der USA aus der UNESCO mit der abfälligen Bemerkung kommentierte, Trump stehe eben „für unilaterale Politik und Diktat“. Dass die tatsächliche Problematik des aktuellen Präsidenten damit maximal gestreift wurde, ist egal.
Die hohe Meinung, die man hierzulande von multilateralen Lösungsansätzen hat, wird historisch besonders vor dem Hintergrund des langjährigen Status der Bundesrepublik als partiell souveräner Teilstaat verständlich, wirklich entschuldbar wird sie angesichts des nicht erst seit Obama für jedermann sichtbaren Scheiterns eines multilateralen Ansatzes nicht. Der Glaube an die Vereinten Nationen als eine Art über den Wassern schwebende Globalregierung, die als einzige eine in Chaos geratene Welt ordnet, ohne dabei selbst in deren Niederungen hinabsteigen zu müssen, ist nirgendwo so anschlussfähig wie in Deutschland, wo der Bürger zwar ebenso bei jedem Kontakt mit Beamten die Augen verdreht, aber nichtsdestotrotz überzeugt ist, die allermeisten Probleme könne nur „der Staat“ lösen. „Der Staat“ besteht im internationalen Maßstab als UN zwar gleichfalls nur aus der Summe seiner Mitgliedsländer und bildet lediglich deren Vorzüge und Nachteile in einem größeren Forum ab, trotzdem gilt er in Deutschland als einziger Garant für Sicherheit und Stabilität, für Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis. Dem entspricht auch das langjährige Comment deutscher Außenpolitik, drängende Fragen gern in größtmöglichen Gesprächsrunden zu lösen und sich der militärischen Durchsetzung einmal gefundener Lösungen im Anschluss so weit wie möglich zu entziehen.
Dialoge, Runde Tische und Gesprächsfäden
Dieser radikal dialogbetonte Ansatz hat im Land des „ehrlichen Maklers“ durchaus historische Präzedenz, fußt dabei aber auf größtmöglicher Äquidistanz. Aus diesem Verständnis von Realpolitik – ein Wort, das es nicht ohne Grund aus dem Deutschen ins Englische geschafft hat – heraus wurden und werden in bester Steinmeier’scher Diktion allerorten Dialoge angeregt und Runde Tische gefordert, wird vor dem Abreißen imaginärer Gesprächsfäden gewarnt und werden diplomatische Ringelpieze wie etwa die inzwischen zurecht in Vergessenheit geratenen Syrien-Friedensgespräche notfalls bis zum Erbrechen weitergeführt, egal, ob sie noch irgendeinen Sinn erfüllen. So sind auch die ständigen „Gesprächsangebote“ zu verstehen, die politische Kräfte von der Linken bis zur FDP umso mehr an Russland machen wollen, je verantwortungsloser das Land agiert, und so wird auch der ganze Stolz der deutschen Außenpolitik, der Iran-Deal, verständlich, der nicht allein dadurch zu einem durchdachten, zielführenden Regelwerk mutiert, dass Donald Trump ihn ablehnt.

Nun sollte Reden im Grundsatz natürlich den Vorzug vor militärischer Konfliktlösung erhalten. Doch hängt der Ertrag eines Gespräches von Anfang an von dessen Glaubwürdigkeit ab, und wo das Reden erkennbar zum Selbstzweck verkommt, wie seit Jahren in der UN, da ist diese Glaubwürdigkeit gleich null.
So gerät ein Multilateralismus, der seine Handlungen allein durch die Unterstützung einer möglichst großen Zahl von Staaten nicht nur als legitimiert, sondern auch berechtigt ansieht, zum Instrument der Willkür. In einem System, in dem die Stimme der USA ebenso viel zählt wie die des Iran und die Finnlands ebenso viel wie die von Saudi-Arabien, kann von qualifizierten Entscheidungen kaum die Rede sein. Neben allen anderen Erwägungen muss ein freier und demokratischer Staat wie Deutschland sich hier die Frage stellen, ob ihm der Erhalt eines supranationalen Forums jene peinlich-absurden Momente wert ist, wenn Länder wie Saudi-Arabien und die Demokratische Republik Kongo sich zu Richtern über Fragen der Menschenrechte auch bei uns aufschwingen. Wer sich der moralischen Fragwürdigkeit solcher Zustände entziehen will, der muss konsequenterweise ein Gremium wie den UN-Menschrechtsrat entweder abschaffen oder ihn unerbittlich nur mit demokratischen Ländern besetzen. Beides scheint im Rahmen der Vereinten Nationen kaum vorstellbar, was die Frage nach der Existenzberechtigung dieser Organisation umso dringlicher werden lässt.
Der Weg zum funktionierenden Multilateralismus hingegen führt ironischerweise über den Neokonservatismus, der zumindest in deutschen Redaktionsstuben als dessen genaues Gegenteil firmiert. Denn wo Mehrheitsentscheidungen der internationalen Gemeinschaft nicht einfach nur irgendeine Mehrheitsmeinung sein, sondern auch einen demokratisch besicherten Wert haben sollen, kann es Diktaturen nicht länger erlaubt bleiben, gleichberechtigt mitzureden – womit wir wieder bei John McCain sind. Zu dessen nicht umgesetzten Wahlversprechen von 2008 gehörte auch die Schaffung einer „Liga der Demokratien“, die, wie McCain es formulierte, dort „aktiv werden kann, wo die UN untätig versagen“. Der Vorschlag, der ausdrücklich als Gegengewicht zu Staaten wie Russland, China und dem Iran gedacht war, wurde seinerzeit mehrheitlich belächelt, ehe Obamas Präsidentschaft ihm den Todesstoß versetzte.
Deutsche Heucheleien
Besonders vor dem Hintergrund des erbärmlichen Zustands der UN und ihrer Unterorganisationen bleibt die Frage jedoch aktuell: Wie, wenn nicht im Stile McCains, soll es denn gehen? Soll die freie Welt, soll Amerika, egal unter welchem Präsidenten, seine jungen Männer in Kämpfe schicken, deren Legitimität nur eine Phalanx von Tyrannen bescheinigt hat? Soll sie umgekehrt untätig bleiben, weil dies der Taktik einer quantitativen Übermacht derselben Tyrannen entspricht? Dieselbe Frage können, nein: müssen sich alle stellen, die ihr politisches Fundament in denselben Werten von Freiheit und Demokratie sehen wie die USA. Es hat etwas kolossal Heuchlerisches, wenn ausgerechnet Deutschland, ein Land, das seine freiheitliche Verfasstheit gleich mehrfach den Amerikanern verdankt, heute die Fahne einer zutiefst antidemokratischen und unfreiheitlichen Organisation wie der Vereinten Nationen hochhält, nur weil hierzulande irgendwann beschlossen wurde, dass ein prodemokratischer Unilateralismus à la Bush nicht funktioniert. Diese Meinung kann man vertreten – aber dann ausgerechnet auf die UN setzen? Aufhören zu rauchen, anfangen zu trinken?
In Wahrheit kann ein gedeihliches Miteinander eben nur zwischen Demokratien entstehen, und wer nicht jedem Menschen, gleich welcher Herkunft und religiöser oder kultureller Prägung, einen freiheitlichen Lebensentwurf zubilligt, der braucht sich nicht mehr für vorgeblich werteorientierte „Realpolitik“ in Pose zu werfen. Egal ob in Syrien, in Nordkorea oder im Iran, in China, Saudi-Arabien, Russland, Kuba oder Venezuela: Die Lösung der politischen Krisen kann nicht in einem kurzfristigem, „multilateral“ unterfütterten Appeasement von Regimen bestehen, deren unfreie Verfasstheit zu akzeptieren gleichbedeutend wäre mit der Geringschätzung unserer eigenen Freiheit. Selbstverständlich kann und muss daher das Endziel jeder Krisenbewältigung in und mit unterdrückerischen Staaten der Regime Change sein, der als einziger die autoritären Herrschaften als Urgrund politischer Verwerfungen beseitigt. Wer dagegen hofft, man müsse das autoritäre Krokodil nur lange genug füttern, bis es sich irgendwann satt zurückzieht, der verkennt den expansiven Charakter autoritärer Herrschaft, die sich noch stets überallhin ausgebreitet hat, wo der freiheitliche Diskurs ihr dafür Raum ließ. Wer die Probleme dieser Welt auf multilateralen Wege lösen möchte, muss dies daher in freiem Einvernehmen tun.
Diesem Ziel könnten wir heute schon ein großes Stück näher sein – wenn, ja wenn 2008 McCain gewonnen hätte. Aber dann und wann ist so ein Herbsttraum erlaubt.