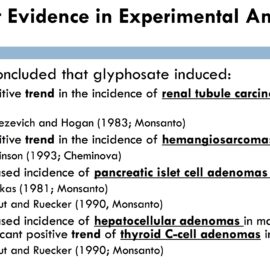Es ist nicht leicht, Trump zu sein
Ach wie schön war der Wahlkampf. Aber alles Schöne endet und dann steht die Realität vor der Tür. Und dann hat das Gerede auf Twitter auf einmal echte Folgen.
Es ist nicht immer leicht, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Vor allem dann nicht, wenn man sich eigentlich noch im Wahlkampf-Modus befindet. Genauer: Wenn man Donald Trump heißt und lieber zu Angehörigen des sagenumwobenen movements reist, anstatt sich mit „sogenannten“ Richtern und der komplexen Welt des Krankenversicherungssystems herumzuschlagen.
Da twittert man einfach mal drauf los und will nur ganz bescheiden darauf hinweisen, dass Vorgänger Obama ganz Watergate-mäßig höchstpersönlich ein Abhör-Kommando für den Trump Tower geordert haben soll, und schon regt sich die halbe Welt darüber auf. Dann legt man nach und zieht mit den Briten einen der wichtigsten Partner überhaupt mit rein, und schon wieder will niemand glauben, was das Weiße Haus von den Experten auf Russia Today, Breitbart und Fox News gelernt hat.
Auf einmal kommt ein Comey daher
Und als wäre das nicht genug, kommt nun auch noch FBI-Direktor Comey des Weges und gibt den Spielverderber, indem er gemeinsam mit dem Justizministerium und dem NSA-Chef die alternative Faktenwelt zum Einsturz bringt. Dass Comeys Behörde schon seit Längerem mögliche Absprachen zwischen Trump-Kampagnen-Mitgliedern und Vertretern der russischen Regierung untersucht, ist daneben ein weiteres Highlight des 60. Tages der Trump-Regierung.
All das kann einen Donald J. Trump aber freilich nicht irritieren. Es bleibt alles wie gehabt, sich bei Obama entschuldigen werde man natürlich nicht, so sein Sprecher kurz nach der Anhörung vor dem Kongress. Denn Trump wäre nicht Trump, wenn er einen Fehler eingestehen würde. Ob Fake oder Fakt, nationale Sicherheit oder nationale Unsicherheit – im Zweifel bleibt der Anführer der freien Welt lieber konsequent bei der Unwahrheit, als inkonsequent zur Wahrheit und Aufrichtigkeit zu wechseln.
Ami go home und Merkel-Phobie
Derweil ist die vereinte Intelligenzija auf der anderen Seite des Atlantiks noch damit beschäftigt, den verweigerten Merkel-Handschlag am vergangenen Freitag zu Tode zu analysieren. Und wie immer ist es schwierig, sich zu entscheiden, welche Seite sich engagierter zeigt. Diejenigen, die gestern noch „Ami go home“-Schilder durch die Gegend trugen, sich nun aber als größte Amerika-Freunde aller Zeiten gerieren und in Donald Trump den Vollstrecker ihrer chronisch-obsessiven Merkel-Phobie und Anführer einer vulgär-konservativen Konter-Revolution sehen?
Oder diejenigen, die schon immer wussten, dass die Amis im Grunde ein kulturloses Volk sind, nun im Namen der moralisch-demokratischen XXL-Überlegenheit eine Emanzipation von den verhassten USA fordern und damit schon mal mit einer Nicht-Erhöhung des Verteidigungs-Etats anfangen wollen? Geschenkt. Irgendwo da draußen rotiert übrigens Konrad Adenauer in seinem Grab. Aber der war ja eh nur Transatlantiker und Vater der Westbindung.
Was macht eigentlich Putin?
In der Zwischenzeit geht es aber auch in der europäischen Nachbarschaft ordentlich rund. Aus dem ukrainischen Mariupol hört man von toten ukrainischen Soldaten und einer Zunahme der Gefechte von russischer Seite. Und nachdem die Offensive in Syrien schon so gut geklappt hat, versucht Wladimir Putin nun dem Vernehmen nach, seinen Einfluss in Libyen auszubauen. Ob ihm das gelingt, ist offen – auf die Zurückhaltung des Westens kann er sich aber verlassen. Dass ausgerechnet seine größten Fans auch die größten Flüchtlings-Gegner sind, ist dabei eine weitere Pointe, die viel zu oft vernachlässigt wird.
Nicht ganz so offen ist dagegen die Frage, wem Brüche in der Atlantikbrücke im Vergleich mehr schaden: Den Amerikanern, oder nicht doch eher den Europäern? Und wem nützt die Breitbartisierung des Weißen Hauses, das von einem Mann geleitet wird, dessen größte bisherige Errungenschaft in der Etablierung einer alternativen Realität besteht? Gewagte Theorie: Eher den Feinden des Westens als seinen Freunden.