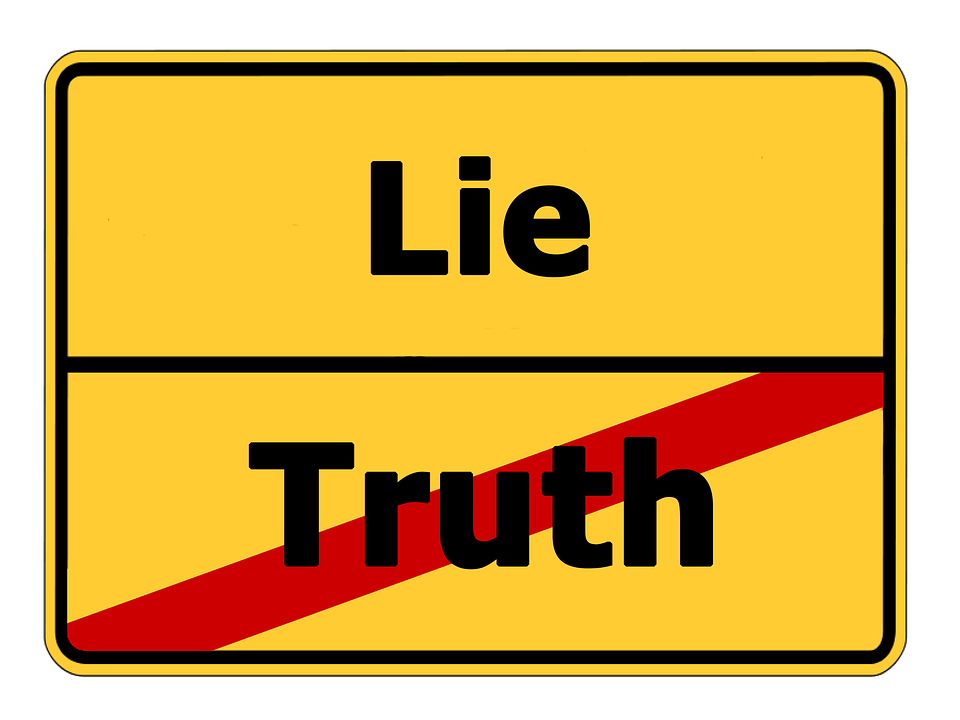Generationeneinerlei
Der Kollege Andreas Öhler schreibt über die Verachtung der Millenials gegenüber den Babyboomern – doch wer verachtet hier eigentlich wen?
Wir kennen die Vorwürfe zur Genüge. Mal sind wir zu angepasst und nicken brav jede noch so unsinnige Forderung ab. Gleichzeitig setzen wir uns für die falschen Dinge wie Quoten, Bedingungsloses Grundeinkommen, ungehinderte Migration oder Political Correctness ein. Würden wir eine Liste all jener stereotypischer Verhaltensweisen anlegen, die uns in schöner Regelmäßigkeit angedichtet werden, wäre vor allem eines schnell klar: Wir sind wahre Alleskönner. Fantastische Allround-Genies, die zu allem und jedem eine Meinung haben, ohne je etwas zu sagen. Unsere Generation ist derart schablonenhaft, dass man sie nur ein wenig in die passende Richtung drehen muss, um ein weiteres Feindbild zu erschaffen, über das man sich hervorragend echauffieren kann.
Das mag in Form einer simplen Polemik noch funktionieren, findet aber fernab jeglicher gesellschaftlicher Realitäten statt. Das, was Kollege Öhler als Verachtung wahrnimmt, wird in den meisten Fällen schlichte Gleichgültigkeit sein. Uns ist dieser vielbeschworene Clash of Generations in aller Regel einfach egal. Wir sehen uns nicht als Millennials oder Angehörige der Generation Y.
Überhaupt, nur ein Buchstabe? Lautete der Vorwurf nicht, dass wir so unscheinbar sind, dass Soziologen uns nur noch durchbuchstabieren? X, Y, Z? Werter Kollege, zwar legt die Demographieforschung keine exakten Kohortengrenzen fest, doch gemeinhin bewegt sich die Generation X im Bereich der 1960er Jahre und endet gegen 1980. Einen Zeitraum, den man nur mit sehr viel gutem Willen dem Begriff der Millennials zuordnen würde. Das sind vernachlässigbare Details, könnte man nun an dieser Stelle einwenden, doch sie offenbaren das grundlegende Elend, an dem die Debatte krankt: Komplexe Zusammenhänge werden übermäßig simplifiziert und verlieren dadurch ihre argumentative Kraft. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, ist es sinnvoll, sich mit einigen der genannten Vorwürfe etwas differenzierter zu beschäftigen.
Unsere Bildung ist vielfältig
Auch diese Replik kann der Diversität des menschlichen Daseins natürlich nur in Ansätzen gerecht werden. Doch es sind Ansätze, die offenbar immer wieder einmal in den Vordergrund gestellt werden müssen, damit es in Zukunft zu weniger Missverständnissen zwischen unser beider Welten kommt. Wir sind eben keine schablonenhaften Persönlichkeitsattrappen, die man beliebig hinter allen (un)möglichen gesellschaftlichen Problemen aufstellen kann. Ebenso wie ihr, verstehen wir uns als eigenständige Individuen, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven und Lebensentwürfe. Das mag vielleicht jemanden überraschen, der vorzugsweise über die gefühlten Stereotypen seines Beobachtungsgegenstands schreibt, anstatt sich die Mühe einer intensiven Auseinandersetzung zu machen.
Es stellt sich unwillkürlich die Frage, von wem eigentlich diese seltsame Ansicht stammt, dass ein Studium der BWL oder generell Wirtschaftswissenschaften beinah zwangsläufig in einer stromlinienförmigen, assessmentcenteroptimierten Konzernkarriere endet? Macht man es sich mit dieser Behauptung nicht ein wenig zu einfach? Innerhalb unserer Millennial-Filterbubble wissen wir längst, dass die knallharte Karriereplanung mittels BWL/Jurastudium viel eher in den Köpfen der Leute, die über uns schreiben, als in der Realität ihre Entsprechung findet. Das lässt sich sogar anhand konkreter Statistiken nachweisen. Im Wintersemester 2018/19 waren etwa 2,87 Millionen Studenten in Deutschland immatrikuliert. Dieser Wert verfolgt seit Jahren einen kontinuierlichen Aufwärtstrend mit einigen Zehntausend mehr pro Jahr. 2016 gab es in Deutschland 114 003 immatrikulierte Studenten der Rechtswissenschaften und 2017 studierten 240 572 Menschen BWL. Legt man einen Durchschnittswert von 2,8 Millionen Studenten zugrunde, ergeben sich daraus prozentuale Verteilungen von einerseits 4,1% für Jura sowie 8,6% für BWL – Verhältnisse, die eine Frage wie „Warum nur Jura und BWL?“ kaum rechtfertigen lassen.
Umso mehr wundern wir uns daher auch über die Aufforderung, mittels der Wahl von „Orchideenfächern“ unserem Individualismus Hochkonjunktur zu verleihen und mit voller Kraft gegen den Strom zu schwimmen. Wer je einmal mit einem Studenten der Politikwissenschaften oder Soziologie gesprochen hat, der wird verstehen, warum dieser Ratschlag so irritierend ist. Diese beiden Beispiele sind bei Weitem keine „Orchideenfächer“, trotzdem hört man nicht selten von Angehörigen der uns vorausgegangenen Generationen die Frage, welcher Tätigkeit man mit so einem Studienabschluss am Ende nachgehen könne. Die Vermutung liegt nahe, dass in entsprechend höherer Frequenz solche Fragen bei tatsächlich exotischen Fachrichtungen (gemessen an ihrer absoluten Studentenzahl) auftreten. Da erscheint es beinahe skurril, dass man uns jetzt plötzlich dazu ermuntern möchte, doch genau diese hochgradig spezialisierten Fachrichtungen zu studieren, um uns irgendwie vom bösen Mainstream abzugrenzen. Die dahinterliegende Problematik ist demnach wohl auch eine gänzlich andere, denn vielmehr dreht sich dieser abwertende Begriff um einige der sogenannten Kleinen Fächer, die von manchen Menschen als wertlos betrachtet werden. Weist man stattdessen daraufhin, dass auch Studiengänge wie Astrophysik oder Bioinformatik, also spannende, interdisziplinäre Richtungen, in diese Kategorie fallen, sorgt das nicht selten für Überraschung.
Uns ist die minutiös durchgeplante Karrierelaufbahn im Vergleich zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance im Durchschnitt nicht allzu wichtig. Stattdessen wollen nicht wenige von uns durch ihr Studium am Ende in einem Bereich arbeiten, der sie interessiert und den sie aktiv mitgestalten können. Das können zwar auch, müssen aber beileibe nicht immer nur Konzerne sein. Wenn wir uns dann doch einmal irgendwie innerhalb der Mühlen gigantischer, kapitalistischer Verwertungsmaschinen zurechtfinden wollen, so hinterlassen wir immer häufiger einen bleibenden Eindruck und stellen tradierte Strukturen infrage. Selbstverständlich wollen wir genügend Geld zum Leben haben, doch Lohn ohne Mitbestimmung stellt uns selten zufrieden. Wir wollen Einfluss nehmen, unsere Vorstellungen verwirklichen, unsere Persönlichkeit entwickeln und im Wortsinn mitarbeiten, nicht nur Arbeitszeit totschlagen. Im 2008 erschienen Buch The Trophy Kids Grow Up: How the Millennial Generation is Shaking Up the Workplace des Wall-Street-Journal-Kolumnisten Ron Alsop, beschreibt dieser, dass selbst böse, neoliberale Vorzeigeunternehmen wie Goldman Sachs oder IBM sich derartiger Veränderungen mittlerweile bewusst geworden sind und spezielle Mentoring-Programme ins Leben gerufen haben, um den Bedürfnissen neuer, junger Mitarbeiter besser gerecht werden zu können.
Protestkultur? Check
Aber nicht nur einen subtilen Einfluss auf Unternehmenskultur übt unsere Generation aus. Wir können auch laut. Kollege Öhler nennt als Negativbeispiel unserer mangelnden Protestkultur, dass wir die Bolognareform beinahe schweigend hingenommen hätten. Haben wir nicht. Wir sind 2009 zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen und demonstrierten gegen ein System, von dem wir bereits damals wussten, dass es mehr Nach- als Vorteile bringt. Dass wir denselben Enthusiasmus zu Beginn der Reform 1999 vermissen haben lassen, mag womöglich auch einfach darin begründet sein, dass die meisten von uns damals noch im Kindes- oder Teenageralter waren. Geschenkt. Mittlerweile arrangieren wir uns damit, indem wir Urlaubs- und Auslandssemester einlegen, uns in studentischen Organisationen engagieren und eher häufiger als seltener die Regelstudienzeit überziehen.
Viele von uns sind jahrelang gegen Naziaufmärsche am 13. Februar in Dresden und anderen Städten auf die Straße gegangen, wir haben gegen PEGIDA, LEGIDA und wie sie alle heißen, demonstriert. TTIP, Gentechnik, Umweltschutz, Gleichberechtigung und Co. sind immer wieder Themen, die uns während der letzten Jahre regelmäßig in tausendfacher Stärke gemeinsam lautwerden haben lassen. Sicherlich kann man über die Sinnhaftigkeit dieser oder jener Demonstration debattieren, aber den Vorwurf der Teilnahmslosigkeit und des politischen Desinteresses weisen wir vehement von uns. Nicht selten mussten wir uns stattdessen gegen die Behauptung verteidigen, dass wir viel zu einfach zu begeistern wären und lieber mittels Megafon und Lauti diskutieren, anstatt durch feingeistige politische Essays zu überzeugen versuchen. Dabei haben wir beides getan, doch offenbar war es uns nicht möglich, einige festgefahrene Vorurteile zu überwinden.
Millennials schaffen Werte
Diese irrigen Annahmen gehen dabei sogar so weit, dass sie die offensichtlichen Errungenschaften unserer Generation völlig ignorieren. Legen wir einmal die gängige Definition der Millennials zugrunde, die uns in etwa zwischen 1980 und 1995 verortet, dann kann man über die rhetorische Frage nach unserem geistigen Urheberrechtsanspruch für Irgendwas nur müde den Kopf schütteln. Beispiele gefällig? Gern:
- Mark Zuckerberg (*1984), CEO und Gründer von Facebook
- Kevin Systrom (*1983) und Mike Krieger (*1986), Gründer von Instagram
- Daniel Ek (*1983), Co-Gründer von Spotify
- Zhang Yiming (*1983), Gründer von ByteDance
- Evan Spiegel (*1990) und Bobby Murphy (*1988), Gründer von Snapchat
Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, allesamt von Millennials (mit)gegründet, die unsere heutige Gesellschaft nachhaltig verändert und teilweise völlig neue Wirtschaftszweige erschaffen haben. Klar, das sind nur einige der berühmtesten Beispiele und die Mehrzahl aller Start-Ups scheitert, aber das war in eurer Generation nicht so viel anders als in unserer. Man könnte bereits an dieser Stelle das Fazit ziehen, dass es mit der behaupteten Tatenlosigkeit und dem Mangel an revolutionären Charakter nicht weit her ist, doch wie sehr unsereiner wieder einmal missverstanden wird, zeigt das Beispiel der Musik.
Es stimmt ein wenig traurig, dass Kollege Öhler hier einen Generationenkonflikt herbeiredet, der in unseren Augen nicht wirklich existiert. Anstatt dass wir uns gemeinsam an den fantastischen Werken von Queen, Meat Loaf, Led Zeppelin, Johnny Cash, Beatles und Co. erfreuen, wird uns vorgeworfen, wir würden nur noch „covern“ und „verfremden“. Nichts könnte ferner der Wahrheit sein. Wir ver- und bearbeiten diese Klassiker, gerade weil wir ihrem Zauber verfallen sind und nach Wegen suchen, um Alt mit Neu zu kombinieren. Wir erschaffen Hommagen an eine Zeit, die nicht die unsere war, deren Wirken wir aber immer noch zu schätzen wissen. Unsere Vorstellung von Kunst, von Musik mag nicht immer der euren entsprechen, doch uns liegt viel daran, die eigene Identität in der Reinterpretation alter Werke zu verwirklichen. Wer tage- oder gar wochenlang nach einer perfekten Komposition sucht, die dem Klassiker in angemessener Weise Respekt erbietet und gleichzeitig neue Kunst erschafft, die qua Emergenz nie Dagewesenes hervorbringt, dem kann man schwerlich simples Kopieren zum Vorwurf machen.
Doch damit nicht genug. Auch das Schreiben und Komponieren völlig neuer Texte und Melodien verliert nicht automatisch dadurch seine Daseinsberechtigung, weil einige Menschen an ihnen keinen Gefallen finden oder sie schlicht nicht verstehen. Man muss Rap oder Techno nicht mögen, doch den Künstlern ihren kreativen Schaffensakt in Abrede zu stellen, erweckt schnell den Eindruck puritanischer Überheblichkeit. Vermutlich hätten auch die Musikkritiker zu Mozarts Zeiten wenig Gefallen an Meat Loafs Rockballaden gefunden, doch wäre dadurch der Vorwurf mangelnder Originalität zu rechtfertigen gewesen? Wahrscheinlich nicht. Kunst, und Musik im Speziellen, ist immer ein Kind ihrer Zeit, das macht ihre Einordnung gemäß pauschaler Kriterien naturgemäß sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich. Damit ist sie der pauschalen Verurteilung einer ganzen Generation nicht ganz unähnlich.
Wesentlich konstruktiver erscheint da die Herangehensweise, dass man einmal mehr den Fokus auf die tatsächlich bestehenden Herausforderungen legt und diese gemeinsam zu lösen versucht. Es wird in absehbarer Zeit Probleme in der Rentenfinanzierung geben; wir stehen vor großen Hürden, die einen effizienten Umweltschutz kaum möglich machen; zunehmende Automatisierung wird ebenfalls immer mehr Menschen betreffen und deren bisherige Arbeitskraft nicht mehr benötigt. Anstatt jedes Mal aufs Neue mit dem Finger aufeinander zu zeigen und aufzulisten, was die jeweilige Generation alles besser und anders gemacht hat, sollten wir stattdessen miteinander an einer angenehmeren Zukunft für alle arbeiten. Auf der Welt existieren bereits genügend Konflikte – mehr Streit zwischen den Generationen braucht es da wahrlich nicht.