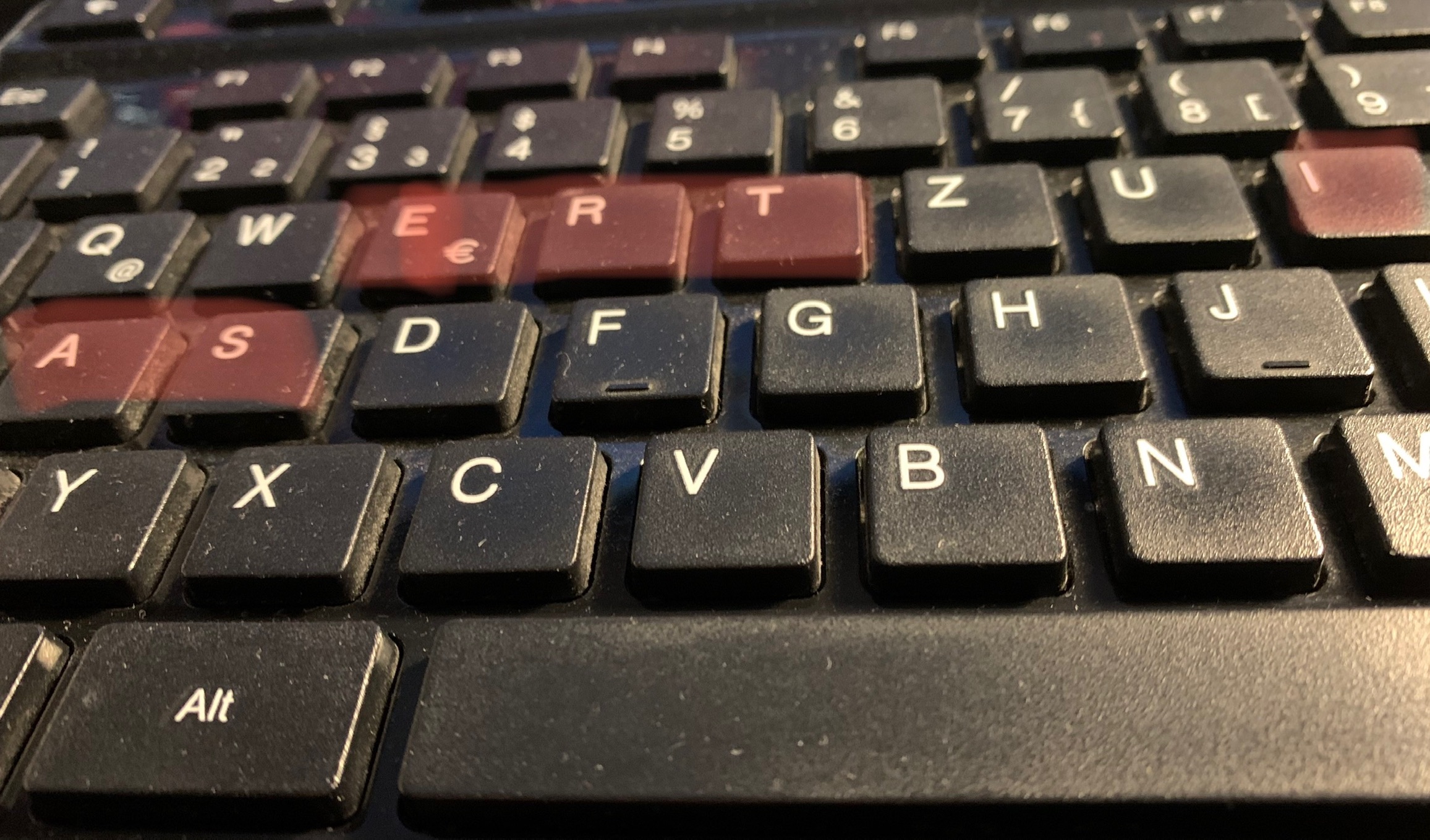Haifa – ein Kleinod im Norden Israels
Abou-Chakers, Hummus, Russen, die Bahai und Araber. Für manche ist Haifa eine Blaupause für eine Ein-Staaten-Lösung.
Das letzte Mal war ich 1999 in Haifa. Damals lebte ich ein halbes Jahr im Kibbutz Hazorea, nicht weit entfernt. Und mein Zimmernachbar David, der aus Panama stammte, besuchte seine russische Großmutter in der Küstenstadt. Ich begleitete ihn.
Man sagte in Israel früher immer: In Tel Aviv wird gelebt, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa wird gearbeitet. Ich glaube, das stimmt nicht mehr so ganz. Die Tech-Firmen, die Israel wirtschaftlich geboostet haben, sind hauptsächlich im Großraum Tel Aviv angesiedelt.

Aber Haifa ist interessant. Hier, so hieß es zumindest im Buch „Haifa Republic“ von Omri Boehm, lebten Juden und Araber relativ friedlich zusammen.
Als ich nun das erste Mal nach der Pandemie wieder in Israel war, nahm ich einen der ex-deutschen Interregios von Tel Aviv und war nach einer klimatisierten Stunde in Haifa. Ich hatte Hunger und googelte „Hummus Haifa“. Da fiel mir ein Restaurant mit einem bekannten Namen in der Nähe des Bahnhofs auf: „Hummus Abu Shaker“.
Ich sagte im Imbiss, dass ich aus Berlin käme und fragte, ob jemand die Familie Abou-Chaker in Berlin kenne. Da antwortete mir Bilal Abou-Chaker auf Hebräisch: „Natürlich, Arafat! Aber die sind irgendwie eine Mafia, oder?“
Wir unterhielten uns, während ich neben Juden und Arabern den Hummus mit scharfer grüner Soße und Ei aß. Bilals Teil der Familie war bei der israelischen Staatsgründung und den darauffolgenden Kämpfen nicht geflohen. Er und seine Verwandten haben allesamt israelische Pässe. Er sagte, er wolle bald mal nach Berlin kommen und ich lud ihn ein, mit mir den Hummus von „Azzam“ an der Sonnenallee 54 zu probieren.

Gestärkt-geschwächt vom schwer verdaulichen Kichererbsenbrei lief ich dann noch hoch zum wunderbaren Blumen-Garten-Heiligtum der Bahai und dann wieder runter an den Strand „Bat Galim“, wo ich in der Sonne brutzelte und das friedliche, schöne Leben in Haifa beobachtete. Viele Russen und Araber, so schien es mir.

Der in den USA lebende Israeli Boehm, der wiederum von manchen als linker, spinnender Romantiker gesehen wird, glaubt, dass dieses nicht perfekte und doch funktionierende Leben in Haifa ein Model für ganz Israel sein könnte. Er glaubt, die Zweistaatenlösung sei mit mittlerweile fast einer halben Million jüdischen Siedlern im Westjordanland eine Utopie, deswegen heißt sein Buch auf Deutsch „Israel – eine Utopie“.
Er glaubt, die einzige Möglichkeit für einen anhaltenden Frieden wäre ein Staat für Araber und Juden, in dem alle gleiche Rechte und den gleichen Pass hätten. Ein föderaler Staat mit Israel und Palästina unter einem Mantel. Es müsste auch eine mögliche Rückkehr von Nachkommen geflohener Palästinenser – wie den Berliner Abou-Chakers – in Aussicht gestellt werden. Er sagt, das hätten eigentlich auch die Gründerväter um David Ben-Gurion im Sinn gehabt.
Vielleicht ist auch das eine Utopie, denn wer weiß, ob die im Westjordanland lebenden Araber oder auch politisch rechte Juden sich darauf einlassen würden – aber auch ein befreundeter Rechtsanwalt aus Tel Aviv sagte mir: So wie jetzt ginge es nicht weiter.

„Ich will nicht mit allen Arabern in einem Staat leben“, sagte er. „Aber wir sind die Stärkeren. Wir müssen handeln. Entweder wir reißen die Siedlungen ab und geben ihnen ihren eigenen Staat, das würde ich befürworten – oder wir müssen alle in einem Staat leben. Sie als Menschen ohne wirkliche Rechte im Westjordanland leben zu lassen, das geht auf lange Sicht nicht.“