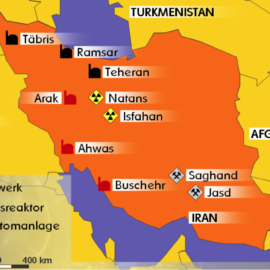Zwischen allen Fronten
Jens Hacke beschreibt in seinem Buch „Existenzkrise der Demokratie“, wie der politische Liberalismus in der Weimarer Republik unter die Räder geriet. Ein Menetekel für heute.
Die gängige Geschichtserzählung geht so: Im Zeitalter der ideologischen Extreme, die vor allem die erste Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts prägten, habe allein der Liberalismus standgehalten und eine „Politik der Mitte“ verfolgt. Weshalb aber war es dann äußerst populär, von „Scheißliberalen“ zu sprechen, während man heute wohl eher Formulierungen wie „wischiwaschi“ oder „weder Fisch noch Fleisch“ bevorzugen würde?
Der an der Berliner Humboldt-Universtädt lehrende Politikwissenschaftler Jens Hacke hat unter dem Titel „Existenzkrise der Demokratie“ dem Liberalismus der Weimarer Republik eine profunde, umfang- und fußnotenreiche und dennoch eminent lesbare Studie gewidmet, die sich zu weiten Teilen wie ein Menetekel für die Gegenwart liest. (Obwohl – oder gerade weil – der stets ausgewogen argumentierende Verfasser auf aktualisierende Einschübe verzichtet und es dem mündigen Leser überlässt, Parallelitäten zu entdecken.) Bereits nach Weltkriegsende 1918 hatte es nämlich eine kurzzeitige Euphorie gegeben – die Hoffnung auf Etablierung des Rechts im internationalen Maßstab, auf ein versöhntes, prosperierendes Europa und eine stabile deutsche Demokratie. Tragischerweise waren es jedoch oft ältere Intellektuelle, die solche Präferenzen hatten, während sich Jüngere bereits vom (rechts-linken) Geist vermeintlich einfacherer Lösungen beinflusst zeigten.
Der Liberalismus der Weimarer Republik, politisch gespalten, funktionierte größtenteil noch als Honoratiorenverein, der mit der als zu plump empfundenen Demokratie fremdelte oder – quasi als Travestie des Individualismus – ebenfalls eine Schwäche für charismatische Führer hegte. Wer sich wundert, weshalb in der heutigen FDP zahlreiche Putin-Fans rumoren, lese deshalb dieses Buch, das auf unaufgeregte Weise mit vielen allzu schmeichelhaften liberalen Selbstbildern aufräumt. Vor allem aber faszinierend, welche der damaligen Debatten von Jens Hacke, der aus seiner liberalen Grundsympathie kein Hehl macht, hier rekapituliert werden. So war es etwa der späterhin emigrierte Nationalökonom Götz Briefs, der bereits in den zwanziger Jahren den „Finalismus des Marktglaubens“ aufs Korn nahm und dem Liberalismus seiner Zeit bescheinigte, „zu einer Anzahl von Faustregeln für Börsenjober“ heruntergekommen zu sein.
Fragilität der liberalen Demokratie
Vor allem aber waren es deutsch-jüdische Sozialliberale, die mit einem feinen Gespür für das Fragile liberaler Demokratie schon frühzeitig vor thematischer Verengung gewarnt hatten und dafür plädierten, an die „vom Liberalismus vernachlässigten emotionalen und kämpferischen Kräfte“ zu appellieren. Es kommt nicht eben häufig vor, dass ein als Ideengeschichte intendiertes Buch auch beim Leser Emotionen auslöst, und doch ist dem so: Nahezu unmöglich, nicht berührt zu sein von der moralischen und intellektuellen Integrität von Denkern wie Hermann Heller, Hans Kelsen, Felix Weltsch, Moritz Julius Bonn oder Hugo Preuß, die dann von den Nazis vertrieben wurden und deren zutiefst achtbare Biographien Jens Hacke dem Vergessen entreißt. „Der zeittypischen Inflationierung rousseauistischer Demokratieideale und dem Missbrauch des Demokratiebegriffs für Diktaturmodelle, die sich durch gelenkte Akklamation legitimierten, setzten sie die Überzeugung entgegen, das eine stabile demokratische Ordnung nur im parlamentarischen Repräsentativsystem zu realisieren sei.“
Felix Weltsch, ein Freund Franz Kafkas und Max Brods, machte sich in seinem Buch „Wagnis der Mitte“ dabei keinerlei Illusionen: „Auch Weltsch kam nicht umhin anzuerkennen, dass die Aporien der liberalen Demokratie theoretisch unauflösbar blieben. Die Tyrannei der Mehrheit war ebenso wenig auszuschließen, wie die Güte, Weisheit oder Wahrheit von Mehrheitsentscheidungen auf irgendeinem Weg bewiesen werden könnte.“
Mit Blick auf die Verführbarkeit der Vielen und konkret der antidemokratischen Kapp-Putschisten etwa schrieb Moritz Julius Bonn prophetisch: „Wer heute Kappist ist, ist morgen Bolschewist“ – umgekehrt gelte das gleiche. Bereits 1925 bescheinigte Bonn, der den amerikanischen Kontinent gut kannte, den Vereinigten Staaten eine krisen-resistentere Gestimmtheit, basierend auf Strukturen sozialer Durchlässigkeit und flacher Hierarchien, von denen deutscher Standesdünkel noch komentenweit entfernt war.
Andere machten sich angesichts der von den Nazis immer unverschämter infiltrierten Institutionen Gedanken über eine „wehrhafte Demokratie“, während Hugo Preuß den Begriff des „sozialen Rechtsstaates“ prägte. Ein traditioneller Liberalismus nämlich, der einzig und allein auf den Schutz des Privateigentums rekurriere, würde blind für neue Formen des Antiliberalismus. Hacke resümiert: „Es reichte fortan nicht mehr, Demokratie reduktionistisch als Instrumentarium zur Auslese politischer Eliten zu akzeptiern und sich darauf zu verlassen, dass eine demokratisch legitimierte Führung für Wohlfahrt, Sicherheit und generell die Leistungsfähigkeit des Staates sorgen würde. Max Weber hatte in den Grundzügen noch ein solchermaßen kalkuliertes Demokratieverständnis aus Top-down-Perspektive für den Liberalismus in Anspruch genommen. Aber die Verteidigung der Demokratie aus instrumentellen Gründen wurde zusehens schwieriger, als das Argument der Effizienz angesichts eines blockierten Parlamentarismus kaum mehr zu halten war.“ Es waren freilich viel zu Wenige, die diese Gefahr sahen, und so stand am Ende der Sündenfall des parteipolitischen Liberalismus, sein Kotau vor der Diktatur, die parlamentarische Zustimmung zu Hitlers Ermächtigungsgesetz vom März 1933.
Zweiter Versuch
Viele der von Hacke nun erneut in Erinnerung gerufenen liberalen Warner, die damals ihr Scheitern hatten eingestehen müssen, wurden jedoch später zu jenen Stichwortgebern der jungen Bundesrepublik, welche nicht etwa im puren Markt-, sondern im flexibleren Ordoliberalismus die Basis für eine prosperierende Ökonomie sahen. Und es war der im bedrohten Weimar politisch wach gewordene Intellektuelle Dolf Sternberger (ein guter Freund Hannah Arendts), der nach dem Krieg nicht nur das schöne Wort vom „Verfassungspatriotismus“ prägte, sondern auch die bis heute aktuelle Formel „Keine Toleranz für die Feinde der Toleranz“. Bereits damals warnte Sternberger vor jener demagogischen Schrumpfform der Kulturkritik, deren „Vokabular von Schicksal, Gefahr, Kampf, Herrschaft und Entscheidung“ nun auch im Jahre 2018 wieder durchs Land wabert.
Mit diesem augenöffnenden Buch hat Jens Hacke einmal mehr seinen Rang als einer der wichtigsten Ideenhistoriker der Republik bestätigt.
Jens Hacke: Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018, 455 S., brosch., Euro 26,-