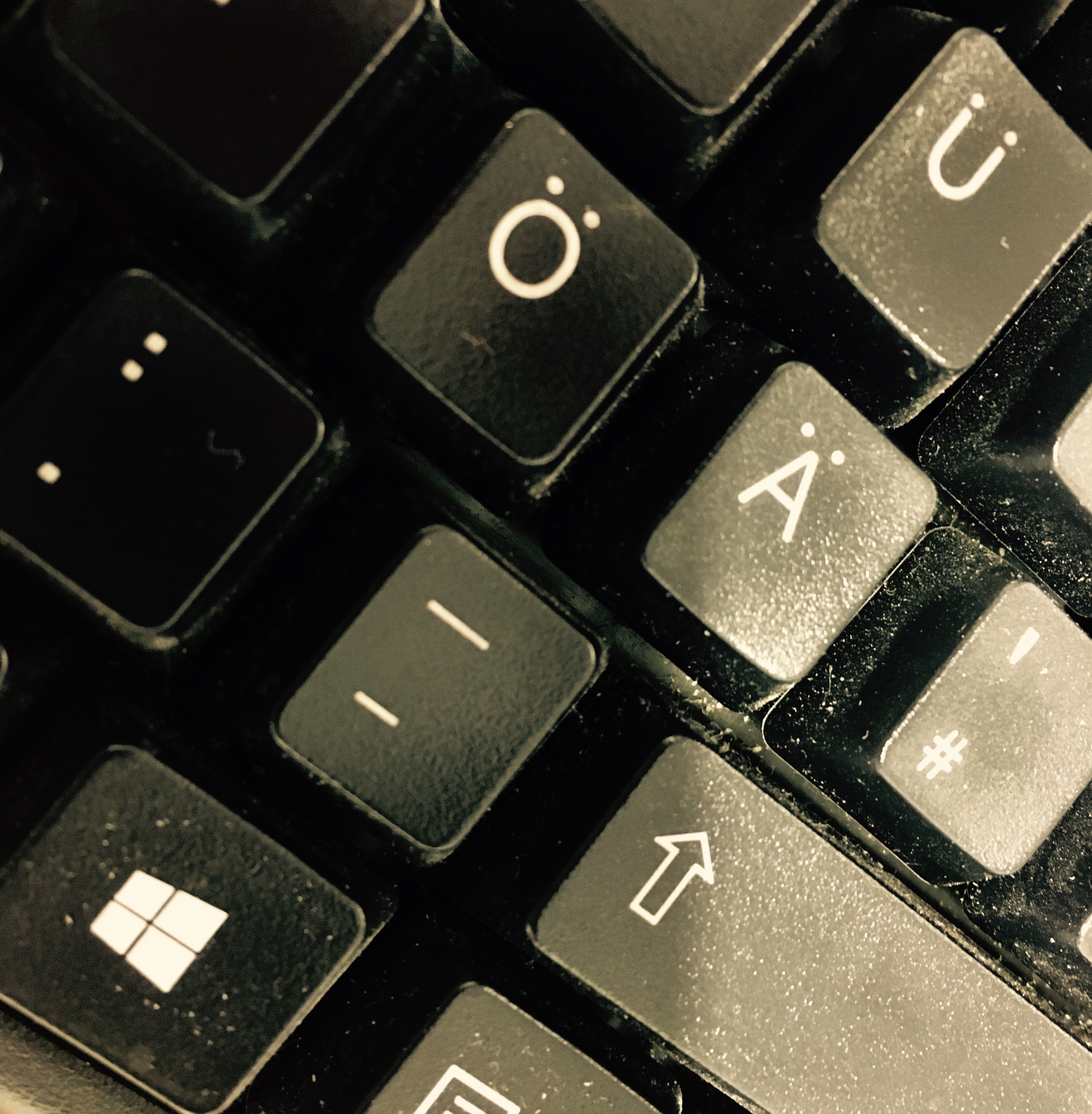Mehr Ambiguität wagen!
Ob Politik, Wissenschaft oder Satire – wir haben verlernt, mit Mehrdeutigkeiten, Zwischentönen und Unsicherheiten umzugehen. Dieser Trend zur reduktiven Eindeutigkeit richtet Schäden an.
Die letzten Monate haben uns ein bemerkenswertes Revival beschert: Das der Naturwissenschaft. Biologen, Mediziner, speziell Virologen waren plötzlich gefragt. Der Corona-bezogene Binnendisput zweier Virologen beschäftigte die ganze Gesellschaft. Aber paradoxerweise legten die öffentlichen Reaktionen zugleich ein Missverständnis dessen offen, wie Wissenschaft arbeitet. Gerade Christian Drosten, dessen Podcast dieser Tage wieder an den Start geht, hat nämlich immer seine Ausführungen über das, was man weiß, flankiert mit Einschüben darüber, was man (noch) nicht weiß, was ungesichert ist und wo die wissenschaftliche Expertise aufhört. Diese Haltung, diese wissenschaftlich-professionelle Vorsicht, wurde ihm häufig vorgeworfen. Wissenschaft, das war und ist für viele Menschen offenbar das Versprechen eines Feldes, das keine Fragen offenlässt. Tut sie aber. Dass es zu guter Wissenschaft gehört, die Grenze zwischen dem, was man schon weiß, und dem, was eben noch offen ist, klar zu formulieren, das konnten und können die Menschen nicht mehr aushalten. Auch dass Drosten immer betonte, er formuliere Empfehlungen an die Politik „nur“ aus seinem Fachgebiet heraus und die Politik müsse natürlich auch noch Erkenntnisse anderer Fachgebiete berücksichtigen (der Wirtschaftswissenschaft etwa) wurde kritisiert oder ignoriert. Immer wünschte man sich eine klare Entscheidung für das eine oder andere. Zu verstehen, dass es unterschiedliche Logiken zu verstehen und abzuwägen galt und gilt, ist offenbar zu viel der Komplexität.
Die parallele Existenz unterschiedlicher Systemlogiken überfordert den gesellschaftlichen Diskurs. Und sie überfordert teils auch die Politik selbst. Zu sehen ist dies dieser Tage angesichts der unäglichen, zunächst verbotenen, dann erlaubten, schließlich angebrochenen „Freiheits“-Demo in Berlin. Das ursprüngliche Verbot wurde begründet mit Hygienevorschriften, der Abbruch ebenfalls. Beides nachvollziehbar. Doch in die Jubelarien aus der Politik fiel von Beginn an viel Genugtuung darüber, dass die (in unterschiedlichen Intensitätsgraden natürlich absurden) Vorstellungen der Corona-Leugner sich nun nicht oder nicht weiter auf Berlins Straßen artikulieren können. Und genau diese Genugtuung ist eben unterkomplex. Politiker sollten differenzieren können zwischen dem Grund eines Verbotes und seinen Folgen für den Diskurs in der Demokratie. Zu letzterem gehören auch Demos von unliebsamer Seite. Politiker müssen damit leben, dass ihnen nicht passende Meinungen, auch absurde, auf Demonstrationen artikuliert werden. Sie müssen diese Komplexität aushalten, weil sie zur Demokratie gehört. Die „richtige“ Position hier wäre also gewesen: Ja, man kann eine Demonstration aus Hygienegründen abbrechen. Aber nein, das ist kein Anlass zu plumpem Jubelgefeixe, sondern aus demokratiefunktionaler Sicht bedauerlich – unabhängig vom Inhalt der Demo, den ich als Politiker womöglich für problematisch halte.
Diese Art Differenziertheit aber zieht im sozialmedialen Dauergezeter nicht. Es herrscht die Sehnsucht nach einfachen Aussagen, klaren gut-böse-Schemata. Es herrscht vor allem auch die Sehnsucht danach, selber zu den moralisch Guten zu gehören. Die Selbstgefälligkeit der jeweils „Guten“ ist dabei so groß, dass sie womöglich die Richtigkeit einer bestimmten Aussage selbst unterminiert oder zumindest das Klima für einen offenen Dialog vergiftet.
Mehrere Bedeutungen gleichzeitig
Man sieht das gut an den Debatten über jenes momentan die ganze Gesellschaft spaltende kleine Stück Kunststoff – die Maske. Die einen verfallen auf Basis von Engführungen wissenschaftlicher Untersuchungen zur Anti-Maske-Pauschalthese („bringen eh nichts“). Was so kein Wissenschaftler gesagt hat. Für andere wird das – natürlich sinnvolle – Masketragen zu einer Art moralischer Selbstvergewisserungsvehikel. Mit großem Pomp feiern sich Teile meiner sozialmedialen Filterblase für das kollektive Masketragen – und decken mit viel Selbstgerechtigkeit jede verrutschte Maske in der S-Bahn auf. Ambiguität, Zwischenton, Vorsicht im Urteil gar? Gleich null. Die einen Merkel-Gläubige, die anderen Covidioten.
Noch schwieriger wird die Sache, wenn wir einen der Komplexität verwandten Begriff anschauen, den der „Ambiguität“, also grob formuliert der Mehrdeutigkeit. Ein und derselbe Inhalt, ein und dasselbe Statement oder Kunstwerk kann mehrere Bedeutungen zugleich haben, mehrere unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten eröffnen, die womöglich jeweils legitim sind und die etwa ein Kunstwerk vielleicht sogar erst faszinierend machen. Dies auszuhalten fällt uns offenbar zunehmend schwer. Der Mangel an Zwischenton, an Offenheit für Mehrdeutigkeit prägt inzwischen jede kulturelle Debatte – und macht diese langweilig.
Nehmen wir die Auseinandersetzungen über die kontroverse Kabarettistin Lisa Eckhart. „Eckhart ist… (Rassistin, Faschistin…)“, so das schnell rausgehauene Pauschalurteil. Man spürt auch hier das Wohlgefühl der einfachen Aussage. Und natürlich ist Eckhart problematisch. Aber einfach „rechts“? Ich bin nicht sicher.
Fakt ist auch: Die rechte Seite will sie offenbar nicht. Eckhart wird rechtsseitig bisher weder vereinnahmt noch verteidigt. Beim AfD-Parteifest irgendwo auf dem Land in Sachsen kann man sie sich, barfüßig und extravagant gekleidet, auch nur schlecht vorstellen. Den grobschlächtigen Agitatoren wäre sie zu offensichtlich Kunstfigur, seltsam doppelbödig, irgendwie schlecht fassbar.
Reduktive Eindeutigkeit
Um eine umfassende Darstellung oder auch Kritik dieser Kunstfigur zu formulieren, braucht es eine Bereitschaft, sich auf genau diese Doppelbödigkeit einzulassen. Diese Bereitschaft erkenne ich momentan nicht.
Ein Plädoyer für die Doppelbödigkeit in Kunst und Gesellschaft formuliert in einem sehr lesenswerten Buch der Islamwissenschaftler Thomas Bauer. In „Die Vereindeutigung der Welt“ geht er mit der zunehmenden Unfähigkeit, Doppelbödigkeiten und Ambiguitäten auszuhalten, ins Gericht. Er zeigt auf, welche langen Vorlaufzeiten der heutige Trend zur reduktiven Eindeutigkeit hatte und wie unsere Kultur unter deren Folgen leidet. Mehrdeutigkeit hat für ihn einen kulturellen Wert. Und der geht zunehmend verloren. In Kunst, Politik, Architektur. Überall wird nach dem Klaren, Eindeutigen, moralisch einfach zu Erklärenden, Alternativlosen gesucht.
Aber es ist nicht alles eindeutig. Und manchmal schlummern genau da, wo Vieldeutigkeiten angelegt sind, neue Erkenntnisdimensionen oder Zwischentöne, die die Welt komplex, facettenreich, interessant machen. Wenn man denn will, dass sie interessant und komplex bleibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. In Zeiten von Cancel Culture, Flüchtlingsangst, politisierter Engführung von Kunstbetrachtung, neuen Grenzkontrollen und wechselseitigen Corona-Fundamentalismen hat man es heute lieber einfach.