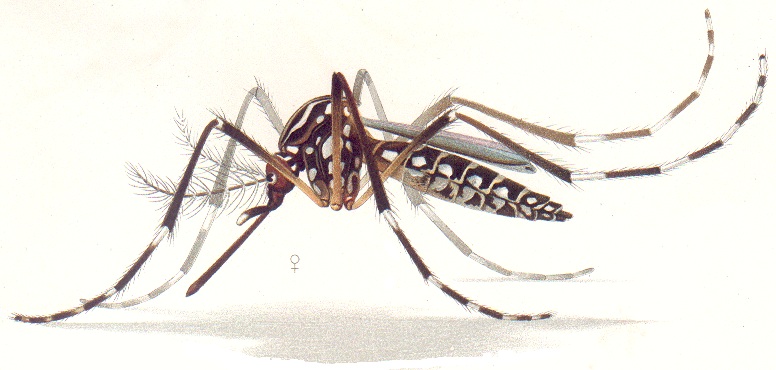Müde. Alt. Gewinner.
Was dem gewählten Präsidenten der USA in vielen Kommentaren als Schwäche ausgelegt wird, dürfte in Wahrheit ein Grund für seinen Wahlsieg gewesen sein. Sein Alter, seine Erfahrung und sein Mangel an jugendlicher Radikalität überzeugten konservative weiße Wechselwähler.
Die Stimmen der US-Präsidentschaftswahl waren noch lange nicht ausgezählt, da konstatierte Rieke Havertz in der „Zeit“ bereits das „Desaster der Demokraten“. Sie hätten nicht mehr das Zeug, Wahlen zu gewinnen. Daran sei nicht Donald Trump schuld, sondern der „schwache Kandidat“ Joe Biden. Die Partei sei mutlos auf Nummer Sicher gegangen, indem sie auf die Mitte zielte, statt mehr jugendliche Radikalität zu wagen und sich zum Beispiel deutlicher gegen Rassismus und Polizeigewalt zu positionieren.
Derlei Kommentare gab es einige zu lesen in den vergangenen Wochen. Sie zeugen von einer beeindruckenden Nichtbeachtung und Unkenntnis des Wahlverhaltens der Amerikaner und bestätigen, dass Trump keine Chance gehabt hätte, wenn in deutschen Redaktionen über die US-Präsidentschaft abgestimmt worden wäre. Am selben Tag wie der Zeit-Artikel erschien im Branchenmagazin „Journalist“ das Ergebnis einer Umfrage unter den Volontären der Öffentlich-Rechtlichen: 57 Prozent würden bei einer Bundestagswahl die Grünen wählen, mehr als 23 Prozent die Linke. Rot-Rot-Grün erhielte zusammen mehr als 92 Prozent.
Nun besteht das Wahlvolk in den USA aber nicht aus deutschen Nachwuchsjournalisten. Und die Ergebnisse legten bereits am Wahlabend nahe, dass mehr Radikalität und eine stärkere Betonung von Antirassismus, Gender- und anderen Lieblingsthemen links-progressiver Identitätspolitik den Demokraten keinesfalls geholfen hätte.
Was nützen noch drei Prozent mehr in Kalifornien?
Anders als häufig zu lesen ist, besteht Trumps Wählerschaft nicht allein aus weißen alten Männer, Rassisten, Frauenhassern, Homo- und Transphoben usw. Nicht nur, dass der Noch-Präsident mehr als 70 Millionen Stimmen erhielt, er überzeugte auch mehr Wähler aus Minderheiten als 2016. Zwar hat Biden insgesamt bei den Minderheiten klar gewonnen, aber Trump legte bei schwarzen Frauen (+4 Prozentpunkte), schwarzen Männern (+5), Latinas (+3) und Latinos (+4) zu. Bei Homosexuellen soll er seine Stimmen sogar verdoppelt haben. Tatsächlich schnitt Trump bei allen Wählergruppen besser ab als 2016 – außer bei den weißen (und speziell den alten) Männern.
In Florida haben ihm die Stimmen antikommunistischer Latinos den Sieg gesichert. In Texas haben viele aus Mexiko stammende Wähler dazu beigetragen, dass er den Staat halten konnte. Laut einer Umfrage der Bürgerrechtsorganisation „UnidosUS“ und der Meinungsforscher von „Latino Decisions“ sind für die meisten Latinos in den USA eben nicht Antirassismus und Immigration, sondern Jobs und die Wirtschaft die wichtigsten politischen Themen. Soll man etwa glauben, diese Leute hätten nicht für Trump gestimmt, wenn der Kandidat der Demokraten linker und radikaler aufgetreten wäre?
Ein solcher Kandidat hätte vermutlich eine höhere Zustimmung in Kalifornien oder New York erhalten. Nur gingen diese Staaten ohnehin schon mit überwältigender Mehrheit an die Demokraten. Auf die Zahl der Wahlleute, die am 14. Dezember den neuen Präsidenten wählen, hätte es keinen Einfluss gehabt, wenn in Washington D.C. 96 statt 93 Prozent der Wähler für den Demokraten gestimmt hätten.
Kosmopoliten gegen Höhlenmenschen
Wohl aber stellt sich die Frage, ob es einem strammen Linken gelungen wäre, die konservativen Wechselwähler in Arizona, Wisconsin oder Pennsylvania zu überzeugen, die Biden dort zum Sieg verholfen haben. Wie David Brooks in einem Kommentar für die „New York Times“ anmerkt, ist die Wahl nicht wegen Bidens ausgesprochen populären Programms so knapp ausgefallen, sondern weil die Demokraten eine „kulturelle blaue Wand errichtet haben, die eine Hälfte der Nation aussperrt“. Die Progressiven hätten das Land geteilt in aufgeklärte Kosmopoliten (sprich: Demokraten), die die entstehende diverse, postindustrielle Welt begrüßten, und rassistische Höhlenmenschen (Republikaner). Zum Glück – auch für seine Partei – ist Biden kein Vertreter dieser kulturkämpferischen Strömung der Demokraten.
Während des Wahlkampfs hat er sich dem Druck, weiter nach links zu rücken, widersetzt. Auf die Forderungen, den Obersten Gerichtshof so lange mit progressiven Richtern aufzufüllen, bis diese wieder die Mehrheit haben, hat er sich nicht eingelassen. Stattdessen schlug er vor, die Frage in einer überparteilichen Kommission besprechen zu lassen – eine diplomatische Version von „lasst mich damit in Ruhe“. Als Trump ihn im TV-Duell damit köderte, er könne als typischer Linker angesichts der Aufstände in amerikanischen Städten nicht die Worte „Recht und Ordnung“ aussprechen, antwortete Biden souverän, er stehe für Recht, Ordnung und Gerechtigkeit und vermittelte damit, dass er sich keinesfalls den Radikalen in seiner Partei anschloss, die sich für massive Einsparungen bei der Polizei einsetzen. Bei einer Rede in Pittsburgh distanzierte er sich klar und deutlich von gewalttätigen Demonstrationen: „Plündern ist kein Protest“.
Ja, Biden ist alt – und er wirkt etwas müde. Aber wahrscheinlich ist genau das seine Stärke in einem Amerika, das seit 2008 mehr als genug politische Visionen und stürmisches Charisma erlebt hat. Er ist ein Vertreter einer vergangenen, weniger sektiererisch aufgeladenen Zeit, als noch über Parteigrenzen hinweg kooperiert wurde. Kein kämpferischer Ideologe, sondern ein Politiker der Moderation, der als Senator auch für einen republikanischen Haushalt stimmen konnte, wenn dieser das Staatsbudget kürzte. Er steht für Erfahrung und nüchterne Gelassenheit. Zudem ist er als Symbol menschlicher Anständigkeit das Gegenbild zu Donald Trump. Aufgrund seiner leidvollen Biografie vermittelte er authentische Einfühlsamkeit an die Corona-geplagten Nation.
Ein anständiger älterer Herr als Präsident verspricht den Amerikanern nach den Chaostagen der Trump-Ära ein paar Jahre, in denen sie sich nicht ständig damit beschäftigen müssen, was im Weißen Haus geschieht. Weil Politik endlich wieder so solide und unspektakulär wird, dass man nicht für eine permanente Revolution mobilisiert werden muss und sich ruhigen Gewissens dem eigenen Alltag zuwenden kann.
Dieser Artikel ist in einer anderen Fassung zuerst in der Kolumne „Kaufmanns Konter“ in der Braunschweiger Zeitung erschienen.