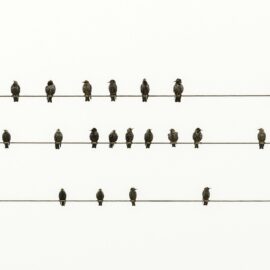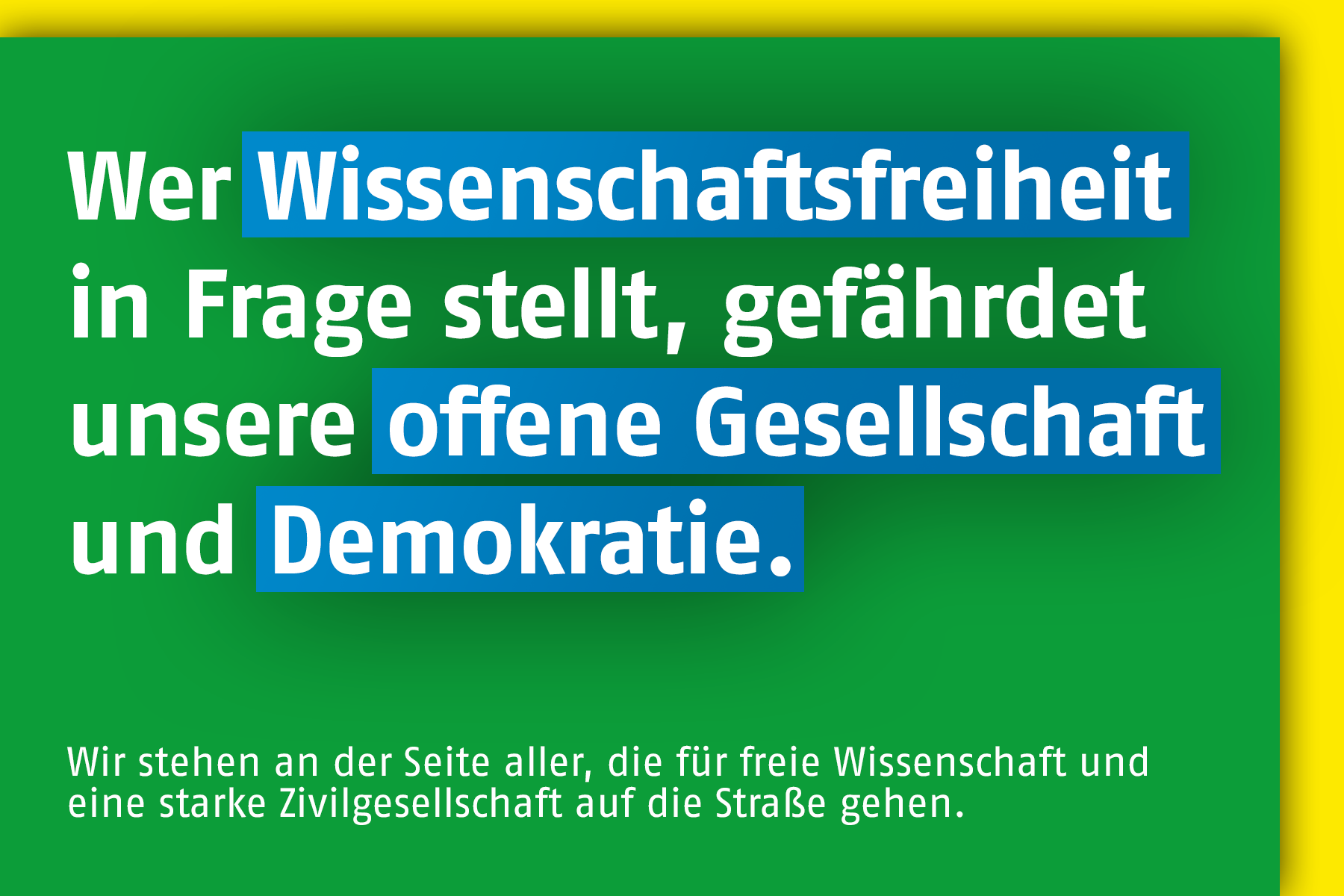„Naturnah ist nicht gleich artenreich“
Bienensterben, Insektensterben, Artensterben– die Berichterstattung über Biodiversität hat in den Medien in den letzten Jahren apokalyptische Züge angenommen. Fest steht: Die Artenvielfalt ist weltweit bedroht. Doch dass Naturschutz nicht automatisch mit Artenschutz einhergeht, erklärt Prof. Dr. Werner Kunz von der Universität Düsseldorf im Interview.
Herr Kunz, Ihre These ist, dass unsere Landschaft verbuscht, dass es zu viel Wald gibt und dass das den Offenlandarten das Leben schwermacht. Durch die drei letzten trockenen Sommer gibt es bei uns massive Waldschäden. Hier bei uns in Nordhessen mussten ganze Hänge mit Fichten wegen des Borkenkäfers abgeholzt werden, aber auch Buchenwälder. Wenn man jetzt Ihrer Prämisse folgt, müsste man daraus schließen, dass das für die Artenvielfalt auch eine Chance sein kann?
Ja, selbstverständlich. Man muss immer stark unterscheiden zwischen Naturschutz und Artenschutz. Selbst das viel beklagte Waldsterben in den 90er Jahren hat den Artenreichtum eher befördert. Denn wenn Sie die kahlen Schneisen und Flächen in den Höhenlagen des Schwarzwaldes und des Erzgebirges ansehen, die durch das Waldsterben entstanden sind, dann waren das für Spechte Paradiese. Die haben gewaltig profitiert vom Waldsterben. Die meisten Eulen- und Spechtarten sind so häufig wie nie, denn wir haben reichlich Wald in Deutschland. Wir hatten wahrscheinlich seit rund tausend Jahren nicht so viele Kleiber wie heute. Es gibt aber auch Waldarten, die vom Artenschwund betroffen sind, etwa das Haselhuhn. Was braucht denn das Haselhuhn? Das Haselhuhn braucht lückige Mittelwälder wie die letzten Vorkommen an der Ahr, die heute verschwunden sind. Der Hauptgrund dafür, dass das Haselhuhn in Mitteleuropa ausstirbt, ist, dass es hier kaum noch Mittelwälder gibt – lückige, niedrige Wälder mit Etagen. Wir haben dichte, dunkle Hochwälder. Die bringen vielen Insekten- und Vogelarten sehr wenig. Auch der Grauspecht ist selten geworden, das ist ein Bewohner der Lichtwälder, nicht der Dunkelwälder. Oder der Auerhahn: Was frisst denn der Auerhahn? Beeren. – Sie finden doch im Dunkelwald keine Beeren! Es gibt auch eine Reihe von Schmetterlingen, Tagfalter, die Waldbewohner sind, der bekannteste ist der Kaisermantel. Der vielleicht typischste Waldschmetterling überhaupt ist Boloria euphrosyne [Silberfleck-Perlmutterfalter, Anm. d. Red.], die waren früher an vielen Stellen häufig und sind heute weitestgehend verschwunden. Gerade in dem sonst noch schmetterlingsreichen Saarland gehen diese Waldschmetterlinge zurück, weil es kaum noch Lichtwälder gibt.
Also müssen uns die kahlen Hänge nicht beunruhigen?
Nein, müssen sie nicht, im Gegenteil: Wenn Vogelschutzverbände gegen Kahlschläge wettern, dann wettern sie gegen einige aussterbende Arten.
Mehr Wald bedeutet nicht mehr Artenschutz
Was wäre denn für Sie eine Konsequenz? Es wird jetzt massiv wieder aufgeforstet – schon aus Gründen des Klimaschutzes, weil man unbedingt CO2 aus der Atmosphäre holen will. Und es gibt Förderprogramme für die Wiederaufforstung: Wie würden Sie das beurteilen?
Im selben Tenor: Es ist ohne Frage, dass der Wald ein wirksamer CO2-Schlucker ist. Aus Gründen des Umweltschutzes brauchen wir den Wald, das ist aber nicht automatisch auch Artenschutz. Die Aufforstung ist einer der ersten Gründe für den Artenschwund in Mitteleuropa.
Kann man denn die Baumsorten vielfältiger wählen? Waldbewirtschafter wollen heute sowieso weg vom Jahrgangswald und lieber mehrere Altersgruppen auf einer Fläche haben, schon um das Risiko zu streuen. Wir wissen ja nicht, was kommt mit dem Klimawandel. Wenn man generell mehr Vielfalt reinbringt, wäre das auch eine Chance für die Artenvielfalt? Kann man das gleich mitberücksichtigen?
Diese Frage kann man nicht einfach mit „ja“ oder „nein“ beantworten, aber mir fallen da zwei Beispiele ein. Grundsätzlich ist Vielfalt zu begrüßen. Es kommt jedoch auf das Spezifische an: Zum Beispiel ist die Buche relativ artenarm in Mitteleuropa. Wenn sie die Biodiversität, etwa den Käferreichtum, einer Buche mit dem einer Eiche vergleichen, da hat die Eiche zehnmal mehr. Mit Beginn der Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren wurden riesige Flächen gerodet. Nach zehn Jahren etwa wurden die Flächen wieder verlassen, weil die Böden ausgelaugt waren und die Menschen damals keine Düngung kannten. Dadurch haben auch die wenigen Menschen nach und nach ausgedehnte Flächen gerodet. Und auf den allein gelassenen Flächen hat die Buche ihre Chance bekommen, weil die Eiche viel langsamer ist und die Flächen nicht beschatten konnte. Buchenwälder sind somit in Mitteleuropa keine Urwälder, sondern menschengemacht. Die Buche konnte sich durchsetzen. Für den Naturschützer ist das, weil die Buche ein besonders starkes romantisches Momentum hat, zu begrüßen, aber nicht für den Artenreichtum, da brauchen wir mehr Eichenwälder.
Und das Zweite: Für den Artenschutz gilt das populäre Prinzip, „naturnahe“ Bäume zu bevorzugen – also Bäume, die dort ursprünglich wachsen, ohne dass der Mensch sie eingeführt hat –, nicht immer. Fichtenwälder etwa sind hier im westlichen Flachland ortsfremd und das gilt genauso für die Kiefer, die auf Sandflächen angewiesen ist. Ein Beispiel: Es gibt einen Satyriden, einen Augenfalter mit Artnamen Erebia aethiops [Graubindiger Mohrenfalter, Anm. d. Red.], der kam in NRW vor 50 Jahren an vielen Stellen vor. Heute gibt es ihn nur noch an einer Stelle in der Eifel und an ein oder zwei Stellen im Sauerland. Dieser Falter braucht die Kiefer – nicht als Raupenfutterpflanze, die Raupen fressen Gräser. Der Falter hält sich auf Kahlflächen auf und, wenn es mittags heiß wird, muss er sich zurückziehen in die benachbarten Kiefernwälder. Wenn man jetzt die Kiefer, wie das ein eifriger Naturschützer fordert: „Weg mit der Kiefer und her mit dem Mischwald“, rodet, dann entzieht man dieser Art den Lebensraum. Ein strenger Naturschutz ist nicht automatisch auch Artenschutz. Und das ist meine Hauptkritik: Diese Irreführung der Bevölkerung – zum Teil auch durch die großen Naturschutzverbände – da heißt es oft: „Wir brauchen Naturnähe und ursprüngliche Naturwälder“, aber auf diese Weise kann ich nicht alle gefährdeten Arten retten. Naturnah ist nicht gleich artenreich.
Weihnachtsbaumkulturen – gut für Insekten
Sie haben die Weihnachtsbaumkulturen im Sauerland in Ihren Beiträgen lobend erwähnt, dass das für bestimmte Arten förderlich ist, obwohl man natürlich erst denkt: Das sind doch Monokulturen!
Natürlich ist das eine Monokultur, allerdings auf begrenzten Flächen. Dass Monokulturen schlecht sind, da halte ich dran fest. Entscheidend ist in diesem Fall aber, dass die Bäume lückig gepflanzt werden. Für Weihnachtsbäume müssen sich die Pflanzen in alle Richtungen entfalten können. Sie werden lückig angebaut und dazwischen wird viel karge Offenfläche – zum Teil nackte Erde – gehalten und das ist es, was uns fehlt. Insekten hatten in ihrem Artenreichtum und auch in ihrer Individuen-Abundanz ihren Höhepunkt in der Mitte des 19. Jahrhundert. Da damals schon Insektenfunde dokumentiert worden sind, kann man das sagen. Das ist das Ende der kleinen Eiszeit. Das scheint bereits ein logischer Widerspruch zu sein: Ein wärmeliebendes Tier hat seinen Höhepunkt in der kleinen Eiszeit? Was brauchen denn die Insekten, insbesondere die Schmetterlinge? Die brauchen Quadratmeter, die sich beim ersten Sonnenschein sofort schnell aufheizen. Und dazu brauchen sie offene Erde, Steine, Kies, Sand und keine Grasbedeckung. Und dazu brauchen sie keinen Schatten und dazu brauchen sie am besten auch eine schräge Ebene, denn dort erwärmen die Sonnenstrahlen die Erde schneller. Daher haben wir Schmetterlinge mehr im Gebirge als im Flachland. Wir haben zwar heute – selbstverständlich, da zweifelt ja niemand dran – ein Global Warming, aber was die Quadratmeter in den Mini-Ökologie-Gebieten angeht, da haben wir eindeutig ein „Cooling“ gegenüber früheren Jahrhunderten.
Weil der Aufwuchs so üppig ist?
Ja, weil alles zugewachsen und damit kühl und feucht ist.
Wie wirkt sich denn der Klimawandel an sich aus? Gibt es da auch positive Effekte? Ein Beispiel: Ich lebe in Nordhessen und komme gebürtig aus dem Münsterland. Ich kenne aus meiner Kindheit keine Taubenschwänzchen, aber hier sehe ich die jetzt jeden Sommer.
Das ist ein gutes Beispiel Es gibt einige Klimagewinner, aber ich sage bewusst „einige“. Es ist erstaunlich wenig angesichts der Macht der Klimaerwärmung, die wir seit 30 bis 40 Jahren haben.
Dann ist der Klimawandel für einige Arten förderlich, davon hört man in der öffentlichen Debatte kaum etwas. Wie kann das sein?
Der Naturschutz hat leider einen großen Nachteil, gerade in Deutschland. Da steckt was typisch Deutsches drin: Es wird alles zu ideologisch und zu religiös angegangen. Wenn da jemand Kritik am Naturschutz erhebt, ist er gleich einer, der den Naturschutz gar nicht will. Alles wird tabuisiert. Und ich kann nur unseren Düsseldorfer Philosophen Dieter Birnbacher zitieren: „What is a tabu? A tabu is a discussion stopper.“ Der Anhänger eines Tabus will keine Diskussion und darunter leidet der deutsche Naturschutz. In den Niederlanden wird das oft pragmatischer gehandhabt: Die tragen in den Maas-Dünen auf 100 Hektar den gesamten Humus ab und haben wieder Heide. Währenddessen wird Ihnen bei uns bald Gewalt angetan, wenn Sie einen Baum fällen wollen.
Weniger Hecke ist mehr
Wir haben hier jedes Frühjahr die Diskussion – auch in den Tageszeitungen –ausgefochten, dass den Menschen die Hecken im Feld zu weit heruntergeschnitten werden. Schon das Heckenschneiden sorgt für Debatten, jedes Jahr aufs Neue …
Dabei sind Hecken im Offenland nicht immer gut für die Artenvielfalt. Der Kiebitz etwa ist ein sogenannter Kulissenflüchter, der meidet vertikale Strukturen und benötigt ein gut einsehbares Areal für seine Brutplätze. Der Kiebitz meidet Landschaft mit Hecken.
Es ist auch nicht immer gut, Büsche einfach wachsen zu lassen. Es gibt einen gut untersuchten Schmetterling, was seine Biotop-Ansprüche angeht. Das ist der Kreuzdorn-Zipfelfalter mit Artnamen Satyrium spini. Der ist in Nordrhein-Westfalen bis auf das Diemeltal seit rund 20 Jahren ausgestorben. Von dem Osnabrücker Ökologen Thomas Fartmann ist das Diemeltal gut untersucht worden. Spini braucht als Raupenfutterpflanze Kreuzdorn. Kreuzdorn ist in Deutschland relativ weit verbreitet, wenn man den äußeren Norden rausnimmt, und ein typischer Strauch der sonnenexponierten Trockenhänge. Es gibt rund 80 Lebensraumtypen in Deutschland mit Kreuzdorn, aber nur ganz wenige, wo Spini lebt, also braucht er was anderes als nur den Kreuzdorn. Fartmann und sein Team haben herausgefunden, dass Spini nur dann auf einen Kreuzdorn-Trockenhang vorkommt, wenn die Kreuzdorn-Büsche einen bestimmten Mindestabstand zueinander haben und wenn die Sträucher eine Höhe von etwa 1,20 Metern nicht überschreiten, sonst ist der Kreuzdorn-Falter weg. Das ist Artenschutz und nicht dieses Geschwärme nach unberührter Natur.
Also manchmal ist weniger Hecke mehr?
Auf jeden Fall: Deutschland wächst zu! Das ist einer der Hauptgründe des Artenschwundes. Wir dürfen niemals Deutschland – oder vielleicht besser gesagt: Mitteleuropa – mit den Regenwäldern Südamerikas vergleichen. Selbstverständlich beklagt man die Vernichtung der Regenwälder in Brasilien und in Südostasien, aber das ist nicht Mitteleuropa. Es gab in Bonn einmal eine internationale Artenschutztagung, bei der der damalige Umweltminister Sigmar Gabriel bei einer Freilandveranstaltung einen Baum gepflanzt hat nach dem Motto: „Wenn wir was für den Artenschutz tun müssen, müssen wir einen Baum pflanzen.“ Das ist für Brasilien richtig, aber für Deutschland ist es falsch.
Deutschland ist Einwanderungsland
Warum ist das falsch?
Es gibt einen großen Unterschied, den machen sich die meisten Menschen gar nicht klar: In Mitteleuropa haben wir etwa fünf Eiszeiten hinter uns. Je nach Ort werden auch 4 oder 6 Eiszeiten gezählt. Das hat zwar die übrige Nordhalbkugel auch, aber diese Eiszeiten haben in Mitteleuropa einen größeren Schaden angerichtet als auf dem Rest der Nordhalbkugel, weil die Tiere nicht nach Süden ausweichen konnten. Die Pyrenäen, Alpen und Karpaten standen quer. Das ist mir erst vor kurzer Zeit so richtig klar geworden, als ich mal einen Vortrag über die Bäume des Kaukasus gehört habe. Der Redner hat berichtet, dort gäbe es circa fünf Buchenarten und rund zehn Eichenarten. Und was gibt es bei uns? Wirklich verbreitet sind nur eine Buchenart und zwei Eichenarten. Wenn Sie die Wälder des Kaukasus mit denen Mitteleuropas vergleichen, dann sind die Wälder Mitteleuropas grundsätzlich artenarm, weil die Eiszeit alles vernichtet hat. Die meisten Menschen haben von der Eiszeit eine falsche Vorstellung: Es wurde immer kälter, da sind die Individuen halt abgewandert, und dann wird‘s wieder wärmer, dann sind sie wieder eingewandert. Aber das Kommen einer Eiszeit hat eher einen Artenschwund bewirkt als ein Artenfliehen. Denn die Prozesse haben Jahrtausende gedauert. Es ist nur um einen Bruchteil eines Grades von Jahr zu Jahr kälter geworden. Da ist natürlich nichts gestorben und auch nichts geflohen, sondern die haben sich ganz allmählich nicht mehr so stark fortgepflanzt. Wir hatten zum Ende des Tertiärs eine reiche Fauna und Flora in Mitteleuropa. Die meisten Arten waren älter als zwei Millionen Jahre, denn so schnell entstehen neue Arten nicht. Und diese Arten, die vor zwei Millionen Jahren hier in Mitteleuropa gelebt haben, die sind weg, die gibt es nicht mehr. Das sieht man heute daran, dass wir in Mitteleuropa kaum endemische Arten haben. Es gibt kaum einen endemischen Tagfalter und auch kaum einen endemischen Vogel in Mitteleuropa. Wenn Sie die IUCN-Liste [„IUCN“ steht für „International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species“, Anm. d. Red.] lesen und nach Arten der höchsten Alarmstufe suchen mit der Aufforderung an die Nation zur Erhaltung dieser Arten, dann finden sie in Mitteleuropa fast keine Arten, die nur in Mitteleuropa und sonst nirgends vorkommen. Wir haben hier die Randzone von Arten, die ihr Kernvorkommen woanders haben.
Der Rotmilan?
Auf dieses Beispiel habe ich jetzt gewartet! Der Rotmilan hat seine größte Individuenzahl in Deutschland und das sind etwas mehr als 50 Prozent. Und die übrigen rund 45 Prozent haben wir in Süd- und Westeuropa. Zugespitzt: Wenn Sie heute alle Vögel, alle Individuen Deutschlands töten würden, dann würden Sie keine einzige Vogelart in ihrem Fortbestand als Art gefährden. – Weil die in anderen Teilen der Welt auch noch vorkommen, und das gilt für andere Teile der Welt eben nicht.
Dort gibt es bestimmte Vögel eben nur da?
Es ist so: In der letzten Warmzeit, also seit 10.000 Jahren, Holozän, sind Arten aus Fremdländern eingewandert. Sie sind vor allem aus dem Osten, Süden und Norden eingewandert. Für den Norden haben wir ein schönes Beispiel, nämlich das Birkhuhn. Ich selbst kenne das Birkhuhn aus den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren aus der Gegend von Diepholz noch als häufigen Vogel. Wenn wir als Fünfzehnjährige mit den Fahrrädern am ersten Mai morgens um drei Uhr losfuhren, dann konnten wir sowohl im Emsland als auch im Diepholzer Gebiet in Gegenden fahren, wo aus allen Himmelsrichtungen das Kullern der Birkenhähne zu hören war. Ähnlich war es im Alpenvorland, z.B. im Wurzacher Ried. Dort sind heute die Birkhühner fast zu 100 Prozent verschwunden. Birkhühner kommen im deutschen Flachland nur noch auf Truppenübungsplätzen vor. Jäger haben im Voralpenland versucht, Birkhühner wieder anzusiedeln – ich glaube, rund 500 Stück übern Daumen gepeilt, aus Skandinavien importiert und dort ausgesetzt, das war vor etwa 25 bis 30 Jahren – mit dem Ergebnis, dass die nach drei Jahren alle weg waren. Es gibt ähnliche Beispiele – etwa mit dem Goldenen Scheckenfalter – diese Aussetzungen haben meist keinen Sinn. Denn es hat ja seinen Grund, warum die Tiere nicht mehr da sind, nämlich weil der Biotop nicht mehr stimmt, dann hat es auch keinen Zweck, die Tiere in den falschen Biotop auszusetzen. Aber jetzt kommen natürlich wieder die lauten Einwände: „Ja, die Jogger, die laufen durch die Moore und vertreiben die Birkhühner“ oder „Die Gifte, die Gifte, die Gifte!“ Aber in Skandinavien und auch bei uns in Deutschland, an der Baumgrenze – etwa 2000 Meter hoch im Allgäu: Da sind die Birkhühner häufig. Das Birkhuhn ist ein Vogel der Übergangszone zwischen Taiga und Tundra. Und wir hatten hier Jahrtausende lang Übergangszone zwischen Taiga und Tundra und die haben wir heute nicht mehr, ganz klar, dass wir keine Birkhühner mehr haben – bzw. nur auf den Truppenübungsplätzen.
Zusammengefasst: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die meisten Arten Deutschlands haben einen Migrationshintergrund.
Neben dem Paradebeispiel Birkhuhn könnte ich auch den Goldregenpfeifer nennen, der ebenso wie das Birkhuhn aus dem Norden gekommen ist. Der Goldregenpfeifer ist ein Bewohner der Fjells, also dieser sanften Hänge, die wenig bewachsen sind. Hier bei uns wird der Goldregenpfeifer als Vogel der Hochmoore gepriesen, zum Beispiel in dem Buch „Naturland Deutschland“ von Hans Bibelriether. Schon der Titel stört mich, denn wir haben keine „Naturländer“ in Deutschland. Der Autor preist in diesem Buch die ursprünglichen Hochmoore. Was sind die ursprünglichen Hochmoore? Ich kenne sie zum Teil noch. Das sind nasse Sphagnum-Flächen, Torfmoos. Da kann kein Goldregenpfeifer brüten und leben, der kann da ja gar nicht rennen, und jeder Regenpfeifer rennt. Der Goldregenpfeifer ist ein Gewinner der Moor-Entwässerung. Denn als die Moore entwässert wurden in Holland, Nordwest-Deutschland und Schleswig-Holstein, da sind die nassen Sphagnum-Flächen mit dem Bulten und Schlenken verschwunden und trockene Heideflächen entstanden, und das war der Ideal-Biotop. In den letzten Jahrzehnten, als es immer noch ein paar Exemplare als Brutvögel in der Nähe von Hannover gab, habe ich eine Publikation gefunden, die feststellte, dass der Goldregenpfeifer stets in der in der Nähe der Bagger brütete, weil dort das ideale Sukzessionsstadium für ihn war. Im Westen des Münsterlandes bei Borken bis hinein nach Holland ist der Goldregenpfeifer vor rund 200 Jahren ein häufiger Brutvogel gewesen, weil dort viele Schafweiden waren, also von wegen „Bewohner ursprünglicher Hochmoore“.
Hungersnöte sorgen für Artenreichtum
Beim Stichwort „Migrationshintergrund“ stellt sich mir die Frage, wenn wir von „heimischen Arten“ reden, welche Zeitscheibe, nehmen wir denn da? Und warum ist die eine besser als die andere? Das lässt sich doch kaum begründen.
Bisher habe ich nur postglaziale Einwanderer aus dem Norden genannt, jetzt kommen wir zum Osten. Der Osten war auch während der Eiszeit zu großen Teilen ein Steppenland. Ich habe mal Nachforschungen gemacht, wo während der Eiszeit eigentlich dunkle Hochwälder waren, die wir heute hier kriegen würden, wenn wir – wieder Zitat Bibelriether: „Natur Natur sein lassen“. Wo waren dunkle Hochwälder in unserer Umgebung während der Eiszeiten? Da gab es einige – das beste Beispiel ist die Gegend westlich der Alpen im Gebiet des Rhonetals – aber insgesamt ist das wenig gewesen. Viele Tiere, die wir heute in Deutschland haben, kommen aus dem Süden, Marokko zum Beispiel, und viele kommen aus dem Osten, da waren lichte Wälder oder auch Steppen, da waren keine Hochwälder, und das sind unsere heutigen Arten. Der Hase kommt aus dem Osten, die Lerche kommt aus dem Osten. Nicht zu vergessen: Die Großtrappe kommt aus dem Osten, das sind Steppentiere. Oder ganze Gruppen: Der Pieper, die Gattung Anthus, umfasst etwa sechs Arten in Deutschland. Das sind Offenlandbewohner. Selbst der Baumpieper, der kommt nur auf Lichtungen vor, und nicht in geschlossenen Wäldern.
Oder der Feldhamster: Das ist immer so ein klassisches Beispiel, auch ein Tier, das nicht im Wald vorkommt?
Ja, natürlich. Oder die Lerche: Die Haubenlerche ist ein Steinhalbwüstenvogel und aus dem Süden eingewandert. Ich war Fahrschüler und bin zum Gymnasium mit dem Zug gefahren. Da habe ich immer morgens auf dem großen Bahnhof gestanden. Da waren viele Haubenlerchen. Heute sind die in Nordrhein-Westfalen bis auf vielleicht eine einzige Stelle ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Es sind Vögel der Halbwüste. Die Feldlerche ist ein Vogel der Steppe, Heidelerche ein Vogel der Kahlschläge. Oder Grauammern – das sind doch alles keine Vögel des Waldes. Grauammern gibt es heute in NRW nur noch auf den Flächen des Braunkohleabbaus, sonst nirgends mehr. Genauso: Steinschmätzer oder Ortolan. In meiner Kindheit in der Nähe von Osnabrück, wenn ich dort mit dem Fahrrad gefahren bin, an den Straßen, überall war der Ortolan zu hören. Die Art ist fast vollständig weg aus dem ehemaligen Westdeutschland, bis auf ein paar im Nordosten, z.B. in Lüchow-Dannenberg. Es sind keine spärlich bewachsenen Ackerflächen mehr da. Ich habe den Ortolan jetzt in Polen studiert, dort kommt er noch dort vor, wo die Roggenäcker quadratmeterweise keinen einzigen Getreidehalm tragen. Solche Äcker brauchen wir. Wir können den Ackervögeln, also Ortolan und Rebhuhn, nur dann Lebensraum bieten, wenn wir Äcker unterhalten, die so lückig und spärlich sind, dass wir uns davon nicht mehr ernähren können.
So war das nämlich vor 150 Jahren. Hungersnöte waren die Ursachen des Vogelreichtums. Ich wiederhole: Hungersnöte waren die Ursache unseres Vogelreichtums auf den Agrarflächen.
Fortsetzung folgt
Das Interview führte Gastautorin Susanne Günther


Professor Dr. Werner Kunz ist von Haus aus Zoologe und hat wissenschaftlich an Drosophila und dem Humanparasiten Schistosoma gearbeitet. Zurzeit arbeitet er wissenschaftstheoretisch über den Artbegriff und die theoretischen Grundlagen des Natur- und Artenschutzes. Kunz ist Tierfotograph mit weltweiten Artenkenntnissen, besonders über Vögel und Schmetterlinge. Er ist ein gefragter Referent. Seine Gedanken zum Thema Artenschutz hat er in dem Buch „Artenschutz durch Habitatmanagement – Der Mythos der unberührten Natur“ zusammengetragen, das 2017 im Verlag WILEY-VCH erschienen ist (ISBN 978-3-527-34240-2).