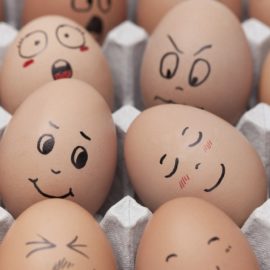Plötzlich warst Du da
Unsere Autorin bekam vor sechs Jahren überraschenden und unangenehmen Besuch. Die Angst wurde zu ihrem Dauerbegleiter. Zunächst war sie überfordert, doch dann hat sie den Umgang mit ihr gelernt und sich so zurück in die Freiheit gekämpft.
Plötzlich warst du da. Wir trafen uns in der S1 Richtung Nikolassee. Unsere erste Begegnung werde ich niemals vergessen. Ich zitterte am ganzen Körper. Meine Hände waren nass von dem kalten Schweiß, der mich überkam. Mein Herzschlag wurde immer schneller, meine Atmung unruhiger, mein Blick in einem Tunnel gefangen. Ich spürte Schwindel, mir wurde heiß und kalt, der Mund trocken. Ich hatte keine Erklärung dafür, wie du schafftest, solche Reaktionen in meinem Körper hervorzurufen. Einfach so. Aus dem Nichts. Nur eine S-Bahn-Station hielt ich diese körperliche Achterbahnfahrt aus, bevor ich ausstieg, zu rennen begann und den schnellsten Weg nach Hause suchte. Nach ein paar Minuten hatte ich dich abgehängt, dich hinter mir gelassen und fand zu meiner inneren Ruhe zurück.
Du jedoch warst hartnäckig. Schon am nächsten Morgen kamst du zurück. Dieses Mal trafen wir uns in meinem Schlafzimmer. Ich wollte diese Begegnung nicht. Ich wehrte mich gegen das, was du mir körperlich antatest. Wollte es nicht zulassen, wollte stärker sein als du, wollte, dass meine Psyche standhafter ist – als sie es letztendlich war. Denn unsere zweite Begegnung fiel heftiger aus als die erste. Am Ende musste ich erneut die Flucht ergreifen. Aus meiner eigenen Wohnung. Einfach rennen, halb angezogen, halb noch im Pyjama, lief ich so schnell ich konnte durch Neukölln bis ich dich wieder abgehängt hatte und zur Ruhe kam.
Plötzlich warst du also da. Seit unserer zweiten Begegnung wusste ich, dass du so schnell nicht wieder gehen würdest. Du würdest da bleiben, bei mir, ganz nah, mich nicht wieder loslassen, einfach immer da sein, mich vollkommen kontrollieren, meine Gedanken manipulieren, keine klaren Gedanken mehr fassen lassen, nicht mehr zulassen, dass ich mein Leben weiterführe wie bisher, nicht mehr ermöglichen, mir auch nur ein normales Leben vorzustellen, mir verbieten mich daran zu erinnern, wie es noch kürzlich gewesen war, du würdest dafür sorgen, dass sich viele meiner Freunde von mir abwenden und mir dann sagen, dass sie vielleicht nicht die richtigen Freunde waren, du würdest auch dafür sorgen, dass mein bester Freund mein Leben mitlebte, statt seines zu leben, du würdest verursachen, dass ich es nicht mehr schaffe, auch nur drei Sekunden alleine zu sein. Ich konnte auch nicht mehr alleine sein, denn ich hatte alles auf dich ausgerichtet. Du warst diejenige, die mein Leben bis ins Detail bestimmte.
Dafür hasste ich dich
Die Tage vergingen, aus ihnen wurden Wochen und daraus Monate. Nach außen schien alles gleich wie zuvor, doch innen war alles anders. Und nichts mehr wie es war. Ich schämte mich zutiefst für das, was du täglich mit mir machtest. Denn ich war nicht mehr ich, seitdem du in mein Leben getreten warst. Und dafür hasste ich dich. Hasste es, dass ich es zugelassen hatte, dass du daraus auch nicht mehr verschwinden würdest. Denn ich machte alles, um zu vertuschen, dass es dich gibt und somit gewöhnte ich mich so sehr an dich, dass ein Leben ohne dich selbst für mich nicht mehr vorstellbar schien. Ich begann zu lügen. Für dich. Hätte es eine olympische Disziplin darin gegeben, Geschichten so zu stricken, dass am Ende alle daran Beteiligten nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, so hätte ich das Siegertreppchen für mich gehabt. Alles nur, um einen Hauch von Kontrolle über mein Leben zu haben.
Ich merkte, wie um mich herum niemand mehr da war, der mich verstand. Ich versuchte zu erklären, immer und immer wieder, versuchte in Worte zu fassen, wie viel stärker du warst und wie wenig Kraft ich hatte gegen dich anzukämpfen. Natürlich tat ich es trotzdem, ich holte mir sogar professionelle Hilfe, machte alles, was man mir empfahl. Doch nichts schien zu helfen. Jeden Tag versuchte ich, alleine zu sein. Mit meinen Gedanken, mit mir. Doch ich schaffte es einfach nicht. Es vergingen keine fünf Minuten, bis du plötzlich aus dem Nichts auftauchtest und es mir unmöglich machtest, es alleine zu bewältigen. In meinem Gehirn manifestierte sich die Gewissheit, dass immer dann, wenn ich alleine bin, du kommen und mich nicht loslassen würdest, bis ich – durchdrehe.
Du nahmst mir alles, was ich an meinem Leben liebte: Meine unbeschwerte Freude, meine Abenteuerlust, das Reisen, meine Leichtigkeit, meine Zuversicht, meinen Glauben an mich, meine Freunde, den Job, meinen Alltag, meine Spontaneität, allen voran meine Freiheit. Es gab Zeiten, da zweifelte ich stark daran, ob es jemals wieder werden würde, wie es einmal war. Oder zumindest annähernd so. Du machtest es mir nicht leicht, auch nur einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels zu sehen. Doch dennoch kämpfte ich. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Morgen wachte ich mit Zuversicht auf, dass der heutige Tag ein besserer als der vergangene sein würde. Und es kamen bessere Tage. Häppchenweise. Selten. Aber es gab sie. Aus ihnen schöpfte ich Kraft und so gab es wieder Situationen in meinem Leben, die ich ganz alleine meisterte. Auch wenn das nur bedeutete, alleine zum nächsten Supermarkt zu gehen. Ich war stolz, dass ich es schaffte, dass du mir wenigstens dort nicht begegnetest.
Doch du bliebst da. Ein Teil von dir begleitet mich bis heute, Jahre später. Jedoch hasse ich dich nicht mehr dafür. Heute weiß ich auch, dass wir uns früher oder später hätten begegnen müssen. Also, biete ich dir lieber eine Tasse Tee an, frage dich, wie lange du bleiben möchtest, anstatt mich gegen dich zu stemmen. Ich lasse dich zu, lasse zu, dass meine körperlichen Funktionen verrückt spielen, weil ich weiß, dass es nichts bringt, dagegen anzukämpfen. Denn ich muss immer wieder lernen, dass ich nicht daran sterben werde, wenn du wieder bei mir bist und du mich vollkommen kontrollierst, sondern, dass ich daran wachsen werde, wenn ich es einfach zulasse, dir begegne, dich akzeptiere und dann wieder gehen lasse. So habe ich in unseren gemeinsamen Jahren gelernt mit dir zu leben.
Angst
Angsterkrankungen und Panikattacken sind keine Seltenheit in westlichen Ländern. Besonders in Großstädten leiden viele Menschen darunter. Doch die wenigsten sprechen über sie. So wie ich es lange Zeit nicht getan habe. Das Schamgefühl ist zu groß. Wer will schon gerne zugeben, dass er durchdreht, nur weil er fünf Minuten alleine in der Wohnung aushalten muss? Oder alleine mit der Bahn fahren, arbeiten, zur Uni gehen? Angsterkrankungen sind tückisch und können jeden treffen. Niemand kann etwas dafür – wenn wir die Folgen mancher Drogen ausschließen. Meine erste Panikattacke hatte ich im Frühling 2012. Ein Jahr zuvor war mein Vater verstorben, die letzten Jahre hatte ich durchweg zu viel gearbeitet, die Uni nebenher geschmissen, viel gefeiert, kaum geschlafen, war rastlos, wollte niemals Stillstand, war komplett auf mich allein gestellt, hatte den Tod meines Vaters und alles damit Zusammenhängende einfach verdrängt. Doch die Rechnung dafür kam. Und zwar geballt. Denn jeder Mensch hat nur ein bestimmtes Maß an Stress, das er aushalten kann. Das kann man sich vorstellen wie ein mit Wasser gefülltes Glas. Bei manchen Menschen ist das Glas von Geburt an voller als bei anderen – sie haben also nicht mehr viel Puffer, bis das Fass überläuft. Manch anderer erträgt mehr, schafft mehr, kann mehr stemmen. Dafür können wir alle nichts, niemand hat es sich ausgesucht. Es ist nur gut, seine eigenen Grenzen zu kennen. Ich kannte sie lange nicht.
Nachdem ich meine ersten Panikattacken hatte und sich danach die Angst in mir festigte, nichts mehr alleine machen zu können, ja, quasi nichts mehr alleine machen zu dürfen, stellte ich mein Leben um und richtete alles auf die Angst aus. Ich ging nicht mehr zu Uni, sondern schrieb nur noch die Klausuren mit, während jemand vor der Tür auf mich wartete. Ich suchte mir Jobs, wo ich nur dann arbeitete, wenn ich garantieren konnte, dass jemand, den ich gut kannte, in meiner Nähe war. Teilweise wartete ich stundenlang vor den Arbeitsorten meiner Freunde, weil ich nicht alleine zu Hause sein konnte. Ich hielt es zeitweise keine Minute alleine aus. Warum ich meine Angst auf das Alleinsein projizierte, habe ich bis heute nicht verstanden. Noch konnte es mir jemand erklären. Vielleicht, weil ich schon immer für alles im Leben alleine kämpfen musste, immer alles alleine stemmte, ohne jemals Hilfe zu erfahren oder auch danach zu fragen? Kann sein. Doch es hätte auch eine Angst vor geschlossenen Räumen sein können, denn Angsterkrankungen sind diffus und mitunter nicht immer zu erklären.
Als ich schon monatelang an meiner Angsterkrankung litt, gab es diesen einen, sehr viel verändernden Moment. Nachdem ich meine erste von insgesamt zwei Therapien abgeschlossen hatte, versuchte ich jeden Tag aufs Neue alleine mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Uni zu fahren. Und jeden Tag war ich enttäuscht, weil ich es dann doch nicht schaffte und jemanden bitten musste, mich zu begleiten. Doch dann kam dieser eine Tag, an dem ich mir sagte: „Deana, heute schaffst du es!“ Wieder packte ich morgens meine Tasche, trug mein Rad vier Stockwerke hinunter und dieses Mal setzte ich mich wirklich darauf und fuhr zu Arbeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so glücklich und stolz auf mich gewesen bin.
Freiheit
Ich hatte ein Stück Freiheit wiedererlangt. An diesem Tag erhielt ich einen Zettel von jemandem, der mir sagte, dass er unglaublich stolz auf mich sei. Den Zettel trage ich bis heute täglich in meinem Geldbeutel mit mir.
Natürlich wissen Menschen mit solchen Krankheitsbildern, dass ihre Ängste unbegründet, ja, teilweise fast schon lächerlich erscheinen. Doch das Wissen darüber, dass mir eigentlich nichts passieren kann, wenn ich alleine in der U-Bahn sitze, schützt mich nicht davor, dass mein Gehirn diese Situation über die Jahre hinweg als Gefahr fest eingestuft und verankert hat. Denn genau das passiert: Wir projizieren unsere Ängste plötzlich auf Situationen, von denen eigentlich keine Gefahr ausgeht – wie das Fliegen. Und weil wir genau diese Situationen teilweise über Jahre hinweg meiden, aus Angst vor der Angst, glaubt unser Gehirn auch irgendwann fest daran, dass unsere imaginierten Ängste gerechtfertigt sind. Genau das ist das Problem: Wir haben Angst, dass die Angst, die wir irgendwann einmal erfahren haben – so wie ich das erste Mal in der S-Bahn – wieder zurückkommt. Auch dann, wenn sie seit Jahren nicht mehr ausgebrochen ist. Es ist die Angst vor der Angst, die das Problem ist, mag das alles noch so absurd erscheinen aus Sicht gesunder Menschen. Denn die Symptome, die sich in einer solch vermeintlichen Gefahrensituation äußern, sind real: Der Schüttelfrost, das Herzrasen, die schweißnassen Hände, die Schnappatmung, die Lähmungserscheinungen, der Tunnelblick, der Schwindel – all das findet in diesen Momenten statt und hält uns Kranke davon ab, bestimmte Herausforderungen zu meistern. Oft schon, bevor sie anstehen. Und sei es auch nur eine U-Bahnfahrt. Stunden, Tage, manche Kranke machen sich sogar Wochen vor Angstsituationen Gedanken darüber, wie sie damit umgehen sollen, wenn der Tag kommt. Meist planen sie diese Tage minutiös, überlegen sich Ablenkungsmanöver oder springen am Ende doch kurz vorher ab. So wie ich selbst unzählige Male in verschiedensten Momenten.
In meiner zweiten und letzten Therapie habe ich jedoch eine Sache gelernt: Angst lässt sich nur überwinden, wenn man ihr begegnet. Man muss sie sogar zulassen, sie aushalten. Nur dann lernt das Gehirn irgendwann einmal, dass von diesen Situationen keine Gefahr ausgeht. So wie Menschen, die sich vor Spinnen fürchten, auch nur dann lernen, diese Tiere in ihrer Gegenwart zu akzeptieren, wenn sie etwas Zeit in einem Raum mit ihnen verbringen oder Vogelspinnen streicheln. Seither frage ich mich in allen mir schwerfallenden Momenten: Was würdet du tun, wenn du keine Angst hättest? Und genauso handele ich dann. Ja, es gibt auch heute, Jahre später noch, unzählige Situationen, die ich eigentlich lieber meiden würde, denen ich mich jedoch trotzdem stelle. Damit konnte ich mir meine Freiheit peu à peu zurückerobern. Es gibt immer noch ein Stück Weg zu gehen, aber das macht mir keine unüberwindbare Angst mehr.
Wenn ich heute Menschen in der Bahn gegenübersitze, auf der Straße an ihnen vorbeilaufe, sie beobachte, stelle ich mir vor, wie wir alle täglich mit unseren unterschiedlichsten Ängsten zu kämpfen haben. Bei manch einem begründet, bei manch anderem weniger, aber immer gleichermaßen berechtigt. Ich bin vorsichtig geworden, vorschnell zu urteilen, sensibel, wenn es um psychische Krankheiten geht und würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen trauen, offen über Angsterkrankungen und andere psychische Leiden zu reden. Am Ende des Tages sind wir alle ein Produkt unserer Umwelt, die wir uns mitunter nicht immer selbst ausgesucht haben. Deshalb steht für mich Verständnis für andere und ihre Probleme beim täglichen Umgang miteinander an erster Stelle.
Ich danke dem Menschen von Herzen, der lange Zeit für mich mein Leben mitgelebt hat. Ohne ihn, wäre ich durchgedreht. Du weißt, dass du gemeint bist.