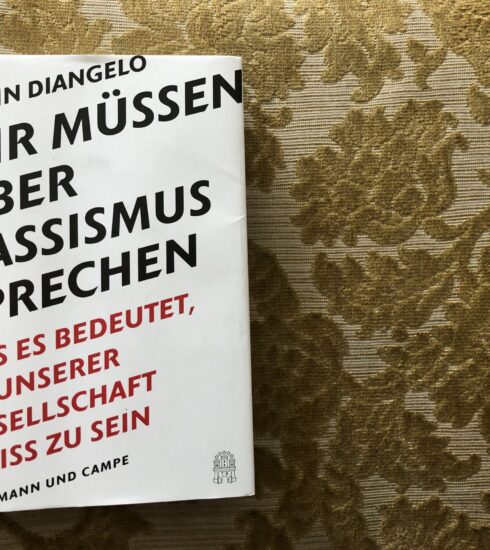Der schöne Schein der Stabilität
Das vordergründig gute Ergebnis der „Wahl“ in Russland dokumentiert die Schwäche des Regimes. Partner, mit denen Entspannung möglich wäre, stehen in Moskau bereits in den Startlöchern. Bemerkungen zum Herbst der Ära Putin.
Wer die Berichterstattung zum Wahltag in den russischen Medien verfolgte, dem blieben die zahlreichen Anleihen in der sowjetischen Vergangenheit nicht verborgen. Wie zu den Zeiten Breschnews ging es nicht darum, dass die Bevölkerung eine politische Wahl zu treffen hat. Im Gegenteil: sowohl die Regierung als auch die Bürger wußten, dass das Ergebnis bereits lange vorher festgelegt wurde. Putins Sieg war genauso unvermeidlich wie der sibirische Winter. Diese sogenannte Präsidentschaftswahl ist nur die Akklamation einer Entscheidung, die im Kreml getroffen wurde. So hält es die russische Elite bereits seit dem Jahr 2000 – nichts ist ihr so fremd wie Wahlen, deren Ergebnis nicht vorher festgelegt wurde. Doch wie in der Sowjetunion ist die Führung mittlerweile nicht mehr nur mit der mehr oder weniger freiwilligen Stimmabgabe für den Kandidaten der Macht zufrieden. Sonntag sollte die russische Bevölkerung nicht nur ihre Loyalität zu Staat und Machthaber, sondern auch ihre Dankbarkeit und Freude über die bestehende Ordnung zur Schau stellen. Deshalb wurde rund um die Wahllokale Volksfeststimmung inszeniert – inklusive post-sowjetischem Ethnokitsch wie kaukasischen Tänzen und selbstverständlich mit subventionierten Brosamen für die Armen, die als Belohnung etwas für ihren leeren Kühlschrank aus dem Wahllokal mitnehmen konnten. Neben Inszenierung und Bestechung traten zudem die „administrativen Maßnahmen“, die ergriffen wurden, um Ergebnis und Beteiligung zu erreichen (vulgo Wahlbetrug). Im Nachrichtenkanal „Rossija24“ berichteten Korrespondenten über Stunden aus allen Teilen des Landes von enthusiastischer Stimmung und dem geordneten Ablauf der Abstimmung. Gelegentlich durfte ein Bürger vor die Kamera treten, der eilfertig versicherte, was für eine Ehre es sei, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Ein russischer Kollege hat mir vor einigen Wochen geschildert, wie er persönlich gegenüber seiner Universität die eigene Stimmabgabe per SMS dokumentieren muss. Seine Erfahrung lässt sich wohl im Großen und Ganzen auf die Millionen von Beschäftigten des Staatsapparates übertragen. Als international angesehener Wissenschaftler empfindet er dies als Demütigung, die nichts über seine eigenen politischen Ansichten verrät. Sein Beispiel zeigt: Der Wahltag war ein Ritual der Unterwerfung. Trotz jahrelanger wirtschaftlicher Misere und dem fortschreitenden Verfall öffentlicher Institutionen soll Wladimir Putin sein bestes Wahlergebnis erzielt haben. Schon wähnen ihn manche Beobachter im Westen als stärker und beliebter als zuvor. Doch was sagen die offiziellen 76,6 Prozent für Putin tatsächlich über dessen Popularität aus? Die Antwort lautet: nichts. Ein solches Ergebnis ist in demokratischen Wahlen unmöglich. Natürlich verfügt Putin aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs zu Beginn seiner Amtszeit, der Unterwerfung der Massenmedien und auch wegen der Annexion der Krim 2014 über eine beträchtliche Basis von Unterstützern. Doch das Ergebnis einer Wahl, zu der starke Gegenkandidaten nicht zugelassen sind und die unter solch kafkaesken Umständen abläuft, ist kein ZDF-Politbarometer. Es gibt lediglich Aufschluss darüber, wieweit der russische Staat die Gesellschaft kontrolliert. Selbst diejenigen, die Putin in Moskau feiern, wissen das.
Potemkinscher Sonntag
Dennoch lohnt es sich, über diesen Potemkinschen Sonntag nachzudenken. Der Wahltag verrät uns zwar wenig über die Stimmung in der russischen Gesellschaft. Doch das bestellte Ergebnis enthält eine Botschaft des Kremls an die Russen und das Ausland: Putin ist populär und deshalb ist das Regime stabil. Bei genauerem Hinsehen sind jedoch starke Zweifel an dieser Aussage angebracht. Ein unumstrittener Präsident oder ein populärer Machthaber, der sich seiner Sache sicher sein kann, hätte weder die Repressionen im Vorfeld noch die Manipulation während der Wahl nötig gehabt. Ihm hätte auch ein realistischeres Wahlergebnis als die absurden Dreiviertel der Stimmen genügt, um seine Legitimität zu erneuern. Bei Lichte betrachtet veranschaulicht der gestrige Tag nicht die Popularität des Präsidenten, sondern die Schwäche seines Regimes. Da ihm noch nicht einmal mehr (pseudo-)demokratische Ressourcen in genügenden Umfang zur Verfügung stehen, ist der Kreml ganz auf seine sowjetischen Urinstinke zurückgeworfen. Inszenierung und Repression ersetzen politischen Wettbewerb. Und deshalb wurden wir Zeugen eines absurden Spektakels, das nicht den Höhepunkt der Beliebtheit, sondern eher den Anfang vom Ende einer Ära bedeutet. Peak-Putin liegt hinter uns, Post-Putin ist die Zukunft. Was wir in den russischen Medien sehen ist nur der schöne Schein der Stabilität.
Bereits im Sommer 2017 raunten Moskauer Insider und solche, die es gerne wären, dass der Präsident amtsmüde sei. Dennoch trat Putin 2018 für weitere sechs Amtsjahre an. Da er nach seinem eigenem Politikverständnis keine Schwäche zeigen darf, hatte er auch keine andere Wahl. Er folgte seinem Überlebensinstinkt. Russland kennt keine Nachfolgeregelung für seine Autokraten. Durch sein Handeln hat er sich selbst zum Präsidenten auf Lebenszeit gemacht. Trotzdem ist Putin im Herbst seiner Macht angekommen. In Russland fehlt ihm ein politisches Projekt. Das bedeutet auch, dass der eskalierende Konflikt Russlands mit dem Westen zunehmend sein ganz persönlicher Konflikt ist. Er dient der eigenen Machtsicherung und lenkt davon ab, dass Putin seine innenpolitischen Ziele verfehlt hat. Weder wirtschaftlich noch politisch, weder sozial noch kulturell gelang hier eine nachhaltige Erneuerung des Landes. Hinter der martialischen Fassade einer Großmacht versteckt sich das Scheitern des Autokraten. Es wird die Aufgabe seines Nachfolgers sein, sich den großen Herausforderungen zu stellen, die vor Russland stehen. Mit Wladimir Putin gehören die nächsten sechs Jahre noch einmal der letzten sowjetisch geprägten Generation. Er hat das Land in die Sackgasse geführt und Kriege begonnen, die er weder gewinnen noch beenden kann. Was nach ihm kommt, ist ungewiss.
Eine Repluralisierung wird kommen
Putins Regime kann der Westen nur mit Abschreckung und Eindämmung entgegentreten. Es ist zwar schwach, doch es handelt schnell und skrupellos. Die letzten Jahre und die vergangenen Wochen haben das zur Genüge gezeigt. Dennoch sollte uns die Wiederwahl Putins daran erinnern, die russische Gesellschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Gestern haben sich Alexei Nawalny und Xenia Sobtschak vor laufenden Kameras darüber gestritten, ob Reformen in Russland durch politischen Widerstand oder durch Teilhabe am herrschenden System zu erreichen sind. Das war die eigentlich spannende politische Frage dieses eintönigen Wahltages. Subkutan wächst in Russland die Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Teile der Eliten haben durchaus Interesse an außenpolitischer Entspannung, größerer Rechtsstaatlichkeit und Berechenbarkeit staatlichen Handelns. Auf die extreme Zentralisierung der Gegenwart, in der nur eine Person und ihre Entourage die Politik bestimmen, wird eine Repluralisierung folgen. Längst formiert sich in Russland eine Koalition derjenigen, die der Meinung sind, dass sich etwas ändern muss. Hier gibt es potentielle Partner, die Europa im Auge behalten sollte. Sie sind interessanter als die triste Gegenwart einer Autokratie, deren Stärken Propaganda und Gewalt sind.
Deutschland und Europa sind weder auf die konkrete Eindämmung des Putinregimes noch auf die strategische Diskussion über Russland und Osteuropa nach Putin genügend vorbereitet. Sigmar Gabriels Amtszeit war eine Verlängerung des ostpolitischen Dornröschenschlafs. Die Kanzlerin selbst agiert auf diesem Feld nicht, sie reagiert nur. Ihr Desinteresse eröffnet jedoch Handlungsräume für das Auswärtige Amt unter neuer Führung. Denn eins ist im Frühjahr 2018 klar: die Zeit des Krisenmanagements („Minsk“) ist endgültig vorbei, nun gilt es zu handeln und Strategien für die Zukunft zu entwerfen. Es wäre ein kluger Schachzug von Heiko Maas, gemeinsam mit Frankreich ostpolitische Leitlinien zu entwerfen. Wenn Paris und Berlin gegenüber Moskau mit einer Stimme sprächen, könnten sie einiges erreichen. Ein gemeinsames Magnitsky-Gesetz, ein weitgehender Boykott der WM und das Ende von „NordStream2“ wären mutige Schritte zur Eindämmung des russischen Einflusses, von denen Europa profitieren würde. Es liegt in unserer Hand, Zeichen zu setzen und unsere Sicherheit zu erhöhen. Zugleich dürfen wir nicht die Möglichkeit versäumen, uns auf ein Post-Putin-Russland vorzubereiten. Es könnte schneller kommen als das Wahlergebnis vom Sonntag suggeriert. Bereits heute gilt es, Angebote zu formulieren und Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Denn nach Putin wird es Chancen für Dialog und Verständigung geben. Bis dahin sind Entschlossenheit und Durchhaltevermögen notwendig.