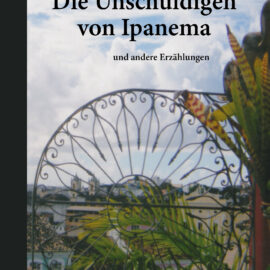Antisemitismus ist keine Variante des Rassismus
Versperrt der Holocaust in Deutschland den Blick auf die Verbrechen des Kolonialismus? Was im ersten Moment schlüssig klingt und das Feuilleton beschäftigt, ist bei näherer Betrachtung nicht weniger als die Relativierung der Shoah.
In einem Beitrag in der „Zeit“ haben der Historiker Jürgen Zimmerer und der Literaturwissenschaftler Michael Rothberg geschrieben, dass es in der Diskussion um die Singularität des Holocaust vor allem um die Abwehr einer Debatte über die kolonialen Verbrechen gehe. Das ist aus vielen Gründen falsch.
Es war abzusehen, dass mit der deutschsprachigen Veröffentlichung des 2009 erschienenen Rothberg-Buchs „Multidirektionale Erinnerung“ die bereits im Sommer vergangenen Jahres begonnene Debatte um Postkolonialimus erneut an Schwung gewinnen würde. Damals wurde gefordert, dass der in Südafrika arbeitende und lebende Kameruner Historiker und Philosoph Achille Mbembe nicht die Eröffnungsrede des Kulturfestivals Ruhrtriennale halten sollte, weil er mehrfach als Unterstützer der antisemitischen BDS-Kampagne in Erscheinung getreten war, deren Ziel die Vernichtung Israels durch einen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Boykott ist. Der Bundestag, viele Landtage und Stadträte hatten in den Jahren zuvor beschlossen, BDS-Anhängern keine Räume zur Verfügung zu stellen. Letztendlich blieb die Frage, ob Mbembe ausgeladen werden würde, offen, da die Ruhrtriennale wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.
Verdecke koloniale Verbrechen
Die Diskussion über Mbembes Unterstützung der BDS-Kampagne, die sowohl er selbst als auch die damalige Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp lange leugneten, entwickelte sich zu einer Debatte um die Singularität des Holocausts und die Frage, inwieweit die Erinnerung und Beschäftigung mit der Shoah die Sicht auf die kolonialen Verbrechen Deutschlands verdecken würde. In diesem „Historikerstreit 2.0“ wurde Rothbergs Buch oft zitiert. Darin plädiert er dafür, die Erinnerung an den Holocaust mit der an andere Verbrechen, vor allem die des Kolonialismus, zu verbinden. Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann sagte dazu in der „Welt“, dass Erinnern „kein Nullsummenspiel“ sei: „Rothberg wendet sich mit seinem Konzept gegen eine Form der Erinnerung, die eine Opfererfahrung gegen die andere aufrechnet und damit auslöscht. Das geschieht regelmäßig, wenn eine Opfergeschichte politisch instrumentalisiert wird.“
In dem Beitrag von Rothberg und Zimmerer in der „Zeit“ geht es genau darum: Wird die Erinnerung an den Holocaust instrumentalisiert, um der Beschäftigung mit anderen, vor allem kolonialen, Verbrechen Deutschlands aus dem Weg zu gehen? Zimmerer hat in seinem Buch „Von Windhuk nach Auschwitz?“ zwar nicht die Behauptung eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem 1904 begangenen Genozid an den Hereros und dem Holocaust aufgestellt, sah aber in den „nationalsozialistischen Kriegszielen wie auch in den Methoden der Kriegsführung“ eine Tradition, die in den Kolonialkriegen ihren Ursprung hatte. Ganz richtig ist das nicht: Von Trotha, der Kommandierende der Kolonialtruppen in Südwest, stand in einer von Helmuth von Moltke begründeten Tradition der rücksichtslosen Bekämpfung von Truppen, die als Freischärler und nicht als reguläre Armeen wahrgenommen wurden und die auch vor der Bevölkerung keinen Halt machte. Es zieht sich eine Linie von der Bekämpfung der Francs-tireurs im deutsch-französischen Krieg 1870/71 über den Kolonialkrieg gegen die Hereros und die Massakern an den belgischen Zivilisten 1914 bis zu der Bekämpfung realer oder angeblicher Partisanen und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Der Genozid an den Hereros war ein aus dem militärischen Scheitern von Trothas in der Schlacht am Waterberg hervorgehender Exzess, der sich zum Genozid steigerte. Grausam ohne Zweifel, doch den Weg nach Auschwitz hat sie nicht beschritten.
Stets gegen den Westen
In ihrem gemeinsamen Beitrag verurteilen Rothberg und Zimmerer den angeblich provinziellen deutschen Blick auf die eigene Geschichte, der auf den Holocaust fixiert sei. Sie sehen im Eroberungskrieg im Osten ab 1941 und seinem Ziel einer Besiedlung nach vorangegangener ethnischer Säuberung ein koloniales „Kontinuum“. Das zu leugnen sei fetischhaft und habe einen Grund: „Es geht um nicht weniger als die Abwehr einer Debatte über koloniale Verbrechen und damit verbunden um die unkritische Rettung einer europäischen Moderne, die Sicherung einer weißen, hegemonialen Position im Inneren und die dominierende Stellung des ‚Westens‘ nach außen.“
Nun denn.
Auch wenn die Erforschung der kolonialen Verbrechen Deutschlands nicht das Niveau anderer historischer Themen erreicht hat, sind die Geschehnisse weitgehend bekannt: Ob die Genozide an den Hereros und Namas im damaligen Deutsch-Südwest 1904, der Krieg gegen den Maji-Maji-Bewegung mit zwischen 75.000 und 300.000 Toten in den deutschen Kolonien in Ostafrika oder die Bekämpfung des Boxer-Aufstands in China mit vielen Tausend Opfern – die Geschichte der kolonialen Verbrechen liegt nicht im Dunklen. Aber einen herausragenden Platz im Geschichtsbewusstsein in Deutschland hat der Kolonialismus, im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien, nicht.
Mit dem Holocaust allerdings hat das nichts zu tun. Das deutsche Kolonialreich endete faktisch mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, nur eine Truppe um Paul von Lettow-Vorbeck zog marodierend durch Ostafrika und kapitulierte erst nach dem Ende des Krieges am 25. November 1918.
In der Bevölkerung kaum verankert
In der deutschen Bevölkerung des Kaiserreichs hatte sich nie einen tiefe Identität als Kolonialmacht etabliert. Einen Siedlungskolonialismus gab es nur im heutigen Namibia, und auch dort mit lediglich 15.000 Menschen auf niedrigem Niveau. Auch das Kaiserreich folgte wie andere Kolonialmächte dem Prinzip der indirekten Herrschaft und kooperierte, dabei Verträge brechend und mit der Androhung von Gewalt, mit lokalen Mächten. Die Truppen vor Ort bestanden zum größten Teil aus afrikanischen und arabischen Söldnern. Deutsch-Südwest war in dieser Beziehung eine Ausnahme.
Die Nachrichten aus den Kolonien sorgten immer wieder für Skandale, die im Reichstag von Abgeordneten von SPD und Zentrum angeprangert wurden. Kolonialisten wie Carl Peters, eine Mischung aus Gewaltverbrecher und Abenteurer, der seine afrikanische Geliebte wegen eines Seitensprungs erhängen ließ, wirkten auf weite Teile der Bevölkerung abstoßend. Trotz hoher Prämien war es schwer, Beamte für den Einsatz in den Kolonien zu finden. Es herrschte Bewerbermangel, wer auf seinen guten Ruf Wert legte, mied die Kolonien und strebte eine Karriere in Berlin an.
In den 20er Jahren gab es dann zwar in Deutschland eine Bewegung, die sich für die Rückeroberung der durch den Versailler Vertrag abgenommenen Kolonien einsetzte, aber jenseits eines gewissen wahlkämpferischen Opportunismus wollten nicht einmal die Nationalsozialisten die ehemaligen Gebiete in Asien, Afrika und Ozeanien zurück. Für Hitler eigneten sie sich schlicht nicht für die Besiedlung durch Weiße. Er folgte bei seinen Eroberungsplänen schon früh der jahrhundertealten deutschen Expansionstradition gen Osten, die vom Deutschen Orden im 13. Jahrhundert begründet wurde.
Aber es war nicht nur die eher geringe Bedeutung der Kolonien, die dafür sorgte, dass der deutsche Kolonialismus und seine Verbrechen im Bewusstsein der Öffentlichkeit nie einen herausragenden Platz einnahmen. Die in den Kolonien begangenen Verbrechen wurden und werden von anderen Ereignissen überdeckt: Der von Deutschland maßgeblich verursachte Erste Weltkrieg, die Revolution von 1918/19, die Inflation von 1923 und natürlich die nationalsozialistische Herrschaft, zu deren Folgen die Shoa ebenso gehört wie der Zweite Weltkrieg, nehmen mehr Raum in den Erinnerungen und der Geschichtsschreibung ein.
Der kurze Schatten von 1914
Die Leichenberge, die politischen, territorialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Ereignisse verdecken die Sicht auf alles, was vor 1914 geschah. Es ist bemerkenswert, dass Zimmerer und Rothberg sich bei ihrer Analyse nur auf die Shoah beziehen, denn deren realpolitische Auswirkungen auf die Politik der Bundesrepublik sind überschaubar: Die nahezu traumatische Erfahrung der Inflation von 1923 prägt von der „Schwarzen Null“ bis zur Ablehnung dauerhafter gemeinsamer europäischen Schulden die deutsche Finanzpolitik bis heute. Die tief verwurzelte Ablehnung des Militärs ist eine Konsequenz aus den beiden verheerenden militärischen Niederlagen mit Millionen Toten und zerstörten Städten des 20. Jahrhunderts. Die Angst vor instabilen politischen Verhältnissen, die sich bis heute auch in der Toleranz gegenüber autokratischen Regimen zeigt, hat ihre Wurzeln auch in der Revolution und der gescheiterten Weimarer Republik.
Die realpolitischen Folgen der Shoah waren und sind jenseits verbaler Beteuerungen, dass sich etwas nicht wiederholen dürfe und die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei, überschaubar: Schon die Debatte um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel war von der Sorge um wirtschaftliche Nachteile beim Handel mit arabischen Staaten geprägt. Die palästinensischen Mörder der israelischen Olympioniken 1972 wurden nach einer Flugzeugentführung freigelassen, und die Bundesrepublik stimmt regelmäßig in der UN für Verurteilung Israels und unterstützt Gruppen in Palästina mit, allermindestens, engen Kontakten zu Terroristen.
Nur eine Form von Rassismus
Bei der Kritik des angeblich alles dominierenden Gedenkens des Holocausts folgen Zimmerer und Rothberg also einer Darstellung, die in weiten Teilen Fiktion ist. Aber auch wenn der Holocaust für die praktische Politik keine allzu große Bedeutung hat, taugt er, um eine Debatte auszulösen: Nicht wenige wollen ihn endlich in eine Reihe mit anderen Verbrechen stellen und so seine Einzigartigkeit relativieren. Um diese Sicht zu verbreiten, ergreifen sie jede Gelegenheit. Ziel ist es, aus dem Antisemitismus eine Form des Rassismus zu machen – schlimm zwar und in seinen Auswirkungen ungeheuerlich, aber eben doch ein normaler Teil einer umfangreichen Gewaltgeschichte des Westens. Auch wenn Zimmerer und Rothberg ausdrücklich die Einzigartigkeit der Shoah nicht in Frage stellen, ist sie für beide ein historisches Ereignis unter vielen, das erinnerungspolitisch relevant ist und das es im Rahmen einer „multidirektionalen Erinnerung“ neu einzuordnen gilt.
Ein Grund, das zu wollen, sind die bereits erwähnten BDS-Beschlüsse. Sie haben bis heute leidlich gut verhindert, dass postmodern getarnte Antisemiten erfolgreich öffentliche Räume besetzen. Deswegen wird von ihnen die deutsche Erinnerungspolitik als provinziell geschmäht und die Antisemitismus-Definition der IHRA diskreditiert. Und Rothberg und Zimmerer sind die Stichwortgeber für Aleida Assmann, die „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“, Susan Neiman und wer sich sonst noch so alles in dieser Szene tummelt.
Dass dabei die Sorge um die mangelnde Anerkennung der Verbrechen des Kolonialismus im Zentrum steht, ist zweifelhaft. Rothberg und Zimmerer haben klar gemacht, worin sie das größte Problem sehen: „…die unkritische Rettung einer europäischen Moderne, die Sicherung einer weißen, hegemonialen Position im Inneren und die dominierende Stellung des ‚Westens‘ nach außen.“ Sowohl Shoah als auch Kolonialismus lassen sich für einen Angriff auf die von Anhängern der Postmoderne verachteten Aufklärung am besten instrumentalisieren. Es geht als nicht um Erinnerungspolitik, sondern um die Nutzung von Erinnerungspolitik, um den Westen und seine Grundlagen zu diskreditieren.
Auch dabei spielen Rassismus und die angebliche Sorge um den globalen Süden keine Rolle. Dass China auf Kosten afrikanischer Staaten eine neoimperiale Politik verfolgt, ist den Vorkämpfern einer Neuschreibung der Geschichte ebenso wenig eine Bemerkung wert wie die Tatsache, dass Menschen in Hongkong, Iran und Myanmar unter Lebensgefahr für die Umsetzung der Werte der Aufklärung kämpfen, die sie verächtlich machen und als rassistische Ideen alter, weißer Männer aus Kolonialstaaten brandmarken wollen.