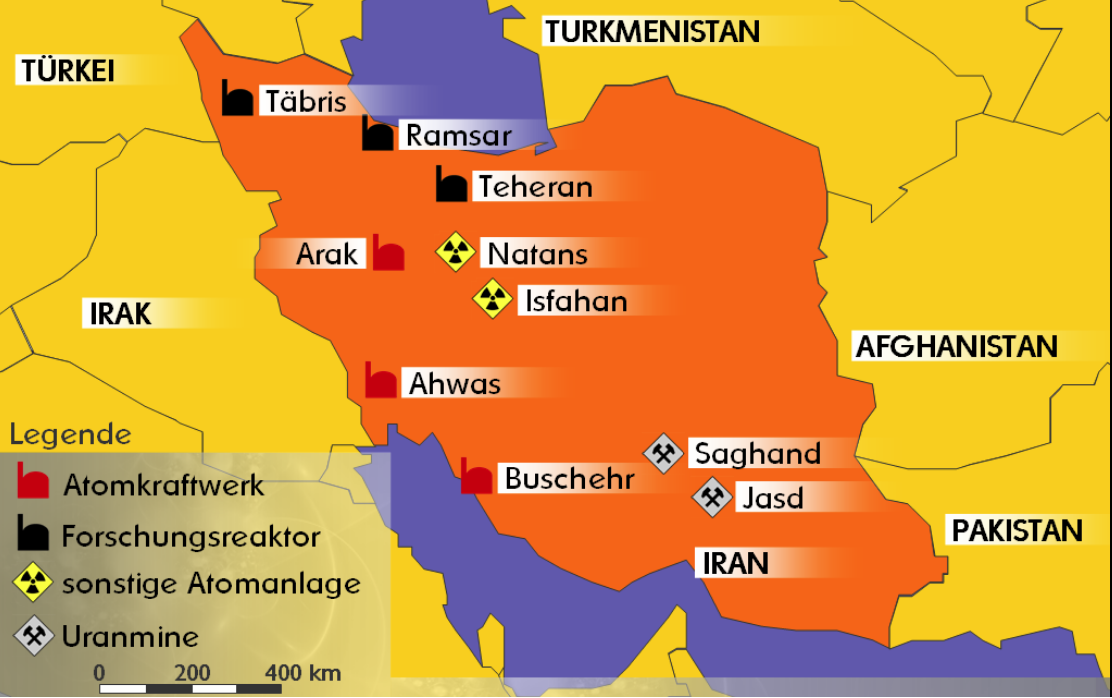Der letzte seiner Art
Die Literatur stirbt nicht – doch ihre großen Dichter. Mit Philip Roth geht einer von den Tragödienschreibern, die ihre fallenden Helden letztlich lieben. Ein Abschied.
Gute Bücher sind wie Meilensteine im Leben eines Lesers. Und ein Autor ist, wenn man ihn über eine lange Wegstrecke gelesen hat, ein Vertrauter, den man nicht kennt, und dessen Namen man doch nennen müsste, wenn man in einer intellektuellen oder seelischen Notlage nach dem nächsten Angehörigen gefragt würde.
Ich habe Philip Roths Bücher erst verhältnismäßig spät kennengelernt. Er hatte den Gipfel der Popularität schon erreicht, den der Verehrung eines breiten Publikums noch nicht. Das kam dann, als er vom eher Komödiantischen ins Tragödienfach wechselte – und was hier so salopp klingt, dem ist natürlich eine tiefe künstlerische Metamorphose vorausgegangen, deren Hintergründe wir nicht kennen (oder zumindest ich nicht). Vielleicht wollte er nur etwas anderes versuchen, und er tastete sich wie ein gewöhnlicher Mensch voran, der etwas Neues beginnt. Herausgekommen ist eine Reihe großer Werke, die manchmal schmal sind, aber von der ersten Zeile an das elementare Gewicht der nun folgenden Geschichte spüren lassen, ohne schwierig oder schwer zu sein.
Ja, Philip Roth hatte seine feste Lesergemeinde, und manchmal glaubte ich in Gesprächen zu erkennen, dass die Mitglieder dieses Kreises zwar treu, aber in gewisser Weise auch exklusiv waren. Anscheinend hielten sich die Austritte durch Tod und die Eintritte durch Neuentdeckung ungefähr die Waage. Mit mehr konnte man wohl auch nicht mehr rechnen, denn Philip Roth war zuletzt ein Unzeitgemäßer geworden. Ein Solitär, der männliche Helden männlich denken und sprechen ließ und in Konflikte versetzte, die mit männlichem Denken und Handeln zu tun hatten – nicht in der vitalistischen Art eines Hemingway oder wie die selbstbespiegelnde Timeline-Literatur eines Knausgard, sondern in der intellektuell-tragischen Art eines Ödipus oder Hamlet oder eben eines David Kepesh, jenen Fernsehkritiker, der in Das sterbende Tier den Widerstreit von Begehren und Verlust schmerzlich durchleben muss. Roths Helden durchleben in seinen Romanen eigentlich fast alle Formen der Lust: Obsessionen, Wollust, sexuelle Not, Liebe, Lüsternheit, Begierde. Das ist der Hauptstrom der Lebensenergie seiner Protagonisten. Aber wo Eros ist, da ist Thanatos nicht weit. Das wird mit den Jahren und den Romanen immer deutlicher.
Sein letzter Roman – eigentlich eine vollkommene Novelle – zeigt nicht nur Roths große formale Könnerschaft, sondern auch seinen durch keinen von Trost oder Hoffnung verklärten Blick auf das Dasein. Im Mittelpunkt steht Bucky Cantor, ein Sportlehrer mit einfachen lebensweltlichen Ambitionen, der während einer Polioepidemie in bester Absicht handelt und doch das Unglück für sich und andere herbeiführt. Es ist nicht jedermanns Sache, dieser Tragödie zu folgen. Aber man muss nicht selbst Ähnliches erfahren haben und sich in unserer Welt der Bilderflut und Gedankenenge nur ein wenig Vorstellungskraft erhalten haben, um trotz der Nüchternheit, mit der hier erzählt wird, das unsentimentale Mitleid des Autors für seinen fallenden Helden zu spüren und zu begreifen, das er von uns allen spricht, von unserer Existenz hienieden. Und so gerät das Buch am Ende ob des unabwendbaren Schicksals des Helden zu einer Abrechnung mit Gott. Danach konnte wirklich kein weiteres Buch mehr kommen.
Doch uns bleibt heute wie für morgen, eines seiner wunderbaren Bücher in die Hand zu nehmen (zum Beispiel Verschwörung gegen Amerika) – und einfach mit dem Lesen zu beginnen: „Angst beherrscht diese Erinnerungen, eine ständige Angst. Natürlich hat jede Kindheit ihre Schrecken, doch ich frage mich, ob ich als Kind nicht weniger Angst gehabt hätte, wenn Lindbergh nicht Präsident gewesen oder ich nicht das Kind von Juden gewesen wäre.“