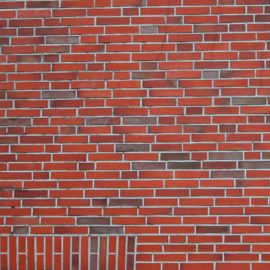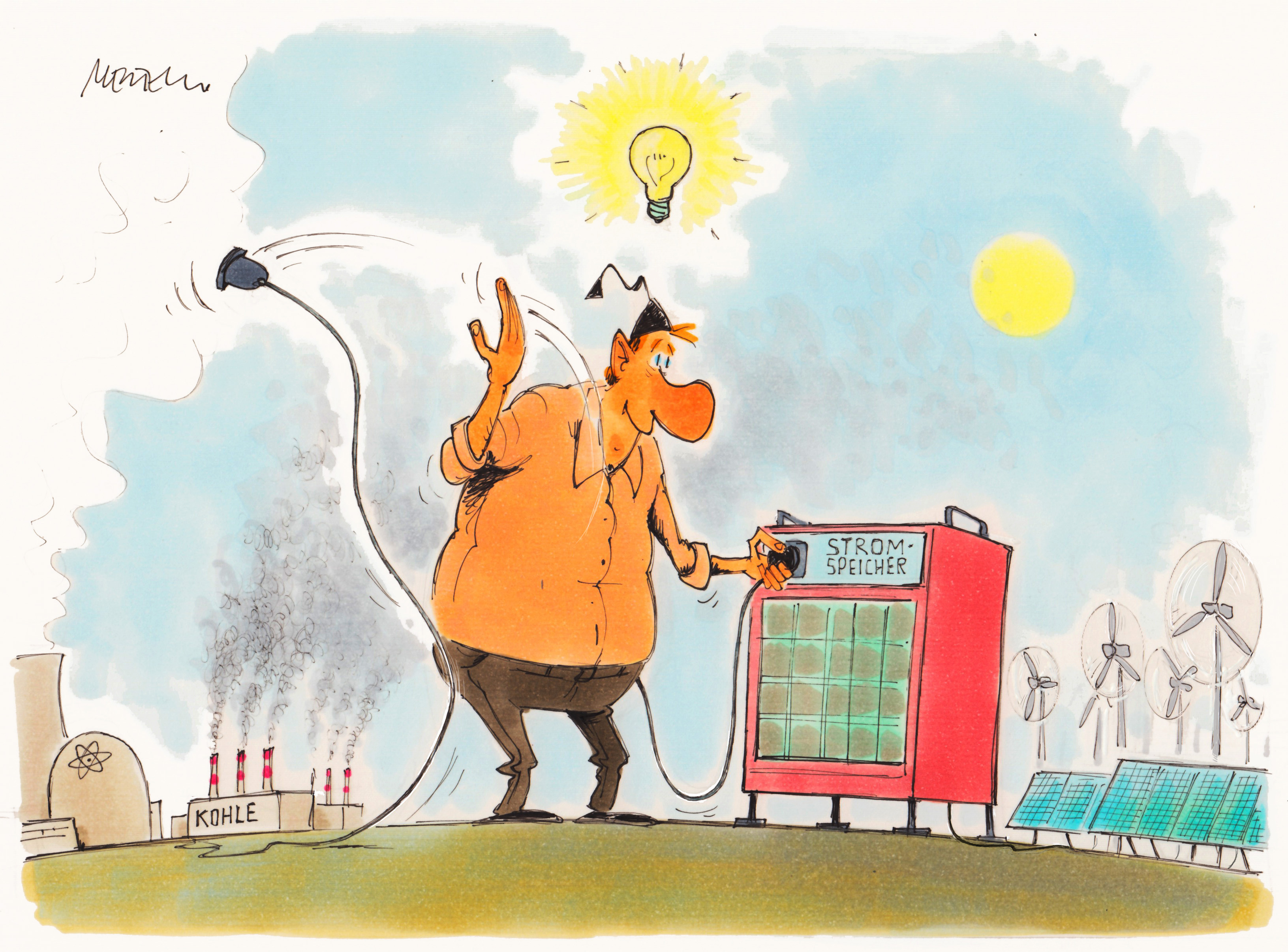27. Januar: Einmal Gedenken mit Israelkritik, aber bitte ohne Juden!
Gerne rühmt sich das offizielle Deutschland seiner Vergangenheitsbewältigung. Gleich nebenan treffen jedoch immer häufiger Israelkritiker und Freunde des Schlussstrichs aufeinander, die den Juden Auschwitz gleichermaßen schwer verzeihen können. Über Schuldabwehrspieler, professionelle Banalität und deutsche Entlastungsrituale.
Der 27. Januar ist ein guter Tag, um den Deutschen einmal zu gratulieren. Denn aus ihrer Geschichte haben sie nicht nur vieles gelernt. Tatsächlich lernen sie sogar von Tag zu Tag auch noch etwa dazu. Erst am vergangenen Montag bot sich hierzu erneut eine Gelegenheit. Zur besten Sendezeit, ab etwa 23 Uhr, konnte das historisch interessierte Publikum sich gleich an zwei Dokumentationen erfreuen, die die „deutsch-jüdische Symbiose“ tangieren. Der Film „Hitlers letzte Mordgehilfen?“ gewährte Einblicke in die Arbeit der Staatsanwälte, die sich auf die Spuren der noch wenigen lebenden KZ-Wächter begeben. Kümmerte sich die deutsche Justiz über sechzig Jahre ausschließlich um die Mörder, verfolgt sie seit kurzem auch die Beihilfe zum Massenmord. So zeigt die Dokumentation vorrangig Ermittler, die auf dem Gelände des ehemaligen KZs Stutthoff nicht mehr bestehende Wachtürme rekonstruieren und der Frage nachgehen, ob man von dort aus den ein oder anderen Mord hätte wahrnehmen können – andernfalls wird es mit der Anklage schwieriger. Nicht auszuschließen, dass jemand ein KZ bewachte, ohne dabei jemals etwas Mörderisches gesehen oder auch nur gehört zu haben. Im Zweifel für den Angeklagten. Ein deutlicher Hinweis für die Existenz des „Schuldkults“, von dem nicht nur AfD-Spitzen wie Alice Weidel zu berichten wissen.
So wirklich zur Sache ging es aber erst eine Dreiviertelstunde später. Unter dem Motto „Der Mossad, die Nazis und die Raketen“ behandelte die nun folgende Doku das gegen Israel gerichtete Raketenprogramm Gamal Abdel Nassers, an dem sich in den 60er-Jahren auch deutsche Ingenieure mit NS-Hintergrund beteiligten. Der Zuschauer erfährt von Mossad-Chef Isser Harel, dem damals „fast jedes Mittel recht“ war, um das ägyptische Treiben zu stoppen – und davon, wie ihm dabei auch deutsche Raketen-Experten durch eine Briefbombe und ein Entführungskommando zum Opfer fielen. Israelische Täter, deutsche Leidtragende: Die Raketen-Affäre ist eine Offenbarung für alle, die schon immer um die Skrupellosigkeit der Zionisten wussten. Umso mehr, da die ägyptischen Raketen damals noch nicht lenkfähig, also „keine Bedrohung“ für Israel waren, wie die Stimme aus dem Off im Chor mit weiteren Zeitzeugen latent triumphierend erklärt. Am Ende des Abends steht es 1:1 zwischen Deutschen und Juden. Zumindest gefühlt.
Nun ist es durchaus vorstellbar, dass bei den Programm-Verantwortlichen im Ersten lediglich Kommissar Zufall am Werk war. Denkbar wäre aber auch, dass seelenhygienische Erwägungen zumindest unterbewusst eine Rolle spielten. Erinnern und Entlastung, Stolpersteine und Israelkritik, Gedenken und gute Ratschläge an die israelische Regierung – es ist exakt dieser Rhythmus, in dem sich die Vergangenheit schon seit einiger Zeit besonders entspannt bewältigen lässt. Die Gründung des Staates Israel war nicht nur ein Glücksfall für die Juden, sondern auch für die Deutschen, die seither penibel Strichlisten über die Vergehen der Juden zwischen Mittelmeer und Jordan führen. Wenn nun sogar die Israelis in Gaza ein „Ghetto“ betreiben, wiegt der Dienst der Großväter zwischen Warschau und Auschwitz gleich viel weniger schwer.
Erinnern und bewältigen? Fein, aber bitte nicht übertreiben!
Inzwischen sind 22 Jahre vergangen, seit der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus ernannte. Seither gedenkt man in Deutschland an diesem Tag nicht, wie es kraft eines UN-Beschlusses in anderen Ländern üblich ist, der Opfer der Shoa, sondern universell aller Opfer, die auf das Konto der Nationalsozialisten gingen. Das ist auf den ersten Blick löblich, auf den zweiten jedoch auch ein wenig bequem. Erinnerung, so scheint es, ist eine gute Sache. Aber es damit übertreiben, gar an die Wurzel des Nationalsozialismus, nämlich den Judenhass gehen, muss man ja nun auch nicht. Man hält Reden, legt Kränze ab und weiht Gedenkstätten ein. Man rühmt sich der Auschwitz-Prozesse, der „Wiedergutmachungs“-Zahlungen und des „jüdischen Lebens“, das hie und da unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Das alles sieht gut aus und fühlt sich noch besser an. Vor allem aber beruht es größtenteils auf den Verdiensten weniger, deren Aufarbeitungs-Bemühungen lange Zeit auf Widerstände stießen.
Dass Fritz Bauer sein Wissen über den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns lieber mit dem Mossad als mit deutschen Behörden teilte, dass die Verjährung von Mord – und damit auch die des Völkermords der Nazis – erst nach einigem Hin und Her aufgehoben wurde, darüber lässt sich treffend schweigen. Der Erinnerungskultur wird zwar häufig nachgesagt, lediglich ein Elitenprojekt zu sein. In Wirklichkeit ist sie allerdings nicht einmal das. Es sei denn, man hält das renommierte „Institut für Zeitgeschichte“, das über Jahrzehnte ein Erscheinen des von Raul Hilberg verfassten Standardwerks „Die Vernichtung der europäischen Juden“ behinderte, für eine gänzliche unelitäre Veranstaltung. Frankreich brachte Claude Lanzmanns „Shoa“ hervor, die USA die weltweit beachtete Serie „Holocaust“. In Deutschland setzt man lieber auf hitlerbärtige Satire-Produktionen, auf „Er ist wieder da“, auf Guido Knopp und Hitlers Frauen und immer öfter auch auf Entspannungsübungen, die Titel wie „Unsere Väter, unsere Mütter“ tragen. Während der amerikanisch-israelische Historiker Saul Friedländer sein mehrfach ausgezeichnetes Werk „Das Dritte Reich und die Juden“ vollendete, kümmerte sich das offizielle Deutschland emsig um die Bombenangriffe der Alliierten. Dass die relevanten Forschungen zur Shoa weniger von deutschen Historikern ausgingen und überwiegend von Autoren aus dem Ausland stammen, kommt in Sonntagsreden allerdings nicht so gut an.
Zwischen Wanderzirkus und „Buchenwald Libre“
Seit je her rühmt sich das Land der Dichter und Denker seiner eigenen Tiefsinnigkeit. Mit den vermeintlich „oberflächlich-kommerziellen“ Kulturprodukten jenseits des Atlantiks will es wenig gemein haben. In Sachen Erinnerung ist es jedoch nahezu umgekehrt. Deutsches Gedenken zählt mehr auf Effekte denn auf Substanz. Entscheidend ist nicht der Inhalt, sondern die Verpackung. Die Deutsche Bahn beispielsweise hielt es für eine gute Idee, einen ICE nach Anne Frank zu benennen. Immerhin stehe sie „für Toleranz und für ein friedliches Miteinander verschiedener Kulturen“, was „in Zeiten wie diesen, wichtiger denn je“ sei. Ganz so, als hätte es sich bei Anne Frank lediglich um eine verhinderte Vorkämpferin im Dienste der multikulturellen Gesellschaft, bei den Nazis dagegen um miesepetrige Spielverderber mit Aversion gegen ein „friedliches Miteinander“ gehandelt. Etwas später stellte das „Zentrum für politische Schönheit“ dem AfD-Vergangenheitsexperten Björn Höcke ein Holocaust-Mahnmal vor die Tür – und demonstrierte damit, dass sich das Andenken an die die ermordeten Juden inzwischen auch mühelos als Wanderzirkus nutzen lässt. Im „Berliner Ensemble“ wiederum stehen heute keineswegs nur erinnerungstechnische Workshops und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Nach getaner Gedächtnisarbeit kann man dort ebenso Party machen. „Reden, feiern und trinken – ohne dabei zu vergessen“ lautet das Gebot der Abendstunde. Ob das Barmenü auch „Buchenwald Libre“ oder „Auschwitz Sunrise“ führt, ist hingegen nicht bekannt.
Andernorts ist die Vergangenheitsbewältigung da schon weiter. Erst neulich führte Alexander Gauland in seiner Kyffhäuser-Rede das allgemeine Recht ein, sich nicht nur „unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen“. Das Recht, „stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“, reklamierte er bei der Gelegenheit für sich und die seinen gleich mit. Wenn schon, denn schon. Dabei muss man dem AfD-Chef zugestehen, auf diese Weise immerhin neue Trends zu setzen. Während die einen noch leugnen und die anderen relativieren (Dresden! Rheinwiesen!), begibt sich Gauland ohne Umschweife auf die Zielgerade und rehabilitiert, worum andere noch mühselig krebsen. Schließlich steht für aufrechte Patrioten viel auf dem Spiel: Erst mit einer ordentlichen Vergangenheit kann auch eine strahlende Zukunft entstehen. Es ist ein Jahr her, da Björn Höcke die „systematische Umerziehung“ beklagte, mittels derer die Alliierten „unsere Wurzeln“ hätten roden, „unsere kollektive Identität“ hätten „rauben“ wollen. Wer heute eine Zukunft haben will, brauche eine „Vision“, die aber nur dann entstehen könne, „wenn wir uns selber finden“, so Höcke. Und weiter: „Selber haben werden wir uns nur, wenn wir wieder eine positive Beziehung zu unserer Geschichte aufbauen. (…) Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad!“
Der Selbstfindungstrip des Björn Höcke: eine zutiefst deutsche Angelegenheit
Es wäre naheliegend, den Selbstfindungstrip des Björn Höcke als Zweck an sich zu betrachten; als bloße Entspannungsmaßnahme für Menschen, die Geschichte mit einem Selbstbedienungsrestaurant („Eine Portion Stauferkaiser mit Bismarck, aber bitte ohne Holocaust!“) verwechseln. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass seine Übungen das Mittel zum Zweck darstellen. Das AfD-interne Navigationsgerät gibt „Zurück zu deutscher Größe“ als Ziel vor. Auf dem Weg dorthin könnte alles so schön und unbeschwert sein – wenn da nur nicht die toten Juden mitsamt der Erinnerung an sie im Weg herum stehen würden. Nur die „erinnerungspolitische Wende“ kann für freie Fahrt sorgen. Einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung zufolge wollen 55 Prozent der Deutschen „nicht mehr so viel über die Judenverfolgung reden“ und diesbezüglich einen „Schlussstrich“ ziehen. 66 Prozent „ärgern sich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden“. Unter den jüngeren Befragten (18 bis 29 Jahre) sind es 79 Prozent. Die AfD mag zwar formal eine 13 Prozent-Partei sein. Die Mission Höckes hat allerdings deutlich mehr Potenzial.
Vor allem jedoch harmoniert sie perfekt mit anderen Bewältigungsstrategien, die schon länger zum guten Ton gehören. Brennt etwa am Brandenburger Tor die israelische Fahne, so konsultiert man in gewissen Kreisen keinesfalls die Feuerwehr, sondern das Strafgesetzbuch – um zu unterstreichen, dass derlei Handlungen keinesfalls strafbar sind. Fallen vornehmlich Muslime durch Judenhass auf, folgt darauf einiges an Verständnis – immerhin leiden die jungen Rabauken ja genauso unter Israel wie man selbst. Und wenn der deutsche Außenminister nach Israel reist, um dort eigenhändig den Staatschef zu düpieren, läutet der „Spiegel“ schon mal das Ende der „Sonderbehandlung Israels“ ein. Konsequent ist das allemal. Schließlich liegt laut aktuellen Studien der Anteil derer, die „gut verstehen können, dass man bei der Politik, die Israel macht, etwas gegen Juden hat“, bei 40 Prozent. Ebenso viele Befragte sind davon überzeugt, Israel führe „einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser“. Und wenn die Juden also die neuen Nazis sind, wirken die alten Nazis gleich viel nichtiger.
Wenn die „Israelkritik“ auf Freunde des Schlussstrichs trifft
Auch die „Israelkritik“ folgt nicht selten den Regeln des entlastenden Abwehrspiels – allerdings verschämter durch die Hintertür, wo man statt „die Juden“ lieber „Israel“ sagt. Die Selbstfindungs-Gurus von der AfD nehmen stattdessen flott den Haupteingang. Der Weg, der von Täter-Opfer-Umkehr, Selbstmitleid, Ressentiments und Paranoia gesäumt wird, bleibt dabei derselbe. Die einen instrumentalisieren den Holocaust gegen Israel, die anderen betrachten ihn ohnehin als abgehakt. Die einen stören sich mindestens an den toten Juden, die anderen an den lebenden in Israel. In stiller Einigkeit teilen sie sich die Gewissheit, sie selbst seien besser dran, wenn der „ewige Jude“ nicht kraft seiner schieren Existenz ständig die eigene, doch eigentlich so weiße Weste besudeln würde. Auschwitz nehmen sie den Juden gleichermaßen übel. Und selbstverständlich würden sie niemals jemandem ein Haar krümmen – sie wehren sich lediglich gegen das, was sinistere Mächte ihnen antun. Man wird ja wohl noch ein wenig Notwehr betreiben dürfen.
Womöglich ergänzen sich der moderne „Israelkritiker“ und der Schlussstrich-Befürworter sogar besser, als sie es selbst für möglich halten. Natürlich: Die einen sind in der offiziellen Mitte angekommen, die anderen wären es gerne. Das unterscheidet sie. Gleichzeitig hat die „Nicht mehr hören wollen“-Fraktion in der AfD ein dankbares Sprachrohr gefunden, das zudem zum Nachahmen ermutigt. Umso mehr in Zeiten, da die letzten Überlebenden das Zeitliche segnen und der Schlussstrich dadurch gleich viel lockerer über die Lippen geht. Denn natürlich haben die Deutschen aus ihrer Vergangenheit gelernt – vor allem jedoch, wie man sie bewältigt, ohne dabei in den Spiegel blicken zu müssen.