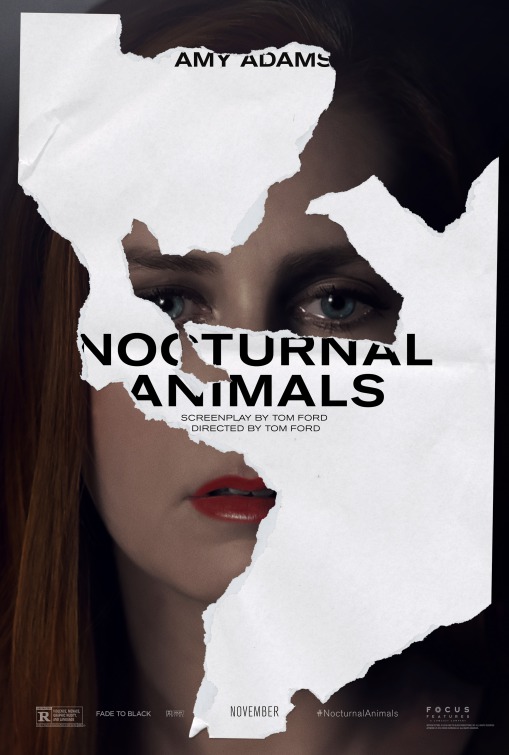Plädoyer für ein Einwanderungsgesetz
Wenn die Politik Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen will, muss sie die politische Flickschusterei in Sachen Flucht, Asyl und Arbeitsmigration beenden.
Es gibt keine Politik ohne Sorgen und Hoffnungen. Sie sind Triebfedern politischen Handelns: Man möchte den Niedergang des eigenen Gemeinwesens verhindern oder die Welt zu einem besseren Ort machen. Immer geht es um die Zukunft und das Wohl künftiger Generationen. Das wird bei der Einwanderung besonders deutlich. Das Thema lässt niemanden kalt, es betrifft Länder im Westen wie im Süden, das Zusammenleben von Einzelnen wie Gruppen, den Erfolg ganzer Volkswirtschaften.
In Europa und insbesondere in Deutschland hat der Herbst 2015 als ein Katalysator gewirkt, der die Sorgen teilweise zu Ängsten steigerte und die Hoffnungen in Träume verwandelte. Sie sind die soziokulturellen Antipoden, die die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen nun bestimmen. Seitdem sehen die Einen beispielsweise den Duisburger Stadtteil Marxloh oder die Pariser Banlieus als Beleg für das Scheitern von Einwanderung und Integration; die Anderen nennen als Beweis für eine funktionierende weltoffene Gesellschaft den alljährlich friedlich stattfindenden Berliner Karneval der Kulturen oder einen erfolgreichen Unternehmer mit türkischen Wurzeln. Tatsächlich bilden diese Beispiele zusammen die heutige Wirklichkeit westlicher Gesellschaften ab. Doch wie diese Wirklichkeit bei der großen Mehrheit der Bevölkerung wahrgenommen wird, hängt letztlich von Vertrauen ab – vom Vertrauen in die eigene Gesellschaft, die Demokratie und die staatlichen Institutionen.
Folgen des Vertrauensverlustes
Seit dem Herbst 2015 ist dieses Vertrauen geschwunden. Das lag an dem historischen Moment, in dem Kanzlerin Merkel einen großen Druck von der EU nahm und fast 900.000 Menschen aus einem anderen Kulturkreis, die sich im Spätsommer auf den mühseligen und gefährlichen Weg ins Herz Europas gemacht hatten, Asyl in Deutschland bot, Schutz und Auskommen. Die Bilder vom großen Willkommen, die „Refugees welcome!“-Plakate, die mannigfache Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft werden in die Geschichtsbücher eingehen und haben das Image Deutschlands in der Welt noch einmal verbessert. Und doch ist damals etwas aufgebrochen, das in dieses Bild nicht zu passen scheint. Denn in diesem besonderen Jahr artikulierte sich zum ersten Mal auch eine breite Front der Ablehnung, und diese Front hat sich verfestigt, sogar radikalisiert. Sie besteht aus Menschen, die Fremde per se ablehnen oder sich von der Merkel‘schen Entscheidung im Spätsommer überfahren fühlten oder sich Sorgen machen um ihr Land oder gar Angst haben vor dem Anderen und der Veränderung. Die meisten von ihnen – diejenigen, die weltanschaulich ohnehin ganz weit rechts stehen, brauchen uns hier jetzt nicht beschäftigen – sind auf längere Sicht möglicherweise für eine zivile Politik, für Weltoffenheit und den Imperativen, die sich aus Mitmenschlichkeit ergeben, verloren (und es sollten nicht mehr werden). Der Grund dafür liegt vor allem in genau diesem Vertrauensverlust, den der deutsche Staat seit Ende 2015 bei einem großen Teil seiner Bürgerinnen und Bürger erfahren hat. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Kanzlerin zur Begründung ihrer Entscheidung im Spätsommer 2015 nicht sehr viel mehr als die Ermutigung „Wir schaffen das!“ zu bieten hatte. Und auch im Bundestag gab es kaum einen, der sie mit Nachdruck gefragt hätte, wie wir das schaffen können und wie es in der Sache auf lange Sicht weitergeht.
Tatsächlich könnte man heute allerdings mit gutem Recht behaupten, dass Deutschland diese Bewährungsprobe vorerst bestanden hat, dass die ersten Probleme durch das gewaltige Engagement von Millionen Bürgerinnen und Bürgern bewältigt wurden. Doch es gab da ja noch die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln, in dem sich ein bedrohliches Gefühl verfestigte, dass eine Unbeschwertheit verloren geht, Freiheit und eine Kultur des Eigenen. Und dass der deutsche Staat auf die neue Situation unzureichend vorbereitet ist und immer noch nicht weiß, wie es in Sachen Migration und Integration auf lange Sicht weitergehen soll. Das ist das eine Problem. Das andere ist: Es gibt viele Stimmen, die ihm das Recht absprechen, in dieser Sache überhaupt regulierend, ordnend und fordernd einzugreifen.
Wachsendes Unbehagen
In den letzten anderthalb Jahren ist die Spannung zwischen universalistischen Weltstaatsprinzipien, aus denen das Recht eines jeden Menschen abgeleitet wurde, sich ohne Wenn und Aber in einem Land seiner Wahl niederlassen zu dürfen, und dem republikanischen Nationalstaatsprinzip, nach dem ein Gemeinwesen selbst entscheiden darf, wen und wie viele Menschen es aufnimmt, immer stärker geworden. Zuletzt ist das an dem Gutachten eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof deutlich geworden, wonach die EU-Staaten Schutzsuchenden die Möglichkeit geben sollen, schon in ihren Auslandsvertretungen humanitäre Visa auszustellen, damit sie nicht einen beschwerlichen und gefährlichen Fluchtweg einschlagen müssen. Das ist eigentlich kein falscher Gedanke, fand aber kein konstruktives Echo, weil er in der aktuellen Diskussion weder radikalen Linken, die allen Menschen, also auch allen Migranten, diese Möglichkeit zubilligen wollen, noch den europäischen Staaten, inklusive Merkel-Deutschland, die nur die Illegalität und deshalb Schlepperbanden bekämpfen, aber keine legalen Wege anbieten, zupasskommt, denn er bedeutet einen Ausgleich zwischen Universalismus und Republikanismus, indem er Asylsuchende „Asylsuchende“ nennt und Konsequenzen aus diesem Status zieht. Danach müsste man natürlich auch Migranten definieren wie auch Flüchtlinge, ihnen Rechte zubilligen, die ihnen nur ein Gemeinwesen, vulgo: ein Staat sichern kann. Das nennt man dann Bürgerrechte. Die brauchen wiederum einen Staat, der mit einer gewissen Souveränität und Autorität ausgestattet ist. All dies sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist aber in Deutschland mit seinem moralischen Idealismus und seinem unterentwickelten Republikanismus eine Baustelle, die dem Berliner Flughafen ähnelt: man kommt der Fertigstellung nicht recht näher, und das Unbehagen wächst.
Dabei spüren immer mehr Menschen auch aus den Helferskreisen, dass ihre Unterstützung, ihr Engagement einen institutionellen Rahmen benötigt, den eine Zivilgesellschaft allein nicht herstellen kann. Denn Solidarität benötigt auch staatliche Souveränität und Autorität.
Zeit für ein Einwanderungsgesetz
Es gibt wahrscheinlich kein Patentrezept, keine „Zauberlösung“, wie es die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nicht müde wird zu betonen, mit dem man einen umfassenden Zugriff auf alle Triebkräfte von Afghanistan bis Angola erhielte, die die Flüchtlings- und Migrationsbewegungen in Bewegung setzen und lenken. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Kräfte und Bewegungen zu nutzen und bis zu einem gewissen Grad auch zu steuern oder einzudämmen. Die notwendigen Maßnahmen sind komplex, manchmal heikel, auch teuer. Aber sie bieten die Chance, verlorengegangenes Vertrauen in der Bevölkerung zurückzugewinnen, Humanität und Eigeninteresse zu verbinden sowie eine Perspektive für die deutsche, europäische und internationale Politik zu skizzieren.
Dazu müsste Deutschland (und letztlich auch Europa, aber das ist noch Zukunftsmusik) einen Weg beschreiten, den der Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration schon einmal in seinem Bericht vorgezeichnet hat. Er ist in einigen wenigen Punkten wie der Vereinfachung des Aufenthaltsrechts von der Bundesregierung berücksichtigt worden – doch dann ist man auf halbem Weg zu einer geregelten Einwanderungsgesellschaft stehen geblieben und der Sachverständigenrat vor rund zehn Jahren aufgelöst worden. Ihn wieder einzurichten mit dem Auftrag, ein aktuell taugliches Einwanderungsgesetz zu erarbeiten, wäre ein erster Schritt, um aus der Defensive zu kommen und funktionierende Verfahren zu planen und umzusetzen.
Ein ZDF-Politbarometer stellte im „Krisenjahr“ 2015 fest, dass 78 Prozent der Deutschen ihr Land für ein Einwanderungsland halten, nur 18 Prozent sahen das anders. Auch wenn sich diese Zahlen etwas verändert haben, so sind doch die Realitäten keine anderen, ob mit oder ohne Flüchtlingen. Deutschland wie auch seine Nachbarn in Ost und West benötigen Einwanderung, allerdings nicht eruptiv, zufällig und von einer Schlepper-Ökonomie bestimmt. Es sind vor allem drei Gründe, die sie notwendig machen: Da ist vor allem, erstens, der demographische Faktor. Europa verliert an Einwohnern und damit mittelfristig an Wohlstand, sozialer Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Allein Deutschland benötigt wohl jährlich eine Nettozuwanderung um die 250.000 Menschen. Diese Nachfrage korrespondiert, zweitens, mit einer großen Zahl von Menschen in den Randgebieten Europas und in Afrika, die eine Arbeit suchen und eine Chance auf Bewährung, Aufstieg und Hilfe für Familien und Verwandte in der alten Heimat. Im vergangenen Jahr haben Immigranten weltweit rund eine halbe Billion Dollar „nachhause“ transferiert und damit eine Summe, die dem Dreifachen der globalen Entwicklungshilfe entspricht. Dieses Geld hat den immensen Vorteil, dass es auf direktem Weg bei Bedürftigen landet und die lokale Wirtschaft unmittelbar stärkt. Das ist der bislang sicherste und effizienteste Weg, die Lebensbedingungen der Menschen in wirtschaftlich schwachen Staaten zu verbessern. Drittens entspricht Einwanderung der ersten Stufe auf dem mühsamen und sehr langen Anstieg zu einer Weltgesellschaft, einer Kosmopolis im Sinne Kants, der in seiner Abhandlung Zum Ewigen Frieden in dieser Form der „Hospitalität“ eine Möglichkeit sah, „das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfassung immer näher bringen“ zu können. Aber er gestand dem aufnehmenden Staat auch das Recht auf „Abweisung“ zu – soviel Realitätssinn besaß auch seine große Utopie.
Ein großes Einwanderungsgesetz wäre also ein Rahmen, der Erwartungen und Angebote klärt und Verfahren vereinfacht. Damit wäre schon sehr viel gewonnen.
Erster Schritt: Unterscheidung
Es gibt Menschen, die eine Zuflucht vor Krieg brauchen. Es gibt Menschen, die politischen Schutz suchen. Es gibt Menschen, die eine Perspektive wollen. Und es gibt Menschen, die unsere Gesellschaft benötigt.
Zunächst sollte daher – um der notwendigen Genauigkeit willen – in der Politik wieder von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten die Rede sein. Diese Unterscheidung weist schon den Weg zu möglichen Lösungen, um Kriegsflüchtlingen zu helfen, politisch Verfolgten Asyl zu gewähren und Migranten einen Weg zu legaler Arbeit zu eröffnen. Ihnen allen weitgehend über Asylverfahren einen Aufenthaltsstatus zu geben, wird den verschiedenen Bedürfnissen nicht gerecht, zwingt sie in langwierige Verfahren und beschädigt auf Dauer das Asylrecht. Wir sollten uns auch bewusst machen, dass Flüchtlinge, Asylsuchende und Migranten ungeachtet ihres Schicksals weitgehend rationale Akteure sind – und dementsprechend sollten sie auch behandelt werden.
Kriegsflüchtlinge sollten in erster Linie subsidiären Schutz genießen. Sie müssen aber Sprachkurse und die Möglichkeit zur Ausbildung bekommen, denn man muss sich darauf einstellen, dass ihr notwendiger Aufenthalt nicht zwingend nach Ablauf der Aufenthaltsdauer von beispielsweise drei Jahren endet. Aber es ist der Beginn und der Rahmen, in dem man einer bestimmten Gruppe das gibt, was sie zunächst braucht: Schutz. Zunächst gilt es, diesen Schutz und ein Auskommen in sogenannten „sicheren Drittstaaten“ nahe der Heimat zu gewährleisten. Dafür muss die gesamte Völkergemeinschaft, aber im besonderen Fall des Nahen Ostens vor allem die weitere Nachbarschaft aufkommen, zu dem die Golfstaaten ebenso gehören wie die Europäische Union. Darüber hinaus müssen diese Länder entlastet werden, indem die entfernteren Nachbarstaaten wie z.B. Deutschland größere Kontingente dieser Flüchtlinge auf sicheren Wegen in ihren Ländern aufnehmen. Mit ein wenig Vorausschau wäre so zum Beispiel die Situation vom September 2015 verhindert worden.
Politisch Verfolgte benötigen definitiv die Möglichkeit, schon in der Nähe ihres Wohnortes einen Antrag auf Asyl einzureichen. Dafür sollten spezielle Zentren in Regionen eingerichtet werden, wo mit einer größeren Zahl solcher Anträge gerechnet werden muss. Diese Zentren müssen in die Lage versetzt werden, innerhalb kurzer Zeit festzustellen, ob ein Asylverfahren Aussicht auf Erfolg hat und humanitäre Visen ausstellen.
Einwanderung mit drei Säulen
Echte Einwanderung sollte über drei Verfahren ermöglicht, d.h. gesteuert und legalisiert werden. Eine bestimmte Quote erfolgt, erstens, über ein schon vom Sachverständigenrat favorisiertes Punktesystem. Es ist Kanada, das für dieses Verfahren als Beleg immer wieder herangezogen wird, wenn ein funktionierender multiethnischer westlicher Staat genannt werden soll, der die Einwanderung in seinen Erfolgs-Code eingeschrieben hat. Allerdings kennt Kanada keinen vergleichbaren Migrationsdruck wie die USA oder Europa und kann sich daher ganz auf sein qualifikationsorientiertes Punktsystem verlassen, in dem Sprachkenntnisse, Arbeitserfahrung, Bildung etc. eine maßgebliche Rolle spielen. Die Einwanderer sollen zum ökonomischen Bedarf des Landes passen und das Land somit stärker machen, den Wohlstand aller mehren. Diese Art Planwirtschaft würde in Europa aber nur zum Teil funktionieren, denn die tatsächlich nicht völlig zu schließenden Grenzen bieten immer noch eine Durchlässigkeit, die Migranten mit weniger Berufsqualifikation auf illegale Weise nutzen würden.
Diesen gäbe man vorab eine Hoffnung auf Legalität, wenn man, zweitens, zum Planverfahren ein quotiertes Losverfahren einführen würde, ähnlich dem amerikanischen System. Es gäbe auch Ungelernten die Möglichkeit, sich in der Fremde hochzuarbeiten und Angehörige in der Heimat zu unterstützen.
Die dritte Säule einer gesteuerten Einwanderung bildete eine Reihe von Abkommen mit bestimmten Ländern, in denen man die Rücknahme Illegaler und Straffälliger mit legalen Anwerbeverfahren verknüpft, zu denen man sich bewerben kann. Alle Verfahren haben den Vorteil, dass sie Erwartungen klären und Hoffnungen nähren, kurz und marktwirtschaftlich gesprochen: Angebot und Nachfrage soweit wie möglich annähern.
Doch kein steuerndes Verfahren, keine geregelte Einwanderung, keine gelingende Integration kommt ohne die Unterscheidung zwischen „legal“ und „illegal“ aus. Diese Unterscheidung ist nicht nur berechtigt, sondern sogar notwendig und vernünftig. Wer legal ist, sollte sehr zügig eine Arbeitserlaubnis bekommen und selbstverständlich in den Genuss von Sprachkursen, Integrationsmaßnahmen und Zugang zum sozialen Wohnungsbau. Aber all dies gebührt nur denjenigen, die einen legalen Weg genommen haben. Dessen Attraktivität wird damit erhöht. Der illegale Weg sollte all diese Möglichkeiten und Vergünstigungen nicht kennen. Seine Unattraktivität muss immer wieder deutlich gemacht werden, auch durch Abschiebungen.
Die sogenannten Fluchtursachen
Fast alle sind sich einig, dass Fluchtursachen beseitigt werden müssten. So leicht das propagiert bzw. gefordert werden kann, so schwierig und teilweise unmöglich ist das in der Realisierung. Fluchtursachen beseitigen bedeutet, Verantwortung für Klimawandel, Hunger und die Beendigung von Bürgerkriegen zu übernehmen – eine gewaltige Aufgabe, die kein Land allein leisten kann, ja, selbst die Weltgemeinschaft nur sehr bedingt. Denn diese findet – zurückhaltend formuliert – nur sehr selten zu gemeinsamen Entscheidungen in den gerade existentiellen Fragen. Daher kann „Fluchtursachen beseitigen“ gegebenenfalls auch militärisches Eingreifen bedeuten. Die Mittel und Möglichkeiten müssen dafür bereitgestellt werden. Auch darauf müssen sich die deutsche wie die europäische Gesellschaft einstellen. Die Alternative wäre für die Betroffenen: Vertreibungen, verheerte Länder, Hunderttausende Todesopfer, der Verlust von Heimat mit all seinen Folgen: Perspektivlosigkeit, Entwurzelung und Radikalisierungen, die weitere Krisen, Konflikte und Kriege auslösen. Eine Spirale des Niedergangs und des Elends setzt sich in Gang. Doch bei den Diskussionen um die sogenannten „Fluchtursachen“ sollte nicht vergessen werden, dass Migration auch überaus wünschenswerte Aspekte hat. Man muss dafür nicht philosophische, idealistische Utopien bemühen, an denen das Weltunwesen vielleicht genesen könnte. Es gibt vielmehr triftige utilitaristische Gründe eines Nehmens und Gebens, die beispielsweise High-Tech-Firmen und andere ökonomische Global Player schon weidlich nutzen; aber es gibt diese Dinge auch im Kleinen wie zum Beispiel in der Pflege und anderen einfachen Berufen.
Doch besonderes Augenmerk verdient immer noch die Flucht vor Krieg und Unterdrückung. Wenn auch, angesichts von ca. 50 Millionen Flüchtlingen auf der Welt, der Gedanke nahe liegt, dass wir es mit einer Weltaufgabe zu tun haben, für die die UNO und besonders der UNHCR adäquat finanziell ausgestattet werden müssen, so muss doch der Blick auf die besondere Verantwortung von Regionalmächten gelenkt werden. Sie haben nicht nur ein Eigeninteresse, da sie von großen Fluchtbewegungen betroffen sein könnten, sondern auch die Möglichkeiten, in kurzer Zeit Hilfe auf die Beine zu stellen. Es ist in diesem Zusammenhang höchste Zeit, dass die Golfstaaten an ihre Mitverantwortung für die humanitäre Situation in Syrien und den Anrainerstaaten erinnert werden. Sie haben sowohl die finanziellen Mittel wie die politische und moralische Verpflichtung, sich an der Hilfe für Flüchtlinge zu beteiligen.
Zum Erfolg verdammt
Tatsächlich wird uns das Thema „Flucht, Asyl und Migration“ in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Im Jahre 2016 sind rund 280.000 Menschen nach Deutschland gekommen, fast alle „illegal“. Keiner weiß, wie viele es dieses oder nächstes Jahr sein werden. Keiner weiß, wo die Obergrenze für die Aufnahmefähigkeit eines Gemeinwesens liegt. Aber wie jedes System hat auch dieses tatsächlich eine Obergrenze. Sie ist dann erreicht, wenn das Tempo von Einwanderung (aus welchen Gründen auch immer) die Integrationsfähigkeit des Gemeinwesens wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich übersteigt und Diskordanzen und allgemeine Entfremdungstendenzen schlagartig für alle fühl- und sichtbar werden.
Was im Herbst 2015 versäumt wurde, nämlich eine kontroverse und konstruktive Diskussion im Bundestag, wird nun den Bundestagswahlkampf mit bestimmen. Letztlich wird es auch hier auf Deutschland ankommen, ob die anderen EU-Staaten für eine gemeinsame Strategie und Politik gewonnen werden können. Deutschland ist zum Erfolg verdammt. Doch Europa nicht minder.
In nächster Zeit müssen sich alle Parteien im Bundestag für eine tragfähige Lösung stark machen und unrealistische bzw. ideologische Sichtweisen überwinden. Das Vertrauen der Bevölkerung kann nur dann für die notwendigen politischen Entscheidungen gewonnen werden, wenn Regierung und Opposition einen Plan (oder alternative Pläne) entwickeln, in dem die künftigen Maßnahmen zur Steuerung der Einwanderung dargelegt und ausführlich diskutiert werden. Das ist in einem angemessenen Umfang bis heute nicht geschehen. Am Ende könnte eine institutionalisierte Willkommenskultur stehen – in Form eines Einwanderungsgesetzes.