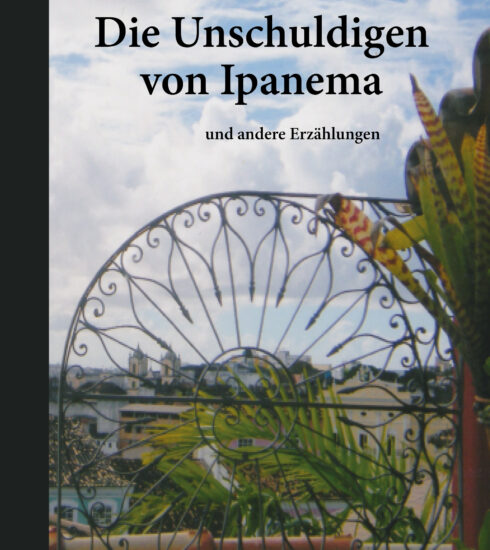Smells like enttäuschte Liebe
Den Zorn, der nach dem Jamaika-Aus der FDP entgegenschlägt, erinnert an die Gefühlsausbrüche gekränkter Liebender. Und offenbart eine falsche Vorstellung davon, was das Wesen einer liberalen Demokratie ausmacht.
Deutschland im Ausnahmezustand. CDU, CSU, Grüne und FDP haben über Wochen miteinander verhandelt, um herauszufinden, ob sie eine Koalition bilden können. Letztlich hat sich jedoch herausgestellt, dass dem nicht so ist. Der eigentliche Skandal folgte aber erst, als die FDP sich daraufhin weigerte, trotzdem zu regieren. In den Medien wird ihr Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und die drei verschmähten Partner treten ebenfalls so zornig nach, dass man sich tatsächlich kaum vorstellen kann, wie das vier Jahre hätte gut gehen sollen.
Sondierungsgespräche sind eben nur Sondierungsgespräche, die zeigen sollen, ob eine gemeinsame Zukunft vorstellbar ist. Die drei anderen Parteien klingen aber wie ein verliebter Mann, der ein erstes Date schon für ein Ja-Wort hält und sich betrogen fühlt, weil die Frau sich weigert, ihn zu heiraten.
Meister der schrillen Töne: die Grünen
Besonders schrill klangen die Grünen nach dem Ende der Verhandlungen. Man habe es mit der „rechtesten FDP seit 1968 zu tun“, schimpfte Reinhard Bütikofer, für den die angebliche Achtundsechzigkeit der Liberalen bis dahin erstaunlicherweise kein Grund gegen eine Koalition gewesen war. Jürgen Trittin verriet wiederum, dass Lindner den Plan gehabt hatte, „Merkel zu stürzen“, was beinahe etwas nach Putschversuch klingt.
Dass sich ein Grüner-Silberrücken solche Sorgen um eine CDU-Kanzlerin macht, hätte vor wenigen Jahren jedenfalls auch noch niemand für möglich gehalten. Aber die (politische) Liebe geht manchmal seltsame Wege. CDU und CSU konzentrierten sich weniger auf Nachtreten und feierten sich stattdessen selbst, auch wenn es dafür keinen Anlass gibt.
In der Presse dominiert die Meinung, dass die FDP sich vor der Verantwortung gedrückt hat. Schlimmer noch, die ganzen Sondierungswochen waren nur inszeniert und sollten mit diesem Knall enden. Warum eine Partei, die sich aus der politischen Todeszone unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde zurückkämpfte und im September auf nicht selbstverständliche zehn Prozent kam, diesen Erfolg wieder riskieren sollte, bleibt dabei etwas rätselhaft. Und ob man wirklich vier Wochen verhandelt, bevor man sich lautstark verabschiedet, ist auch die Frage. Da hätten doch auch zwei gereicht oder eine, bevor das Social Media-Team ihre „Lieber nicht regieren als falsch“-Grafik hoch lädt.
Die Wahrheit ist wohl banal
Wie so oft dürfte die Wahrheit viel banaler sein: die FDP ist offenbar nicht der Meinung, ihre Themen angemessen in einer solchen Koalition verwirklichen zu können und weil ihr eine zu blasse Regierungsbeteiligung ab 2009 fast das Genick gebrochen hatte, lässt sie es dieses Mal lieber bleiben, wenn sie eine ähnliche Entwicklung fürchtet.
Die Wut auf die FDP ist aber ohnehin irritierend. Schließlich ist es in der Demokratie immer ein möglicher Ausgang von Verhandlungen, dass man sich eben nicht einigt. Eine Zeitungsschlagzeile lautete nach dem Jamaika-Aus dennoch Fahnenflucht, was rhetorisch nur noch einen halben Schritt vom Landesverrat entfernt ist. Andere warfen den Liberalen vor, keinen Respekt vor dem Wählerwillen zu haben (wo wir gerade dabei sind: was machen wir eigentlich mit den 13 Prozent der Wähler, die sich für die AfD entschieden? Ach, richtig, wir boykottieren ihre Partei auf sehr respektvolle Art – und Merkels respektvolles boykottieren schließt die neun Prozent der Linkenwähler gleich mit ein) oder sich schlicht verantwortungslos zu zeigen.
Ganz so, als sei es ein Zeichen großer Verantwortungsbereitschaft, sich an einer Koalition zu beteiligen, der man keine Stabilität zutraut. Und als Drohung steht dabei immer im Raum, dass die AfD am Ende von all dem profitieren würde. Aus dieser Haltung spricht zum einen keinesfalls der eingeforderte Respekt vor dem Wähler, sondern ein großes Misstrauen ihm gegenüber, und zum anderen darf man sein Handeln ohnehin nicht davon abhängig machen, was das wohl für die AfD bedeutet.
Das Regierungsviertel, ein einziger Safe Space
Die Empörung über die FDP zeigt, dass das Regierungsviertel aktuell mehr einem „Safe Place“ als einem Ort harter politischer Auseinandersetzungen gleicht. Streit und Dissens beweisen aber nicht die Schwäche einer liberalen Demokratie, sondern ihre Stärke. Dementsprechend ist nicht das Verhalten der FDP irritierend, sondern die gekränkten Reaktionen auf sie. Wobei aber leider auch den Liberalen das Safe-Place-Denken nicht fremd ist, denn sie empfanden die Verhandlungen als „Demütigung“, wie sie nun mitteilten.
Mehr Menscheln war nie in der deutschen Politik. Schließlich sitzt im Bundestag ja auch noch die trotzige SPD, die ihre moralische Überlegenheit erstaunlicherweise aus der Tatsache zieht, im Gegensatz zur FDP erst gar nicht den Versuch einer Regierungsbeteiligung unternommen zu haben. Die Linke sieht sich ohnehin ständig schikaniert, nur weil sie Rechtsnachfolgerin einer früher in Ostdeutschland sehr erfolgreichen und ziemlich tödlichen Partei ist und die AfD hat es als erste Partei geschafft, überhaupt kein positives Selbstbild zu besitzen, sondern sich ausschließlich über die Ablehnung durch die mediale Öffentlichkeit zu definieren.
Bleibt zu hoffen, dass diese „Safeplaceisierung“ des politischen Raums mit dem Ende der großen Koalition dennoch ihren Höhepunkt erreicht hat und nun wieder Stück um Stück abgebaut wird. Es wäre jedenfalls ein Gewinn für die liberale Demokratie, wenn wieder mehr gestritten und weniger gefühlt werden würde.