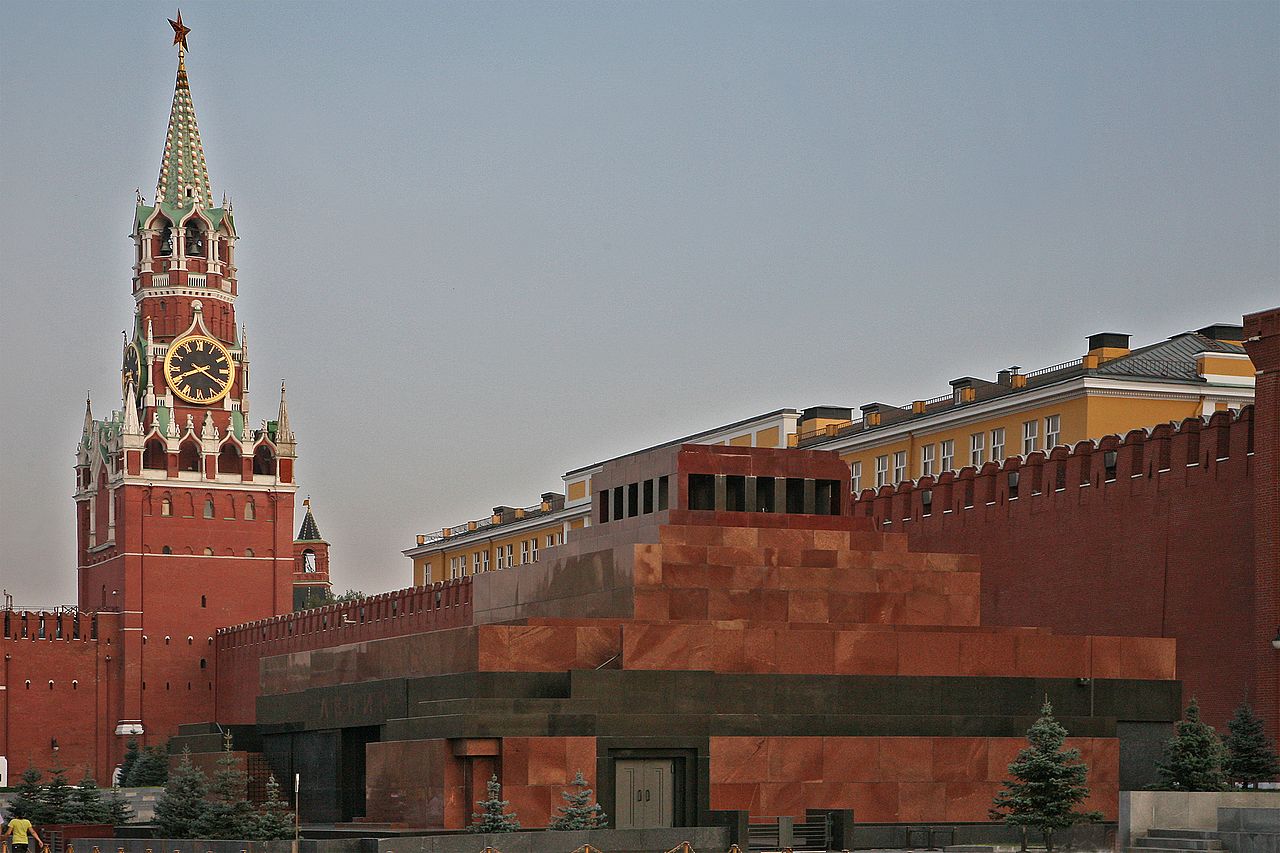Angstgeschäfte – Foodwatch und die Fakten
Foodwatch behauptet, dass jährlich 200.000 Menschen durch Pestizide ums Leben kämen. Mit Fakten hat das nichts zu tun. Unser Autor über die Hintergründe einer skrupellosen NGO-Kampagne.
Wer glaubt, der deutsche Kolonialismus sei Vergangenheit, kennt unsere NGOs nicht. Derzeit wollen sie den Ländern des globalen Südens Dutzende wirksamer Pflanzenschutzmittel wegnehmen, ohne eine Alternative anzubieten. Sie halten die Regierungen und Behörden Afrikas, Asiens und Südamerikas für zu dämlich oder zu korrupt, um ihre Bevölkerung zu schützen, weswegen wir Europäer in guter kolonialistischer Tradition dafür sorgen müssen, dass den naiven Kleinbauern dieser Welt die Chemikalien weggenommen werden, mit denen sie nur dummes Zeug anrichten.
Beispiel Afrika
Der afrikanische Kontinent wird derzeit nicht nur vom Coronavirus heimgesucht, sondern auch von Heuschreckenschwärmen und dem Heerwurm, einer Schädlingsraupe, die sich durch fast alle Nutzpflanzen frisst. Hinzu kommen Pflanzenseuchen durch Mikroorganismen, die Bananen, Zitrusfrüchte, Maniok und zahlreiche andere Nutzpflanzen (für den Export ebenso wie für den eigenen täglichen Bedarf) bedrohen. Berichte finden kaum den Weg ins Fernsehen oder in die Zeitungen. Die Menschen sind verzweifelt, sie hungern, werden krank, sterben.
Eine Bekämpfung dieser Seuchen soll es in Zukunft nicht mehr geben, das fordern NGOs wie Misereor, das INKOTA-netzwerk, die von der Partei Die Linke getragene Rosa-Luxemburg-Stiftung und foodwatch e.V. Sie wollen das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, mit denen eben diese Epidemien und Seuchen bekämpft werden können.
Zwei Begründungen für die Verbote werden vorgebracht: Zum einen seien zahlreiche „hochgiftige“ Mittel in der EU nicht zugelassen. Das klingt natürlich skandalös: zu giftig für Europäer, aber den Afrikanern und Asiaten kann man’s ja verkaufen. Doch der Skandal ist gar keiner. Schaut man sich die Liste an, so wurde eine Zulassung in der EU nur ganz wenigen dieser Mittel verweigert; für die allermeisten wurde sie gar nicht erst beantragt. Für manche Mittel liegt dafür eine Zulassung in den USA vor. Der Grund für die fehlende EU-Zulassung liegt bei den meisten genannten Mitteln auf der Hand: Warum sollte ein Hersteller in der EU ein kostenaufwändiges Zulassungsverfahren einleiten, wenn er die Mittel mangels Markt in der EU gar nicht verkaufen kann? In Europa gibt es nun mal keine Kaffee-, Kakao- oder Teeplantagen. Auch Bananen werden nicht in nennenswertem Umfang angebaut. Und manche Pflanzenschädlinge haben Europa noch nicht erreicht.
Zudem verwundert, dass plötzlich die EU das Maß aller Dinge ist. In Sachen Glyphosat kritisieren die gleichen NGOs die gleiche EU und die gleichen Behörden massiv wegen ihres nachlässigen Umgangs mit Risiken und die Broschüre selbst merkt an:
So haben in den letzten fünf Jahren 14 Regierungen in Afrika, Asien und Lateinamerika beispielsweise den Import und/oder Einsatz von Glyphosat verboten oder zumindest eingeschränkt.
Das spricht nicht gerade für die Behauptung, diese Länder wären bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln im Gegensatz zur EU sorglos und fahrlässig. Sie wägen Nutzen und Risiko nur anders gegeneinander ab als EU-Institutionen.
Die NGOs sehen die Hersteller, allen voran Bayer und BASF, überdies in der Verantwortung dafür, dass Pflanzenschutzmittel in vielen Ländern nicht bestimmungsgemäß eingesetzt oder ohne Schutzmaßnahmen ausgebracht werden. Nicht die örtlichen Regierungen und Behörden, sondern die Hersteller sollen dafür sorgen (was sie in vielen Ländern durch Schulungen usw. auf freiwilliger Basis auch tun). Ebensogut könnte man Pharmafirmen auffordern, keine Medikamente mehr nach Afrika oder Asien zu liefern, weil Antibiotika dort als einzelne Pillen verkauft werden und so die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen gefördert wird, oder weil Mittel, die in Europa verschreibungspflichtig sind, in Asien auf Märkten auftauchen und von fliegenden Händlern ohne Beratung und Beipackzettel vertrieben werden. Sollen keine Malariamittel mehr nach Afrika geliefert werden, weil es bei Infektionen mit dem neuen Coronavirus bei manchen Menschen potenziell tödlich ist?
Den Vogel schießt allerdings Foodwatch e.V. ab. Der Verein führt als zweite Begründung für eine Verbotsforderung ins Feld, die in der EU produzierten Pestizide seien so giftig, dass daran Jahr für Jahr 200.000 Menschen sterben. Foodwatch schrieb am 17. April 2020 auf seiner Internetseite unter dem Titel „Protestaktion: Bayer-Monsanto & Co. müssen Export hochgiftiger Pestizide stoppen!“
Laut Schätzungen der Vereinten Nationen sterben jedes Jahr allein an Pestizidvergiftungen 200.000 Menschen – die Chemieriesen tragen dafür eine große Mitverantwortung!
Das klingt im Kontext einer Kampagne gegen die Herstellung, den Export und die Anwendung von Pestiziden, als seien diese Toten durch den Einsatz der Pestizide oder den Konsum von Lebensmitteln mit Rückständen verursacht – zumal es sich bei Foodwatch um einen Verein handelt, der nach eigenen Angaben für „qualitativ gute, gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel“ eintritt.
Die Zahl, rechtfertigt sich Foodwatch, stamme aus einem „offiziellen Dokument der Vereinten Nationen“ aus dem Jahr 2017. Das klingt beeindruckend, aber man fragt sich, ob der Rechercheur, den Foodwatch angeblich beschäftigt, gerade in Urlaub war. Denn das Dokument stammt aus dem Umfeld des UN-Menschenrechtsrats, genauer gesagt, von der UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung, die von diesem Gremium beauftragt und beaufsichtigt wird.
Beim Stichwort UN-Menschenrechtsrat sollten eigentlich die Alarmglocken läuten. Das Gremium ist eine Farce und seine Entscheidungen regelmäßig skandalös; die internationale Presse ist voll von kritischen Berichten. Für Foodwatch ist das jedoch kein Anlass zu Quellenkritik. Dabei ergibt eine einfache Internet-Recherche zweierlei: Erstens beruht die Ziffer in dem Bericht des Special Rapporteur on the right to food des UN Human Rights Council von 2017 keineswegs auf eigenen Recherchen der Sonderberichterstatterin, sondern ist einem soziologischen Arbeitspapier der Universität Lund entnommen. Zweitens ist in dem Bericht von „akuten Vergiftungen“ durch Pflanzenschutzmittel die Rede („pesticides are responsible for an estimated 200,000 acute poisoning deaths each year“) – das Wort „akut“ hat Foodwatch in seiner alarmistisch formulierten Petition unterschlagen.
Das Papier, das die Sonderberichterstatterin zitiert, stammt aus dem Jahr 2013 und ist im Netz leicht zu finden. Es ist weder eine arbeitsmedizinische, epidemiologische oder toxikologische Arbeit noch eine Veröffentlichung, die mit peer review erschienen ist. Autor ist der Rechtssoziologe Måns Svensson. Er wiederum bezieht sich für die Zahlenangabe auf eine zehn Jahre ältere Publikation. Doch auch die ist nicht erhellend. Diese 2003 erschienene Veröffentlichung behandelt nicht das Thema Todesfälle unter Beschäftigten in der Landwirtschaft oder der Landbevölkerung. Sie beschreibt eine genetische Assoziationsstudie, die sich mit Polymorphismen des menschlichen Paraoxonase-Gens beschäftigt. Die Autoren behaupten die Zahl auch gar nicht als Ergebnis eigener Forschung, sondern nutzen sie als Einleitung ihres Artikels, der ein völlig anderes Thema hat.
At least three million pesticide poisonings occur each year and result in over 200,000 deaths throughout the world.
Als Quelle für diese Ziffern gibt die humangenetische Arbeit ein Papier der WHO aus dem Jahr 1990 an. Auch dies ist kein Originalbeitrag, sondern ein Dokument, dass sich hinsichtlich einer Abschätzung der Zahl akuter Pestizidvergiftungen auf eine Veröffentlichung von 1985 bezieht, in der von 200.000 Toten pro Jahr durch „intentional poisonings (suicides“) die Rede ist. Immerhin wird in dem WHO-Dokument von 1990 erstmals klar, dass es sich bei den akuten Vergiftungen um Vergiftungen aufgrund von Selbstmordversuchen handelt.
Reisen wir noch weiter zurück, ins Jahr 1985, so finden wir, dass die 1990 zitierte Veröffentlichung vom Arbeitsmediziner und späteren Direktor des WHO Collaborating Center for Occupational Health an der Universität Singapur Jeyarajah Jeyaratnam stammt. Er erwähnt die Zahl in seinem Aufsatz von 1985 (ursprünglich ein Vortrag) als Ergebnis einer Hochrechnung von Zahlen, die er 1982 veröffentlichte. Diese Veröffentlichung wiederum beruht auf Patientenakten des Jahres 1979 aus Krankenhäusern in Sri Lanka. Jeyaratnam schreibt 1982:
This study included a sample survey of the clinical records of patients admitted to the different hospitals in Sri Lanka, and showed that approximately 13 000 patients are admitted to hospital annually for pesticide poisoning and that each year 1000 of them die. Suicidal attempts account for 73% of the total, and occupational and accidental poisoning accounts for 24.9%. It is recommended that urgent action be taken to minimize the extent of the problem.
Für seinen späteren Vortrag, der 1985 erschien, hat der Mediziner diese Zahl global hochgerechnet – jedoch nur, um zu verdeutlichen, dass über das Problem zu wenig bekannt ist und alle Schätzungen weit auseinanderklaffen. Daran lässt er in seiner Publikation von 1985 keinen Zweifel:
WHO’s estimate of over 9 000 deaths for the world could be considered an underestimate if global estimates are based on the Sri Lankan study. On this basis one would expect approximately 2.9 million cases of acute pesticide poisoning to occur annually in the developing world, resulting in around 220 000 deaths.
Goldener Windbeutel des Jahres 2020: Foodwatch
Halten wir also fest: Die Behauptung von Foodwatch – „laut Schätzungen der Vereinten Nationen sterben jedes Jahr allein an Pestizidvergiftungen 200.000 Menschen“ – ist eine glatte Lüge.
Als die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung, Hilal Elver, 2017 die ominöse Zahl veröffentlichte, beschäftigten sich verschiedene Medien bereits kritisch damit und stießen auf Jeyarajah Jeyaratnams Zahlen. Merkwürdig, dass der Rechercheur von Foodwatch diese kritischen Berichte nicht gefunden hat. Die französische Publikation agriculture et environnement kontaktierte sogar Jeyaratnam für ihren Beitrag „Pesticides: les faux chiffres de Mme Hilal Elver“ und konfrontierte ihn mit der Zahl. Der gab zu Protokoll, er habe nie behauptet, dass diese Zahl eine Realität widerspiegele, auch nicht vor 35 Jahren – umso mehr, als in Sri Lanka 73 Prozent der Todesfälle auf Suizidversuche zurückgingen, die nichts mit der Verwendung des Produkts zu tun hatten. Wörtlich zitiert ihn agriculture et environnement wie folgt:
„Das Problem sind nicht die Pestizide, sondern ihre unangemessene Verwendung, unzureichende Schulung, unzureichende Lagermöglichkeiten, defekte Sprühgeräten und fehlende Schutzkleidung“ und es sei falsch, „Pestizide als ‚Bösewichte‘ anzusehen“.
Auf die unhaltbare Behauptung hingewiesen, wirft Foodwatch nunmehr Nebelkerzen und schreibt:
Diese Zahl wird u.a. in einem offiziellen Dokument der Vereinten Nationen (VN) aus dem Januar 2017 verwendet. Obwohl die Vereinten Nationen diese Angabe machen, berücksichtigt sie jedoch nicht ausreichend den Umstand, dass es an verlässlichen, aktuellen Zahlen mangelt. Der Verweis auf den VN-Bericht wird in Zweifel gezogen, weil er sich ursprünglich auf eine Studie aus dem Jahr 1985 bezieht.
Dabei wird der Verweis gar nicht deswegen in Zweifel gezogen, weil er sich auf eine Studie von 1985 bezieht, sondern weil diese Veröffentlichung von 1985 gar keine Studie ist, sondern ein Gedankenexperiment und weil es sich dabei um Todesfälle durch Selbstvergiftungen mit Pflanzenschutzmitteln in suizidaler Absicht handelt – ein Faktum, das Foodwatch ebenfalls verschweigt. Selbstmordversuche mit Pestiziden haben nichts mit der Sicherheit dieser Chemikalien für Anwender und Verbraucher zu tun.
Der Verein, allen voran sein Geschäftsführer Martin Rücker, mogelt sich darum herum, dass Foodwatch getäuscht hat: Erstens durch Weglassen des Wortes „akut“ beim Zitieren aus dem UN-Bericht und zweitens durch Verschleierung der Genese dieser Ziffer. Den „Goldenen Windbeutel“, den Negativpreis für die „Werbelüge des Jahres“, muss sich der Spendensammlungsverein in diesem Jahr wohl selbst verleihen – bitter für einen Verein, der selbst so gerne austeilt, wenn er andere beim Mogeln erwischt. Aufrichtigkeit geht anders.
Alternativen? Fehlanzeige!
Noch dreister ist allerdings dies: Keine der NGOs, die das sofortige Verbot des Exports und der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln fordern, zeigt Alternativen auf. Vorschläge zur Bekämpfung von Heerwurm, Heuschrecke, Fusarium oxysporum TR4, der Gelben Drachenkrankheit oder des cassava brown streak virus findet man vergeblich. Auf Nachfrage heißt es, das sei „nicht ihre Aufgabe“. Bohrt man nach, gibt es allenfalls vage Verweise auf die Vorzüge „diversifizierter Anbautechniken“, Mischkulturen, Permakultur und „Agrarökologie“, unter der in Bio-Kreisen vor allem homöopathische und „bioenergetische“ Pflanzenstärkungsmittel und die Behandlung von Saatgut mit allerlei mystischen Praktiken (Eurythmie, Klänge usw.) verstanden wird – Verfahren, die auch das Interesse von Vandana Shiva, der Säulenheiligen der Alternativlandwirtschaft, finden.
Die Wahrheit ist: Der Bio-Anbau hat in den Tropen nichts in der Hand, um Pflanzenkrankheiten und Schädlinge ernsthaft zu bekämpfen. Das Verbot würde zu Hungersnöten mit allen Begleiterscheinungen (Flucht, Bürgerkrieg, Epidemien) führen, Lebensmittel stark verteuern und den Raubbau an der Natur vergrößern. Wer Hunger hat, respektiert kein Reservat und kein Naturschutzgebiet, sondern jagt die Tiere und rodet die Bäume.
Nun behauptet niemand, nicht einmal die Hersteller selbst, dass Pflanzenschutzmittel völlig harmlos sind. Aber: Die meisten Pflanzenkrankheiten werden durch Pilze, Bakterien oder Viren ausgelöst, die durch Insekten, Milben und andere Tiere übertragen werden. Könnte man die Pflanzen gegen diese Mikroben resistent machen, brauchte man keine chemischen Substanzen mehr, um die Überträger zu eliminieren – das wäre ein Segen für Umwelt. Die Technik funktioniert in Form von insektenresistenten Maispflanzen schon seit Jahrzehnten erfolgreich und eliminiert ausschließlich die Schädlinge. Sie könnte auch gegen Mikroorganismen eingesetzt werden, zumal mit Genome Editing eine Technologie zur Verfügung steht, mit der solche Resistenzen wesentlich einfacher, schneller und kostengünstiger hergestellt werden können als mit klassischer Gentechnik.
Nicht nur die Forschungsabteilungen von Bayer, BASF und Co. arbeiten seit Jahren an solchen Sorten. Auch Dutzende afrikanische Universitäten sind weit damit gekommen, heimische Nutzpflanzen, darunter die von den großen Saatgutkonzernen vernachlässigten „Orphan Crops“ und lokalen Varietäten resistent gegen Schädlinge zu machen. Das alles aber darf nach Meinung europäischer NGOs und Parteien nicht sein. Gentechnik bedrohe die „genetische Diversität“, obwohl sie sie doch in Wirklichkeit erhält und sogar vergrößert.
Lügen in Europa, Horrorgeschichten in Afrika
Damit Forscherinnen und Forscher in Südamerika, Asien und Afrika ihre Projekte nicht fortsetzen können, weil sie aus der Sicht der Kolonialeuropäer ein „Fehler“ sind (Gentechnikprodukte könnten den Absatz von Bioprodukten in Europa gefährden), sind sie dort besonders aktiv. Auch zu diesem Thema werden Lügengeschichten verbreitet.
Im letzten Jahr etwa veranstalteten u.a. deutsche NGOs, gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, in Nairobi, Kenia, die 1st International Conference on Agroecology Transforming Agriculture & Food Systems in Africa, bei der ausgesuchte Scharlatane Horrorgeschichten über Gentechnik zum Besten geben konnten: der Homöopathieforscher Gilles-Eric Séralini (potenzierter Pflanzenextrakt hilft gegen Glyphosat-Vergiftungen) mit seiner mehrfach widerlegten Gentechnik-Mais-macht-Krebs-Geschichte und Don Huber, ein emeritierter Professor, der seit zehn Jahren mit der Geschichte um die Welt tingelt, dass die Kombination von Gentechnik und Glyphosat eine ganz neue Sorte von Pflanzenpathogenen erzeugt habe, eine Chimäre aus Viren und Pilzen, aber ohne Genom, die Pflanzen, Vieh und Menschen befalle und elend zugrundegehen lasse. Er kultiviert diesen merkwürdigen Organismus nach eigenen Aussagen seit 2005, weigert sich aber beharrlich, ihn in einer Publikation vorzustellen oder an andere Forscher weiterzugeben. Ebenso beharrlich weigert sich übrigens auch Séralini, die Rohdaten seiner Rattenkrebs-Veröffentlichung herauszugeben.
Solche Veranstaltungen sind ebenso wie die Pestizid-„Informationen“ Teil einer Desinformationskampagne mit dem Ziel, den Menschen im globalen Süden Teilhabe an Innovationen zu verweigern und Wohlstand und Wachstum zu verhindern. Vordergründig geht es den NGOs um die Gesundheit der Menschen in den Tropen und Subtropen. In Wahrheit ist ihnen deren Schicksal reichlich egal. Europäische NGOs halten den Menschen, vor allem den in Afrika, Asien und Südamerika, für das Grundübel auf diesem Planeten – vor allem, wenn er nach Wohlstand und Sicherheit strebt. Schließlich wäre unser Planet kaputt, wenn alle so leben wollten wir wir. Das gilt es zu verhindern. Wer’s nicht glaubt, muss gar nicht zu den Pamphleten der Extinction Rebellion-Vordenker greifen, sondern kann die Tatarenmeldungen zum alljährliche Earth Overshoot Day lesen, die in der Regel mit Warnungen vor einer weiteren Zunahme der Weltbevölkerung verbunden sind.
Man dürfe in Afrika nicht die gleichen Fehler machen wie in Europa, so lautete die Begründung für einen Antrag, den die Grünen im Juni 2016 ins EU-Parlament einbrachten – mit Erfolg. Trotz deutlicher Kritik aus Afrika wurde in bester kolonialistischer Manier fraktionsübergreifend beschlossen, dass „die kleinbäuerliche Landwirtschaft gestärkt“, „der Einsatz von Kunstdüngern und Pestiziden so weit wie möglich eingeschränkt“ und „keine GVO-Kulturen in Afrika“ etabliert werden sollen. Das EU-Parlament kritisiert darüber hinaus „die Annahme, der zufolge durch unternehmerische Investitionen in die Landwirtschaft Ernährungssicherheit und Ernährung“ verbessert wird und „warnt davor, das asiatische Modell der „Grünen Revolution“ auf Afrika zu übertragen – eine Revolution, die Millionen Menschen vor dem Verhungern bewahrte. Mit anderen Worten: Die Satten und Wohlgenährten beschließen, dass im globalen Süden alles so bleiben soll, wie es früher auch in Europa mal war, als ein Landwirt gerade mal vier Personen ernähren konnte und 40 Prozent aller Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiteten. Dafür lügen Foodwach & Co., dass sich die Balken biegen.